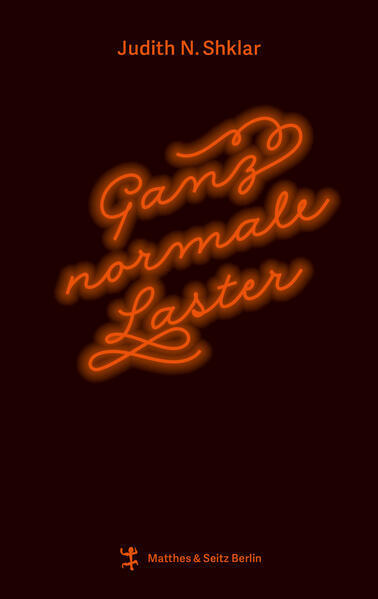Das größte aller Übel ist die Grausamkeit
Kirstin Breitenfellner in FALTER 41/2014 vom 08.10.2014 (S. 32)
Politische Theorie: Die Ethik von Judith N. Shklar geht nicht von der Tugend, sondern vom Laster aus
Meine Laster sind Privatsache und gehen niemanden etwas an! Dieser Aussage würde Judith N. Shklar wohl nicht zustimmen – aber aus anderen Gründen, als man in Zeiten verstärkter Verbotsrufe und überschießender Political Correctness denken würde. Denn die 1928 in Riga geborene Politologin redet damit keineswegs mehr Überwachung, Bevormundung oder einem neuen Moralismus das Wort.
Als Vertreterin eines Liberalismus, der nicht von den Starken ausgeht, plädiert sie im Gegenteil dafür, dass auch schwächeren Mitgliedern einer Gesellschaft möglichst viel Entscheidungsfreiheit und Handlungsspielraum zugestanden werden sollte.
Das Private und das Öffentliche
Laster stehen für Shklar an der Schnittstelle zwischen der Sphäre des Privaten und des Öffentlichen. Wie schmerzhaft das Öffentliche in das Private hineinreichen kann, bekam sie früh am eigenen Leib zu spüren.
Shklar wurde als jüngste von drei Töchtern in eine wohlhabende und liberale deutsch-jüdische Familie in Riga geboren und besuchte dort das deutsche Gymnasium. Vom Vater, einem zaristischen Offizier im Ersten Weltkrieg und Selfmade-Geschäftsmann, kam das Geld, von der Mutter die Bildung.
Nach dem tragischen Tod der ältesten Tochter Miriam gelang der Familie 1939 mithilfe eines Cousins die abenteuerliche, mehr als ein Jahr dauernde Flucht über Schweden, Russland und Japan nach Kanada. 1945, kurz vor ihrem 17. Geburtstag, schrieb sich Shklar für das Studium der Wirtschaft und Philosophie an der McGill University in Montreal ein und fand sehr bald ihre geistige Heimat in der politischen Theorie. Mit 19 heiratete sie den späteren Professor für Zahnmedizin Gerald Shklar, mit dem sie drei Kinder hatte.
1951 ging sie auf Vermittlung ihres Professors nach Harvard beziehungsweise (da hier erst 1975 Frauen zugelassen wurden) an das angeschlossene Radcliffe College. Shklar gehörte zu jenen "Erbintellektuellen" europäischer Provenienz, die entscheidend dazu beitrugen, den kulturellen Provinzialismus dieser Eliteuniversität zu entlüften und ihr zu ihrem heutigen Weltruhm zu verhelfen. Mit 43 Jahren wurde Shklar als erste Frau in ihrem Department zum "Professor of Government" berufen.
Die dünkelhafte, antiintellektuelle Atmosphäre an dieser Eliteuniversität stellt übrigens die Grundlage ihrer Beschreibung des Snobismus in dem gerade erstmals ins Deutsche übersetzten Buch "Ganz normale Laster" dar, das im amerikanischen Original 1984 erschien. Ergänzt wird der Band von einer glänzenden werkbiografischen Skizze von Hannes Bajohr.
Gewalt ist das summum malum
Während Judith N. Shklar, die u.a. mit Stanley Cavell und John Rawls befreundet war, in den USA als eine der wichtigsten politischen Denkerinnen gilt, setzte ihre Rezeption im deutschsprachigen Raum außerhalb von Fachkreisen erst im letzten Jahr ein. Den Startschuss gab die mit einordnenden Essays flankierte Übersetzung ihrer einflussreichsten Schrift, des nur 40 Seiten umfassenden Essays "Der Liberalismus der Furcht" von 1989 in der Reihe "Fröhliche Wissenschaft" bei Matthes & Seitz.
Die dreißigjährige Verspätung erweist sich dabei als Glücksfall, denn auf diese Weise lassen sich Shklars Argumente mit heutigen Problemen "frisch" gegenlesen, etwa zu Macht und Kontrolle oder Freiheit und Sicherheit.
Historisch gesehen wurde der Liberalismus aus den Grausamkeiten der religiösen Bürgerkriege des 16. und 17. Jahrhunderts geboren. Heute dient der Begriff vornehmlich der Beschimpfung des politischen Gegners: In den USA nennen die Rechten die Linken "Liberals" und meinen damit sozialistische Dekadenz, diese geben den Vorwurf mit der Vorsilbe "Neo" zurück und meinen damit sozialen Darwinismus. Dabei scheint die Freiheit heute – durch Nachrichtendienste, Internetfirmen, soziale Netzwerke und religiöse Fundamentalisten – bedroht wie schon lange nicht mehr. Ein guter Anlass, ihre gesellschaftlichen Grundlagen erneut in Augenschein zu nehmen.
Shklars minimalistisches Konzept des Liberalismus geht dabei nicht von einem höchsten Gut, sondern von dem schlimmsten Übel aus: Grausamkeit und Gewalt, die jene Furcht und jenen Schmerz hervorrufen, die es zu verhindern gilt. Denn Freiheit von Furcht stellt die Voraussetzung einer öffentlichen Meinungsbildung und der Ausübung staatsbürgerlicher Rechte ohne Willkür, Ausbeutung und Unterdrückung durch die Herrschenden dar.
Statt auf moralischen oder ideologischen Zielen zu fußen, geht der "Liberalismus der Furcht" von den körperlichen Leiden ganz normaler Menschen aus – und von den "ganz normalen Lastern" jener Zeitgenossen, die für dieses Übel verantwortlich sind. Insofern lässt sich "Ganz normale Laster" als Vorarbeit dazu lesen.
Laster sind keine Sünden
Das Originelle dieses Ansatzes besteht darin, die Laster – die Shklar entlang der Lektüre von Michel de Montaigne (1533–1592) und Montesquieu (1689–1755), aber auch der großen Romane und Theaterstücke der Weltliteratur beschreibt – in eine Rangordnung zu bringen: Grausamkeit, Heuchelei, Snobismus, Verrat und Misanthropie.
Laster sind keine Sünden, sondern ein Urteil, das Menschen über andere Menschen fällen. Deswegen stehen hier keine Vergehen gegen Gott wie Stolz und Maßlosigkeit oder Vergehen gegen sich selbst (Stichwort Rauchen) zur Debatte, sondern gegen andere Wesen.
Grausamkeit an die erste Stelle zu setzen bedeutet für Shklar, die Position der Opfer einzunehmen, und zwar ohne sie zu idealisieren oder ihnen umgekehrt (Mit-)Schuld zuzuweisen. Denn Opfer sind moralisch nicht unbedingt besser als ihre Peiniger, und nur Ideologen wissen in jeder Situation, wer Täter und wer Opfer ist. Dieser Maßstab gibt allerdings, betont Shklar, keine Sicherheiten, denn er gilt nur für bestimmte Situationen, bleibt also immer Zweifeln und Unsicherheiten ausgesetzt.
Grausamkeit an die erste Stelle zu setzen bedeutet aber auch, dass das Zufügen von (körperlichen) Schmerzen mit keiner Religion und keiner Revolution, also keiner Form von Ideologie gerechtfertigt werden kann.
Diesem größten Übel klar nachgestellt sind die Formen von Unaufrichtigkeit: Heuchelei, Snobismus und Verrat. Als letztes Laster reiht Shklar ein wenig überraschend die aus der Mode gekommene Misanthropie, den Menschenhass. Aber es stimmt schon: Sich mit ihren Lastern zu beschäftigen ist nicht eben dazu angetan, die Liebe zu den Menschen zu vergrößern.
Jeder dieser Untugenden widmet Shklar ein eigenes Kapitel. Dabei richtet sie ihr Hauptaugenmerk nicht darauf, wie diese unsere privaten Beziehungen, sondern das Funktionieren des Staatswesens beeinflussen. So entsteht eine Ethik, die keine Morallehre sein will in dem Sinne, die Menschen zu bessern, sondern eine politische Theorie, der es – im Anbetracht der Unvollkommenheit des menschlichen Charakters – darum zu tun ist, die Übel, die von ihm ausgehen, zu minimieren.
Menschliches Verhalten, zitiert Shklar den Skeptiker Montaigne, sei nicht durch die Veränderung von Überzeugungen zu verbessern. Und unter Berufung auf Montesquieu spekuliert sie darüber, ob man Politik und Moral nicht überhaupt trennen könne. Schließlich könne man ja Sozialreformen vornehmen, ohne die Menschen zu verändern.
Da auf den Menschen in puncto Tugenden kein Verlass ist, muss das politische System, lautet ihre Schlussfolgerung, so beschaffen sein, dass die Mächtigen möglichst wenig Schaden anrichten können. Die Prinzipien des modernen Staates, die Gewaltenteilung in Legislative, Exekutive und Judikative, tragen dem Rechnung.
Unsere unaufrichtige Demokratie
Allzu große Ansprüche an die eigene Tugendhaftigkeit führen zu dem zweitgereihten Laster, der Heuchelei. Den Kronzeugen dafür stellt die Figur des Uriah Heep aus Charles Dickens' "David Copperfield" (1849) dar, der die Unterwürfigkeit, wohltätige Unterdrückung und nach innen gewendete Grausamkeit eines bigotten Christentums verkörpert. Die Prinzipien seiner Kritiker – genannt werden Nietzsche und Machiavelli, die Rücksichtslosigkeit und rohe Gewalt verherrlichten – kann Shklar aber ebenso wenig teilen.
In Bezug auf das Staatswesen gewinnt sie der Heuchelei sogar positive Aspekte ab. Denn ihre psychologische Kriegsführung gehört ganz eindeutig zum Geschäft des Friedens. Deswegen verstummen die für Demokratien typischen gegenseitigen Beschuldigungen, Betrugsvorwürfe, Misstrauensanträge und Skandale auch sofort, wenn ein (äußerer oder innerer) Feind ausgemacht wird. Dass in ihnen auch die fähigsten Staatsleute mit Heucheleivorwürfen verfolgt werden, sieht Shklar als Nebenwirkung der seit dem 19. Jahrhundert rasant gestiegenen sozialen Mobilität an.
In Demokratien gehört es zum guten Ton, auch sozial schlechter Gestellte gleich zu behandeln. Die Freundlichkeit und Dienstfertigkeit ohne Ansehen der Person, betont Shklar, die der egalitäre Besucher in Amerika zu Recht bewundere, habe nichts mit Aufrichtigkeit zu tun, sondern sei auf die Verstellung gegründet, "dass wir miteinander vor allem so reden müssen, als sei die gesellschaftliche Stellung für das Bild, das wir voneinander haben, nicht von Bedeutung". Diese Umgangsformen seien zwar "genauso artifiziell wie jene, die zu Molières Zeiten in Versailles" herrschten, aber aus entgegengesetzten Gründen.
Weniger gnädig zeigt sie sich gegenüber dem Snobismus als jener Form der Heuchelei, die andere demütige und verbittern lasse, weil sie Ungleichheit schmerzhaft zu spüren gebe. Der sekundäre Snobismus von Cliquen (den sie im Harvard der 1950er-Jahre zur Genüge studieren konnte), vermutet sie allerdings, sei wohl der unvermeidliche Preis, den unsere Gesellschaft für die gewonnene soziale Mobilität, Freiheit und Vielfalt zahlen müsse.
Auch Verrat hat für sie politische Implikationen, denn er "liegt in der Struktur der Politik einer repräsentativen Demokratie selbst begründet, die zutiefst auf Vertrauen beruht" bzw. auf dem prekären Gleichgewicht von Vertrauen und Misstrauen.
Misanthropie und Optimismus
Judith N. Shklar gehört zu jenen Denkerinnen, die nicht vorgeben, mit ihrer Theorie die ganze Welt in den Griff zu bekommen – und die die Argumente anderer nicht als ihre eigenen verkaufen. Mit diesem Hang zum Understatement begrenzt sie die Aufgaben der politischen Theorie darauf, "unsere Diskussionen und Überzeugungen über unsere Gesellschaft etwas vollständiger und etwas stimmiger zu machen und die Urteile, die wir normalerweise fällen (
), einer kritischen Betrachtung zu unterziehen".
Sie habe den großen Erzählern erlaubt, ihr "ein wenig Arbeit abzunehmen", indem sie ihre "aufschlussreichsten Charaktere und Szenen als Beispiele" herangezogen habe, auf der Suche nach einer "konkreteren Art, über Politik nachzudenken", über die Widersprüche, Komplexität, Vielfalt und Risiken der Freiheit, schreibt sie im letzten Kapitel "Schlechte Charaktere für gute Liberale". Obwohl ihre Beispiele, von Shakespeare über Molière bis Jane Austen, Dostojewski oder Thackeray, zum größten Teil aus dem 16. bis 19. Jahrhundert stammen, sehen diese "interpretativen Wiederbelebungsversuche" nicht alt aus – ein Beleg dafür, dass sich Probleme des menschlichen Zusammenlebens weniger ändern, als man gemeinhin zu denken gewohnt ist.
In diesem letzten Kapitel erfährt man auch, wozu der Menschenhass gut sein kann: zu nichts weniger als der Errichtung eines der humansten aller bisherigen politischen Systeme. Denn eine Moraltheorie wie jene Montesquieus, die fordert, eine Regierungsform zu errichten, die die schlimmsten Laster vermeidet, nämlich Grausamkeit und Ungerechtigkeit, und zwar von und für Menschen, die "zu wenig mehr fähig waren, als sich geringeren Lastern hinzugeben, um die schwereren zu vermeiden", klassifiziert sie als "Sternstunde der Misanthropie".
Gewaltenteilung mindert Gewalt. Und die Demokratie braucht im Grunde weder Talente noch Tugenden, denn sie beruht nicht auf Moral, sondern auf einem Prozedere. Shklar nennt diese Misanthropie im Gegensatz zu der verachtenden, Grausamkeit befürwortenden eines Machiavelli oder Nietzsche eine lachende.
Absage an den Tugendwahn
Moralische Festigkeit ist der Demokratie selbstverständlich nicht abträglich, trotzdem hängt – und das ist die beruhigende Nachricht – ihr Gelingen nicht von den ethischen Bemühungen ihrer Bürger ab. Mit einer Ausnahme: Für Amtsträger sind nicht alle Laster gleich unwichtig, deswegen sollten Ämter und Reglements so konstruiert werden, dass sie die "schlimmsten Laster und schlechtesten Charaktere mildern können".
"Indem sie die Hände von unserem Charakter lassen, bereiten Regierungen den Rahmen und die Bedingungen, unter denen wir unseren armseligen, aber epischen Kampf gegen das Laster aufnehmen zu hoffen dürfen. Ein solches Regierungssystem zu schaffen verlangt aber keinerlei spezifische Tugenden. Es ist ein Regierungssystem für die Menschen, wie sie sind, nicht, wie sie sein sollen."
"Ganz normale Laster" ist kein Plädoyer dafür, das Allzumenschliche in uns zu lieben, aber vielleicht, es weniger abzulehnen. Das in diesem Buch vorbereitete Konzept des Liberalismus bedeutet die Absage an Eindeutigkeiten, Heroismus und Tugendwahn sowie ein Bekenntnis zum Banalen, zu Streitigkeiten, Kompromissen, Vielfalt und Frieden.