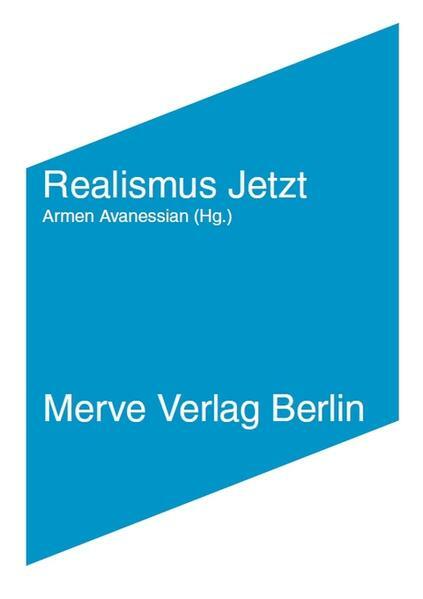Den Neoliberalismus links überholen!
Matthias Dusini in FALTER 9/2014 vom 26.02.2014 (S. 24)
Während sich eine schlaffe Kapitalismuskritik auf Slow Food und Verkehrsberuhigung kapriziert, will eine neue linke Strömung aufs Gas steigen
Der Arbeitstakt kennt kein Pardon. Piepstöne kündigen eingehende E-Mails und aktuelle Termine an. Die Büroarbeit dehnt sich online weit ins Wochenende aus, das ohnehin mit Fitnesstraining, Familie und Freunden verplant ist.
Wer nicht überholt werden will, hetzt von Deadline zu Deadline – und stößt irgendwann einen Seufzer aus: Geht es nicht etwas langsamer?!
Die Geschwindigkeit des zeitgenössischen Lebens wird von Medizinern, Soziologen und Psychologen als Ursache vieler Leiden identifiziert, eine informationstechnologisch hochbeschleunigte Umwelt gilt als Paradigma totaler Entfremdung: Das Individuum droht unter einem stetig wachsenden Termin- und Flexibilitätsdruck aus der Bahn geworfen zu werden. Das vielzitierte "Burnout" ist ein Hilfsbegriff für das Gefühl, die Kontrolle über das eigene Leben zu verlieren.
Ein Manifest geht um in Europa und sagt diesem Unbehagen den Kampf an. Anders als bisherige Diagnosen aber setzen Nick Srnicek und Alex Williams, die beiden Autoren des "Manifests für eine akzelerationistische Politik", nicht auf schonendes Leisetreten, sondern auf das Gegenteil: genug gebummelt! Und auch die von vielen als Ursache allen Übels gebrandmarkte Globalisierung wird bejaht: "Wir wollen den Prozess der technologischen Evolution beschleunigen. Wir fühlen uns darin zu Hause", schreiben Srnicek und Williams.
Die beiden sind junge britische Politikwissenschaftler. Srnicek hat einen Lehrauftrag am University College London, Williams schreibt gerade seine Abschlussarbeit an der University of East London. Sie zählen sich zu einer theoretischen Strömung, die sich "Spekulativer Realismus" nennt und 2007 auf einer Londoner Konferenz gegründet wurde. Die paradoxe Bezeichnung, die so etwas wie die Quadratur des Kreises darstellt, wurde ganz bewusst gewählt.
Die federführenden Autoren dieser losen Gruppe von Philosophen, etwa der in Paris lehrende Quentin Meillassoux oder Ray Brassier von der Amerikanischen Universität Beirut, schreiben für eine breitere Leserschaft kaum geeignete Studien über Immanuel Kant und das "Ding an sich". Dass ihre Thesen dennoch in einschlägigen Internetforen diskutiert werden und auch eine politische Stoßkraft entwickeln, hängt damit zusammen, dass sie ein weitverbreitetes Unbehagen zum Ausdruck bringen.
Zielscheibe der Polemik ist der intellektuelle Mainstream, der die Geisteswissenschaften in den letzten Jahrzehnten beherrscht hat und für den Begriffe wie "Dekonstruktion" oder die sogenannten Cultural Studies stehen. Der von den "Spekulisten" verehrte Cyberveteran Nick Land bezeichnet die in Seminaren, Kunstakademien und politischen Zirkeln verbreitete Stimmung als "transzendentalen Miserabilismus", frei übersetzt: Jammern auf hohem Niveau.
Während die Ökonomie aufs Gaspedal steigt, wird in den Denkerstübchen auf die Bremse gedrückt: Jetzt mal langsam. Erkenntnis? Produkte eines fragwürdigen Wahrheitsanspruches sogenannter Wissenschaft. Wirklichkeit? Ein Konstrukt. Das Individuum? Ausdruck eines weißen, männlichen Imperialismus.
Während in China in wenigen Jahren ganze Millionenstädte aus dem Boden gestampft werden, zerbrechen sich westliche Theoretiker und Künstler den Kopf darüber, ob sie "ich" sagen dürfen. Während Big Data immer größere Anteile unseres Verhaltens und unserer Lebensgewohnheiten erfasst und für die Geheimdienste aufbereitet, streiten sich die Netzaktivisten darüber, ob Leserbriefe anonym oder mit Klarnamen unterschrieben werden sollen.
Während an den Börsen Milliarden in Sekundenbruchteilen den Besitzer wechseln, schlagen die Gegner des Wall-Street-Kapitalismus Protestzelte auf und kochen Slow-Food-Suppen.
Während die Öffnung der Grenzen den Warenaustausch beschleunigt und die Migration fördert, ziehen sich die Kritiker der Globalisierung auf ihre Landkommunen zurück und züchten gentechnikfreien Mais. Egal, ob die Gletscher schmelzen, die Menschen unter dem Regime falscher Schönheitsideale verhungern oder durch Automatisierung ihre Arbeit verlieren: Schuld ist immer der Neoliberalismus.
"Wir waren sowieso nie auf Wachstum aus. Das heißt doch eh nur Entfremdung", imitiert Nick Land den Jargon der Neoliberalismuskritiker. "Und übrigens: schon gehört? Die Eisbären ertrinken
" Aber leider ist der Kapitalismus flink wie ein Wiesel, sind seine Gegner behäbig wie die Pandabären im Zoo.
Die Manifest-Autoren Srnicek und Williams haben ebenfalls nur Spott für den linken Aktivismus über: ",Immerhin tun wir überhaupt was', lautet der Schlachtruf derer, denen ihr Selbstwertgefühl wichtiger ist als wirksames Handeln." Die Errungenschaften der modernen Welt dürfen nicht abgeschafft werden, sondern müssen nur in die richtigen Hände gelangen, lautet das an Karl Marx anknüpfende Gegenargument. Bekanntlich hielt der den Kapitalismus trotz aller Ausbeutung für das bis dahin fortschrittlichste Wirtschaftssystem. "Die Bourgeoisie hat in ihrer kaum hundertjährigen Klassenherrschaft massenhaftere und kolossalere Produktionskräfte geschaffen als alle vergangenen Generationen zusammen", heißt es in seinem gemeinsam mit Friedrich Engels verfassten "Manifest der Kommunistischen Partei" (1848). Im Entsetzen darüber schwingt Bewunderung mit.
Wo die Kritik am Neoliberalismus im Mollton der Klage tönt, erinnern die Appelle von Srnicek und Williams an den Sound futuristischer Manifeste, die Anfang des 20. Jahrhunderts die anämische Sensibilität der Décadence ablösten.
Der Hinweis der Akzelerationisten auf das Raumfahrprogramm der 1960er-Jahre stimmt nostalgisch. Im Zuge der Mondlandung 1969 interessierte sich auch die kritische Intelligenz für Weltraumbesiedelungen und bewusstseinserweiternde Hirnaktivitäten. Heute hingegen diskutieren Aktivisten über Gemeinschaftsgärten und verkehrsberuhigte Innenstädte, anstatt die Wissensexplosion für neue Stadtkonzepte zu nutzen.
Während Banken und Nationalwirtschaften zusammenbrechen, legen sich die Zivilisationskritiker bloß in die Hängematte, um dort – wie zuletzt Ariadne von Schirach – das abgenudelte Mantra freiwilliger Selbstlähmung zu wiederholen: "Du sollst nicht funktionieren!" Die turbosozialistische Antwort lässt auf sich warten. Lässt sich mit Gentechnik und Nanoelektronik nicht auch eine bessere Welt schaffen?!
Leider ist der vitalistische Gestus des Manifests für eine Politik der Beschleunigung auch schon das Beste daran. Ansonsten erhebt es altlinke Forderungen à la "Wir alle wollen weniger arbeiten". Statt den Vereinfachungen der Occupy-Aktivisten eine differenzierte Begrifflichkeit entgegenzusetzen, vereinfacht die Brandrede einmal mehr die Widersprüche des modernen Lebens auf "den Neoliberalismus".
In einem an die K-Gruppen der 1970er-Jahre erinnernden Ton werden die Softies aus den Occupy-Zelten als Basiswappler abgetan. "Die Fetischisierung von Offenheit und Horizontalität seitens der ,radikalen' Linken hat die Voraussetzungen für ihre Wirkungslosigkeit geschaffen", schreiben Srnicek und Williams. Die revolutionäre Avantgarde lässt grüßen.
"Wer von uns kann wirklich sagen, welche unerschlossenen Möglichkeiten in der bereits vorhandenen Technologie schlummern?" Gute Frage! Auf eine Antwort wartet der nach Erlösung aus dem Jammertal des Kritizismus dürstende Leser freilich vergeblich. Die Polemik der beiden Linksbeschleuniger liest sich streckenweise sehr erfrischend, als kommunistisches Manifest wider den digitalen Kapitalismus taugt es wenig. Unter dem Titel "Folk Politics" wollen Srnicek und Williams "demnächst" einen Bauplan für einen politischen Teilchenbeschleuniger nachliefern. So etwas geht eben nicht von heute auf morgen.
In dieser Rezension ebenfalls besprochen: