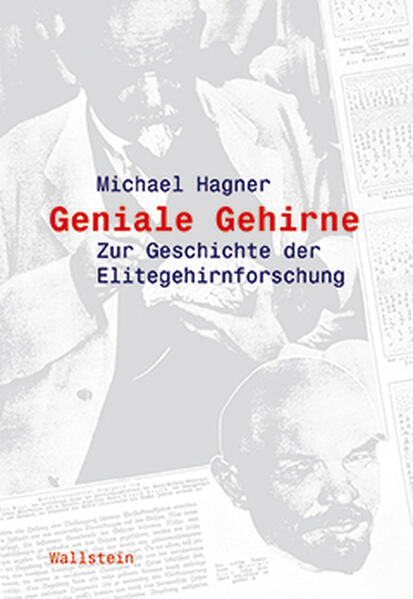Oliver Hochadel in FALTER 41/2004 vom 06.10.2004 (S. 50)
Um die Genialität von Schopenhauer, Lenin oder Einstein zu lokalisieren, wurden deren Gehirne akribisch untersucht. Heraus kam meist, was die Gelehrten hineinprojiziert hatten, wie der ETH-Professor Michael Hagner eindrucksvoll zeigt.
Als Albert Einstein im April 1955 in einem Provinzkrankenhaus in Princeton im US-Bundesstaat New Jersey starb, entnahm der Pathologe Thomas Harvey dem weißen Struwwelkopf bei der Autopsie kurzerhand das Gehirn. Der mit seinem Zufallsfund überforderte Nichtneurologe zerschnitt die Quelle der Relativitätstheorie in knapp 200 würfelförmige Blöcke und legte diese in Formalin ein.
Teile dieses Materials untersuchte Ende der Neunzigerjahre die kanadische Neurowissenschaftlerin Sandra Witelson und befand, dass Einsteins untere Parietallappen besonders entwickelt gewesen seien. Räumliches Erfassungsvermögen und mathematisches Denken hingen stark von dieser Region ab. Für Michael Hagner ist dies ein Rückfall ins 19. Jahrhundert. Schaue man genau hin, lasse sich fast für jedes Gehirn in einer bestimmten Schicht eine von Witelson für Einstein behauptete "einzigartige Morphologie" finden. Der Rummel um Einsteins graue Zellen ist die - vorerst - letzte Episode in der Geschichte der Elitegehirnforschung, die der Professor für Wissenschaftsforschung an der ETH Zürich in seinem Buch "Geniale Gehirne" nachgezeichnet hat.
Bei diesem Stochern im Hirnkasten suchten die Anatomen und Anthropologen nach Differenzen. Folglich haben sie sich vor allem für die Gehirne von Geisteskranken, Kriminellen, Exoten, Frauen (!) und eben Genies interessiert und für die Frage, inwiefern sich diese von "normalen" Gehirnen unterscheiden. Möglich wurde dies durch die "Cerebralisierung" des Menschen, also die zunehmende Gleichsetzung eines Individuums mit seinem Gehirn, die vor etwa 200 Jahren mit der Schädellehre von Franz Joseph Gall einsetzt.
Das Gehirn des Genies ist dabei zunächst noch unantastbar. Erst mal sägt man nur Verbrechern die Schädeldecke auf, bei Kant und Schiller belässt man es bei einer Betrachtung des Schädels. Dieses Tabu wird erstmals ab den 1850er-Jahren umgangen - und zwar im Genre der Gelehrtenhagiografie. Wilhelm Gwinners Biografie Schopenhauers von 1862 enthält auch eine Seitenansicht des Philosophenschädels samt entsprechender Charakterisierung: "Geschlechtstrieb groß bis sehr groß."
Die Gehirne großer Geister wurden zu wertvollen Preziosen, die in Gläsern konserviert sowie in Form von Abgüssen und Zeichnungen die Genialität ihrer Besitzer belegen und zelebrieren sollten. Hagner lässt sich nicht verführen von der Skurrilität seines Gegenstands, sondern kontextualisiert und differenziert. Die Vorstellungen vom Genie reichten vom großen Einzelnen der Goethezeit über den Geniekult des Fin de Siècle, der die Nähe zum Wahn betonte, bis hin zu den Funktionseliten in einer arbeitsteiligen Gesellschaft, die der deutsche Hirnforscher Oskar Vogt in der Weimarer Republik propagierte, Hirnhöherzüchtungsprogramme inklusive.
Die Anatomen betrieben "Gehirnpolitik", ihre gesellschaftlichen Vorstellungen waren eng mit ihrem cerebralen Forschungsprogramm verknüpft. Forscher verschiedener ideologischer Couleur haben sich für die genialen Gehirne interessiert, Konservative ebenso wie der zum Sozialismus tendierende Vogt. War das Hirn hierarchisch organisiert, wie Monarchisten meinten, oder durch eine Struktur interdependenter Areale gekennzeichnet, wie es demokratisch gesinnten Materialisten gepasst hätte?
Dabei ist die Geschichte der Elitegehirnforschung alles andere als eine wissenschaftliche Erfolgsstory. Ihre wechselhafte Konjunktur ist gekennzeichnet von Rückschlägen und mitunter auch Peinlichkeiten. Als das Gehirn des Mineralogen Friedrich Hausmann lediglich 1226 Gramm auf die Waage brachte, überlegte die Pariser Société d'Anthropologie aufgrund des unterdurchschnittlichen Gewichtes, die Veröffentlichungen des Göttinger Gelehrten infrage zu stellen. Die Familie des Verblichenen war wenig erfreut, die Absicht des verantwortlichen Hirnanatomen Rudolph Wagner war ins Gegenteil verkehrt worden.
Die zentrale Frage konnte die Elitegehirnforschung nicht einmal annähernd befriedigend beantworten: Woran erkennt man den großen Geist, wenn er in Weingeist schwimmt? Volumen und Gewicht erwiesen sich immer mehr als unbrauchbare Parameter. Neue Aussichten bot die Untersuchung der Hirnwindungen, wobei Windungsreichtum und -vielfalt das Genie verrieten. Oskar Vogt nannte das abschätzig "Furchenmorphologie". Weg von der Oberfläche, lautete seine Devise, auf die Zellarchitektur kommt es an!
Ende der Zwanzigerjahre zerlegte Vogt auf Einladung der sowjetischen Regierung Lenins Gehirn in mühevoller Arbeit in 30.000 Schnitte. Aufgrund auffallend großer Pyramidenzellen in der III. Rindenschicht bezeichnete Vogt Lenin als "Assoziationsathleten" und konnte so, wie gewünscht, die Genialität des Revolutionsführers dingfest machen. Das letzte Aufflackern der Elitegehirnforschung war Vogts vergeblicher Versuch, 1946 die Gehirne hingerichteter NS-Verbrecher wie Göring und Ribbentrop seiner Sammlung einzuverleiben.