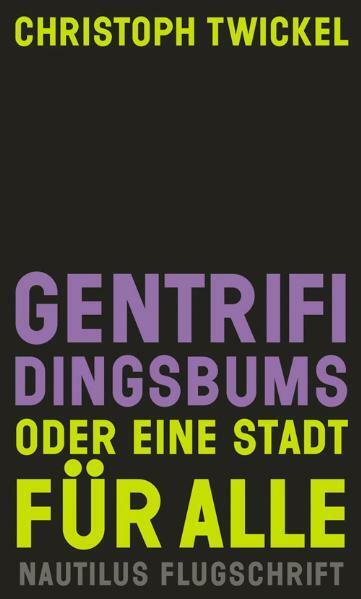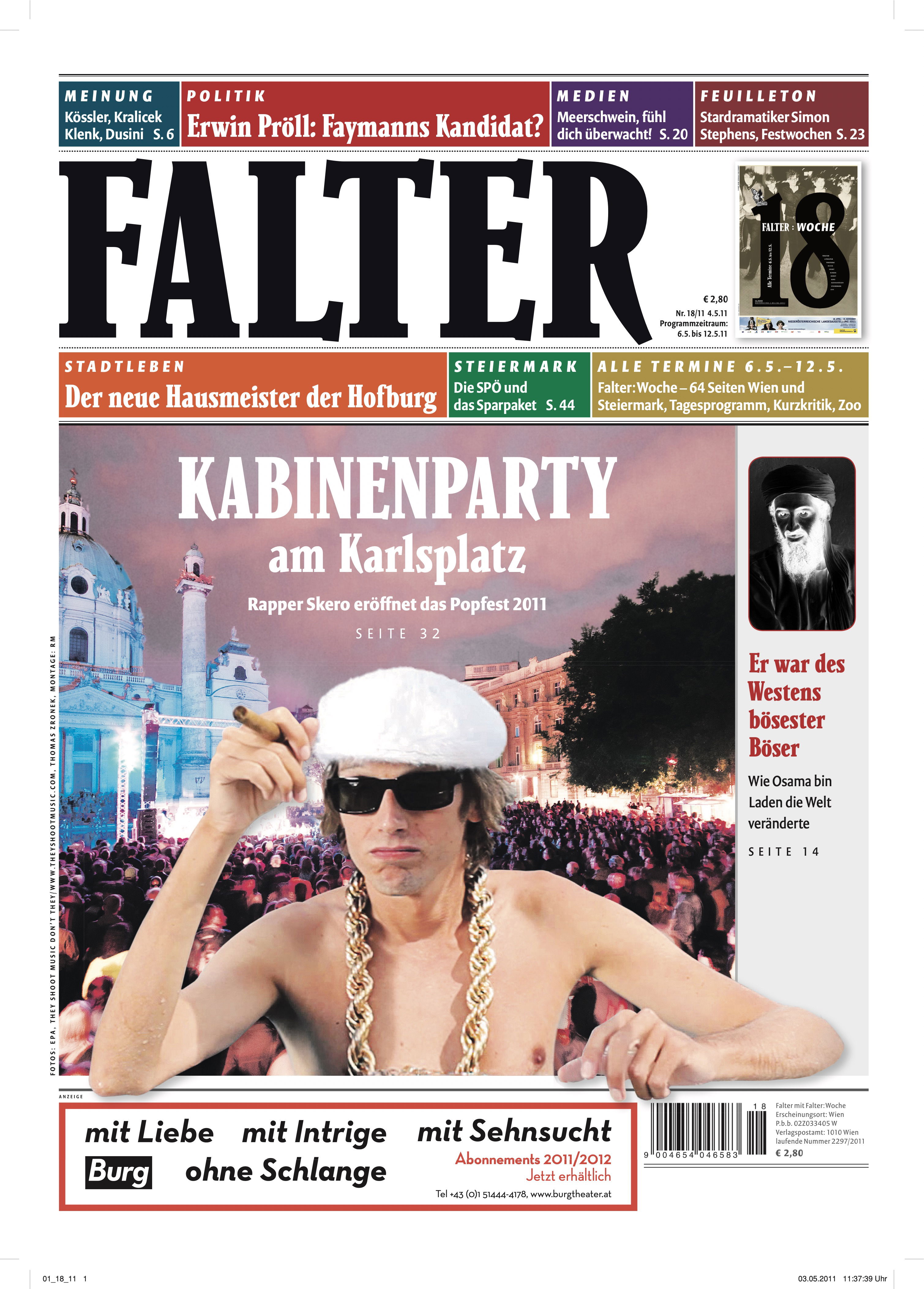
"Wie Stadt funktioniert, haben diese Leute nicht verstanden"
Tiz Schaffer in FALTER 18/2011 vom 04.05.2011 (S. 42)
Der Hamburger Autor und Journalist Christoph Twickel ist zu Gast beim Lendwirbel. Ein Gespräch über verordnete Kreativität und wie man sich gegen die Gentrifizierung wehrt
Die Aktivisten des Lendwirbel, er ist diese Woche losgegangen, haben eben ein Manifest veröffentlicht (siehe S. 43). Dort wenden sie sich, grob gesagt, gegen die Vereinnahmung ihres Schaffens und auch gegen die sogenannte Gentrifizierung. Ein Begriff, der die Aufwertung eines Viertels und die daraus resultierende Verdrängung der sozial Schwächeren beschreibt.
Ein Manifest gibt es in Hamburg schon die Spur länger. Ende 2009 wurde "Not In Our Name, Marke Hamburg!" erstmals präsentiert, später auch in der Zeit abgedruckt. Christoph Twickel war Mitinitiator und Sprecher der Bewegung und hat voriges Jahr in der Edition Nautilus "Gentrifidingsbums oder Eine Stadt für alle" veröffentlicht. Ein erhellendes Büchlein, das die Mechanismen der Gentrifizierung anhand der Hansestadt veranschaulicht.
Twickel ist aber auch Journalist und schreibt etwa für die taz, Spex oder Brand Eins. Als wir ihn telefonisch in Hamburg erreichen, ist er gerade im Einsatz.
Falter: Da ist ja einiger Lärm im Hintergrund, Herr Twickel. Wo sind Sie denn gerade?
Christoph Twickel: Ich bin jetzt gerade mitten in St. Pauli, im ehemaligen Rotlichtviertel, seit Anfang der Neunziger mehr und mehr auch ein Touristenviertel und in den letzten Jahren gentrifiziert. Die Mieten hier sind seit 2005 um ungefähr dreißig Prozent gestiegen. Es findet gerade eine große Demonstration statt, die von der Roten Flora organisiert wird. Das ist ein besetztes autonomes Zentrum im Hamburger Schanzenviertel. Vor zehn Jahren hat die Flora ein privater Investor gekauft, der aber nie was machen hat können, weil es besetzt war. Jetzt würde er es gerne weiterverkaufen, dagegen richtet sich diese Demo.
Sie sind ja einerseits als Aktivist in Sachen Anti-Gentrifizierung tätig, anderseits berichten Sie immer wieder als Journalist über dieses Thema. Lässt sich das vereinbaren?
Twickel: Ich werde natürlich nicht über Projekte berichten, in die ich unmittelbar involviert bin. Als Beobachter einer heterogenen Protestbewegung, glaube ich, kann ich das schon machen. Und ich halte das auch nicht für einen Widerspruch, dass man als Journalist eine politische Haltung hat und trotzdem versucht, die Zusammenhänge kritisch zu beleuchten.
Ihr Buch nennt sich "Gentrifidingsbums". Ist das nicht zu verniedlichend für einen
unsympathischen Prozess?
Twickel: Gentrifizierung hat als Begriff eine erstaunliche Karriere gemacht. 1964 wurde er das erste Mal verwendet, als Terminus technicus der Soziologie, der die Aufwertung städtischer Räume beschreibt. Dieser wissenschaftliche Begriff ist mittlerweile ein politischer geworden. Einer, den die Leute verwenden, um etwas auszudrücken, das sie auch selber betrifft, woran sie unter Umständen leiden, wogegen sie sich wenden. Andererseits ist es eben immer noch dieses schwer zu merkende Wort. Gentri..fi.., na ja, dieses Dingsbums halt! Der Titel soll signalisieren, dass auch Leute das Buch lesen und verstehen können, die nicht so sehr im Thema drinstecken.
Die Kreativen sind ja immer ungewollte Mitverursacher der Gentrifizierung. Wie sollen sie sich verhalten?
Twickel: Ich sehe keinen Grund, warum jemand, der als Pionier zur Gentrifizierung beigetragen hat, sich nicht entgegenstemmen soll, wenn ihn die Aufwertung nun auch betrifft. Das ist produktiver, als sich schuldig zu fühlen. Das, was die verschiedenen Szenen und die Unterschiedlichkeit der Leute in einer Stadt hervorbringen, ist Gemeingut, das gehört ja jedem. Aber in einem ökonomischen Aufwertungsprozess wird es privatisiert und zur Kulisse, und man kann nur dabei sein, wenn man die entsprechenden Mieten zahlen kann. An der Hausbesetzerbewegung der Siebziger und Achtziger sehen wir, dass Widerstand gegen diese Privatisierung zum Teil Erfolge zeitigt. Leute haben es geschafft, Dinge zu erobern, die sie sich ökonomisch nicht leisten konnten, weil sie politischen Druck ausübten. Die Geschichte dieser Bewegung zeigt aber auch: Hier hat eine Verbürgerlichung und Professionalisierung stattgefunden, die vor allem weiß, akademisch und inländisch ist: Die Baugruppen, die Wohnprojekte – das sind Waffen, mit denen eine linksbürgerlich-akademische Schicht ihren Platz in der Stadt erobert, die vielleicht nicht besonders gut verdient, aber über soziales und kulturelles Kapital verfügt.
Und heute?
Twickel: Gentrifizierung ist von einem Prozess, der eher über Angebot und Nachfrage gesteuert war, zunehmend zu einem Prozess geworden, der ganz bewusst politisch betrieben wird. Wenn es in einem eigentlich attraktiven innerstädtischen Viertel noch immer schlecht verdienende Migranten, Hartz-IV-Empfänger und ältere Leute gibt, dann heißt es plötzlich: Das ist ein Problemviertel, ein Schandfleck, da muss man was machen. Dann versucht man ganz gezielt Künstler und Kulturszenen hinzubekommen, um dem Viertel ein anderes Flair zu geben. Über diesen Prozess muss man sich im Klaren sein, um etwas verändern zu können. Um zu sagen: Dieses Haus, das wir jetzt für ein paar Jahre zur Zwischennutzung bespielen, wie wärŽs denn, wenn wir es längerfristig beanspruchten? Unter welchen Bedingungen könnte das ein Ort sein, der nicht im Sinne von ökonomischer Aufwertung und Ausschließung funktioniert? Künstler sind an dieser Stelle oft merkwürdig unbedarft, wenn sie anfangen, sich in den Dienst einer möglichen Verbesserung der Lebenssituation zu stellen, ohne eigentlich zu wissen, ob das für die Leute, die da leben, auch eine Verbesserung ist.
Ist das nicht sehr viel Verantwortung, die man den Kulturschaffenden da aufbürdet? Müsste das nicht eigentlich Sache der
Politik sein?
Twickel: Das ist natürlich richtig. Ich plädiere an der Stelle dennoch dafür, dass man sich als Künstler Gedanken darüber machen soll, dass die eigene Arbeit auch Teil eines sozialen Vorgangs ist. Ich finde das, was in Hamburg in Zusammenhang mit der Besetzung des Gängeviertels passiert ist, sehr interessant. Da hat man gesagt: Das Gängeviertel, das halten wir für so bedeutsam, auch aufgrund seiner Geschichte, dass wir es jetzt beanspruchen. Dass ein Teil der Stadt, der bereits der Privatisierung durch Immobilienkapital anheim gefallen zu sein schien, wieder vergesellschaftet wird. Dass man sagt: Dieser Ort könnte auch ein ganz anderer sein. Künstler können ja an bestimmten Punkten Verhältnisse besser machen, sie verändern oder irritieren. Das ist auch eine große politische Kraft. Es ist im Gängeviertel gelungen, diesen schal gewordenen Begriff der Kreativität neu zu besetzen und einen anderen politischen Raum damit aufzumachen. Eben indem man gesagt hat: Ihr redet immer von der kreativen Stadt, wir aber kämpfen um unsere Freiräume, um vielleicht Musik aufnehmen zu können, um Platten aufzulegen oder Bilder zu malen oder sonst was, und wir verstehen uns nicht als Wirtschaftsfaktor. Und wir haben das Interesse, uns mit jenem Teil der Gesellschaft zu solidarisieren, der eben von solchen Aufwertungsprozessen negativ betroffen ist.
Ist dieses Vorhaben im Gängeviertel geglückt?
Twickel: Es ist nach wie vor besetzt, was von der Stadt geduldet wird. Die Stadt hat das gesamte Areal vom Investor zurückgekauft – ein niederländischer Immobilienfonds. Jetzt ist man dort in einer Wartestellung. Die Leute des Gängeviertels können dort keine grundlegende Sanierung vornehmen, weil sie die Mittel dafür nicht haben. Aber sie reparieren und verbessern die Situation dort peu à peu und machen Unmengen von Veranstaltungen. Man sucht jetzt nach einer Lösung, wie dieses Viertel saniert werden kann. Die Besetzer beanspruchen eine kollektive Hoheit über diesen Prozess, die Stadt will es sich eher leicht machen und es nach Schema F sanieren lassen – womöglich auch, um eine zukünftige Verwertung und Privatisierung offen zu halten. In einigen Wochen wird man der Stadt einen Vertrag vorlegen, der festhält, wie man sich die Sanierung vorstellt. Dann wird der Konflikt in die nächste Runde gehen.
Bringen die Kreativviertel eigentlich das, was sich Stadtpolitiker erwarten?
Twickel: Die Gentrifizierung von Stadtteilen ist ja seit einigen Jahren Generalkonzept der Stadtentwicklung. Auch im Ruhrgebiet etwa oder in Gebieten der ehemaligen DDR. Man baut mitten in Dortmund eine alte Brauerei zu einem Kunst- und Designhaus um und stellt sich vor, dass da dann eine Menge interessanter, kreativer Start-ups reinkommen. Es ist eine Steuerungsfantasie, die meint, wenn die sogenannten Kreativen da sind, dann boomt auch die Wirtschaft. Weil das aber alle Städte versuchen, gibt es Gewinner und Verlierer. Für die, die der Konkurrenz unterliegen, erweist es sich als ein leeres, aber kostspieliges Versprechen. Man merkt es ja auch an Städten wie Berlin: Die Anwesenheit vieler prekärer Freelancer in den sogenannten "Kreativbereichen" basiert dort immer noch auf dem Umstand, dass Berlin die hoch subventionierte ehemalige Frontstadt und jetzige Hauptstadt ist. Überspitzt ausgedrückt: Es gibt zwar keine Jobs, aber dafür lebst du auch für die Hälfte dessen, was du in Hamburg brauchst. Es gibt in Hamburg einen aktuellen Fall, das ist die HafenCity. Im Zuge der Finanzkrise ist dieses Projekt ebenfalls stark ins Schleudern geraten und man hat sich entschlossen, aus einem kleinen Teil des Gebiets ein sogenanntes Kreativquartier zu machen. Das ist genau so eine Steuerungsfantasie, die verrät, dass diese Leute nicht kapiert haben, wie Stadt funktioniert. Stadt ist verdichtete Unterschiedlichkeit, und sie wird als Plattform produktiv, weil ganz unterschiedliche Menschen aufeinandertreffen.
Sind die Kreativen letztlich nur Statisten für Immobiliengeschäfte und Konsumankurbelung?
Twickel: "Die Kreativen" gibt es ja gar nicht. Hinter der bei Stadtentwicklern so beliebten Sammelbezeichnung "Kultur- und Kreativwirtschaft" verbirgt sich ein Sammelsurium völlig unterschiedlicher Lebensentwürfe. Das reicht von der international agierenden Werbeagentur bis zum bildenden Künstler, der sich mit irgendwelchen Jobs seine freie Arbeit finanziert. Da gibt es überhaupt keine gemeinsame Klassenlage, das ist eigentlich ein ziemlicher Popanz. Aber zu Ihrer Frage: Es gibt seit ungefähr zehn Jahren eine Tendenz dazu, die freie Kultur nach Maßgabe stadtentwicklungspolitischer Ziele zu fördern. Kulturprojekte sollen dazu beitragen, einen Ort imagemäßig positiv zu besetzen – und sie sollen das Feld auch beizeiten wieder räumen.