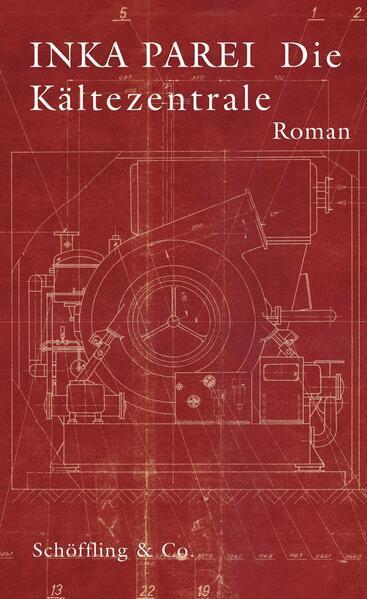Nachrichten aus einem verschwundenen Land namens DDR
Sigrid Löffler in FALTER 41/2011 vom 12.10.2011 (S. 14)
Mehr als 20 Jahre nach dem Ende der DDR ist diese mehr denn je Thema der deutschen Literatur. Die meisten Autoren haben gemischte Gefühle.
Die Mauer ist seit mehr als 20 Jahren weg, die DDR ist verschwunden, doch waschechte DDR-Menschen sind nach wie vor munter unterwegs. Auch in der Literatur. Vor allem in der Literatur. Vor allem in der Literatur, die von gebürtigen DDR-Autoren (zumeist: Autorinnen) geschrieben wird.
Egal, welcher Alterskohorte sie angehören, ob sie gestandene Romanschreiber mittleren Alters sind oder gerade ihr erstes Buch herausbringen: Die Nachbilder der DDR bedrängen sie immer noch und wollen erzählt sein. Der real verunglückte sozialistische Staat kann freilich nur in Form von Verfallsgeschichten erzählt werden. Dieser Verfall kann bedauert oder bejaht werden – von den meisten Autoren beides zugleich. Ihre Bücher changieren zwischen Abrechnung und Rechtfertigung.
Die Älteren bringen ihre historische Zeugenschaft ins Spiel – sie wissen noch, wie der Alltag hinter der Mauer ausgesehen und wie der Mief gerochen hat, wie sich das verschwiegene Unbehagen an den lauten Propaganda-Lügen anfühlte, wie verhockt die Feste und Feiern in der Kleinbürger-Diktatur waren, geprägt von Lagermentalität, Spießer-Behagen und Spitzel-Präsenz. Die Jüngeren halten sich mehr an das, was sie als prägend miterlebt haben – den Ausverkauf ihres Staates nach 1989, die rigorose Umschulung seiner verwirrten Bürger, den Siegeszug der West-Mentalität in allen Lebensbereichen, die Anpassungsturbulenzen an das neue westdeutsche System und an den Vulgärkapitalismus.
Chaotische Gefühle
Gemeinsam sind den älteren und den jüngeren Autoren die gemischten Gefühle für ihren untergegangenen Staat – und sich auf gemischte Gefühle einen deutlichen Reim zu machen ist ja immer ein lohnendes literarisches Projekt.
In den literarischen Neuerscheinungen dieses Herbstes wimmelt es von DDR-Wiedergängern. So manche bemerkenswerte, wenngleich nicht unbedingt sympathische DDR-Figur hat in den neuen Romanen einen denkwürdigen Auftritt. Etwa die Biologielehrerin Inge Lohmark, die eine letzte Schulklasse am zugrunde gehenden Charles-Darwin-Gymnasium in einer Kleinstadt Vorpommerns unterrichtet, eines Landstrichs, der sich nach der Wende rasant entvölkert.
In ihrem sogenannten Bildungsroman "Der Hals der Giraffe" führt die 31-jährige Judith Schalansky aus Greifswald ihre Protagonistin als verknöchertes und verbittertes Exemplar der alten DDR vor. Inge Lohmark muss zusehen, wie aus ihrem gewohnten sozialistischen Biotop statt der versprochenen "blühenden Landschaften" eine Sozialbrache, ein Land der Verlierer, ein Abwanderungs- und Abwicklungsgebiet wird, in dem auch die Zukunftschancen ihrer Schüler gleich mitabgewickelt werden. Durch die Wende sieht sich die Lehrerin in ihrem unbarmherzigen Sozialdarwinismus grimmig bestätigt – bis eines Tages ihr Zynismus-Panzer nicht mehr schützt und ein unerwartetes Gefühlschaos sie ins Herz trifft.
Mit chaotischen Gefühlen kennt sich auch die 27-jährige Journalistin und Autorin Andrea Hanna Hünniger bestens aus. Sie ist in einem Plattenbauviertel am Rande von Weimar als Tochter höherer Parteikader aufgewachsen und war fünf, als die Mauer fiel. Nun debütiert sie mit ungeordneten, widersprüchlichen, offenherzig autobiografischen, doch streckenweise recht verplapperten Erinnerungen an "Meine Jugend nach der Mauer".
Ihr Blickwinkel entspricht ihrem Alter: An die Schule erinnert sie sich aus Schülerperspektive, wenn sie mit der DDR-Erziehung "durch depressive, eingeknickte, krumme, enttäuschte, beschämte, schweigende Eltern und Lehrer" ins Gericht geht. Ihr Vater, der Parteisekretär, wird arbeitslos und verfällt in Trauer und Schweigen; die Mutter, bisher eine angesehene Naturwissenschaftlerin, wird durch den schikanösen Arbeitsamt-Parcours und durch sinnlose Umschulungskurse zermürbt.
Hünnigers Meinung zum Anschluss an die West-Republik ist schwankend. Mal erblickt sie, ganz Kind ihrer deklassierten Eltern, in der Einheit "einen Raubzug, einen Kahlschlag, eine Zerstörung, eine Brandrodung". Mal stellt sie nüchtern fest: "Die DDR war eine Erfindung, vom Namen dieses Landes angefangen bis zu den Wahlergebnissen." Dann wieder entsinnt sie sich bewundernd des tollen Theater- und Kunstlebens in der DDR: "Eigentlich irre, was so ein kleiner, verkrampfter Staat alles hervorgebracht hat."
Eine Art Kältezentrale?
Unter den Stichworten Videorecorder, Mountainbike, Klettverschluss und Weichspüler erinnert sie sich an die hilflose Überwältigung der DDR-Menschen durch das Konsum-Überangebot der neuen Supermärkte und fragt sich im Rückblick naiv: "Wird man glücklicher, nur weil es Weichspüler für alle gibt?" Sie hat noch die Möbelberge, "die Haufen toter Wohnzimmer" vor Augen, die von neueinrichtungswütigen DDR-Bürgern auf den Deponien entsorgt wurden: "Die Leute warfen ihre ganze Vergangenheit auf den Müll." Und das gänzlich ohne Druck: "Freiwillig hat man sich dem Westgeschmack angepasst – ein Verkauf des Selbst, der auf Ahnungslosigkeit basierte."
Hünnigers Resümee: "Im Nachhinein wird dieses DDR-Land eine Art Wunschbild, ein Träume-Schäume-Fata-Morgana-Staat" – einerseits Eingesperrt-Land, Stasi- und Folterland, andererseits Traumland der kostenlosen Kindergärten und des übersichtlichen Lebens ohne Zukunftsangst und Absturzgefahr. Der Buchtitel "Das Paradies" kann also nur ironisch gemeint sein.
Apropos Absturzgefahr. Sozial zerrüttete und verrohte Milieus waren in der DDR offiziell nicht existent und kamen daher auch in der Literatur nicht vor (und wenn doch, wie in Werner Bräunigs großartigem Roman "Rummelplatz", dann durfte das Buch in der DDR nicht erscheinen). Dass es im Arbeiter- und Bauernstaat trotzdem auch Jugendverwahrlosung, asoziale Unterschichtfamilien und in manch einem Betrieb brutale, menschenverachtende Arbeitsverhältnisse gegeben hat, kann im Rückblick heute offener thematisiert werden als vor der Wende.
Angelika Klüssendorf, die in Leipzig aufwuchs, und Inka Parei, die in Berlin lebt, suchen ihr Romanpersonal genau dort, wo die DDR am kältesten war und Außenseiter am eisigsten gemobbt wurden – in einem Spezialkinderheim für die "Umerziehung fehlentwickelter junger Menschen", wo "Das Mädchen" – Klüssendorfs halbwüchsige wilde Heldin Alex – landet, oder gleich im kalten ideologischen Herzen des Staates, in dem Inka Pareis Roman spielt, nämlich im Berliner Zeitungsgebäude des Parteiorgans Neues Deutschland.
Man wird Pareis Romantitel "Die Kältezentrale" auch als Metapher lesen dürfen. Der Roman spielt unter Kältetechnikern, die die gewaltigen Kältemaschinen in der Druckerei warten und bedienen müssen. Doch auch das Arbeitsklima ist unmenschlich kalt und birgt tödliche, vertuschte Geheimnisse. Und war nicht die DDR, dieses neue Deutschland, selbst eine Art Kältezentrale, ein Land, in dem soziale Kälte gegen alles Unangepasste, Abweichende und Nichtkonforme hergestellt wurde?
Liebe in Zeiten der langen Schatten
Angelika Klüssendorf schreibt – lakonisch, trocken, im harten Präsens – die Chronik der Kindheit und Jugend des Mädchens Alex bis zu ihrem 17. Geburtstag. Ihr Vater ist kriminell, gewalttätig und ein Trinker, die Mutter ist haltlos, schleppt immer wieder andere Männer an und lässt die Kinder verkommen. Alex wird geprügelt und herumgestoßen. Und dennoch lernt sie, sich durchzuboxen, entwickelt Ich-Stärke und Intelligenz, entdeckt das Bücherlesen und entwirft für sich sogar eine Idee von einem künftigen Leben.
Kann man sich an die DDR erinnern, ohne dass irgendwann die Staatssicherheit ins Spiel kommt? Natürlich nicht. Es bleibt der Potsdamerin Antje Rávic Strubel vorbehalten, in ihrem neuen Roman "Sturz der Tage in die Nacht" den dämonischsten DDR-Wiedergänger auftreten zu lassen: Rainer Feldberg, einen ehemaligen Stasi-Oberst, der seit der Wende die Schnüffel-Agentur "Mega Operation & Risk Protection" betreibt, aber seinem düsteren Geschäft von einst treu geblieben ist. Wir dürfen in ihm den ideellen Gesamt-Geheimdienstler erblicken, den zweckfrei agierenden und Menschen zerstörenden Wühler, Zersetzer und Desinformanten.
Als eine Art Nemesis der untergegangenen DDR bricht dieser Feldberg in eine Welt ein, die nicht auf ihn gefasst und gegen seine Intrigen die längste Zeit wehrlos ist. Schauplatz des Romans ist eine schwedische Vogelschutzinsel vor Gotland im Sommer 2009. Die Jahreszeit ist der überhelle und die Sinne verwirrende schwedische Sommer, das überreizte und überwache Klima der taghellen Nächte. Im Mittelpunkt steht die Ornithologin Inez, eine rätselhafte und erotisch verwirrende Frau um die 40, die sich in einen viel jüngeren Mann, den 25-jährigen Erik, verliebt. Es geht also um Gefühlsturbulenzen und um eine unmögliche, verbotene, nicht lebbare, aus der Normalzeit gefallene Liebe.
Aufstieg und Niedergang
Bald wird klar, dass Inez wie auch Erik aus der DDR stammen und dass sie den Stasi-Mann von früher kennt. Was will er von ihr? Antje Rávic Strubel verschmäht nicht die Mittel des Unterhaltungsromans und des Melodrams, sie setzt auf die Techniken der Spannungsdramaturgie und hantiert geschickt mit dem Instrumentarium von Geheimnis, Aufdeckung und Enthüllung. Der lange Schatten der DDR fällt bis in die wilde, glückverheißende Schutzinsel der reinen Naturkräfte – und wie sich zeigt, kann diese Welt gegen das böse Kalkül des Eindringlings aus der Vergangenheit nicht bestehen.
Die klassische Form der Verfallsgeschichte ist der Familienroman. Und den exemplarischen Roman, der den Verfall der DDR am Verfall der eigenen Familie entlang erzählt, hat Eugen Ruge, der Sohn des berühmten DDR-Historikers Wolfgang Ruge, geschrieben. Er ist mit 57 Jahren der älteste Debütant von allen: Er wollte erst den Tod seiner nächsten Verwandten abwarten, ehe er sein Lebensbuch publizierte. "In Zeiten des abnehmenden Lichts" führt den Aufstieg und den Niedergang einer berühmten Intellektuellenfamilie der DDR-Nomenklatura in vier Generationen und über ein halbes Jahrhundert vor – von den Urgroßeltern, den ehernen Kommunisten der Stalin-Zeit, bis zum Nach-Wende-Urenkel, der mit dem fehlgegangenen Projekt DDR nichts mehr zu tun haben will.
Beschrieben werden die beiden Gruppen der DDR-Aufbaugeneration – die kommunistischen Rückkehrer aus der Moskauer und aus der mexikanischen Emigration (die Moskau-Heimkehrer hatten längst alle wichtigen Staats- und Parteiposten besetzt, ehe die West-Emigranten aus Mexiko ankamen). Die krassesten Widersprüche hatte die mittlere Generation auszuhalten, die wie Eugen Ruges Vater in Stalins Gulag gelitten und sich dennoch dem sozialistischen Projekt DDR verschrieben hatte.
Eugen Ruge erzählt mit abgeklärter Gelassenheit und nicht ohne Ironie, wie seine Familie an der DDR festhielt, weil sie an der eigenen Biografie festhalten wollte (und musste). Gelungen ist ihm der große zeitdiagnostische Epochenroman über ein verschwundenes, aber immer noch lebendiges Land.
In dieser Rezension ebenfalls besprochen: