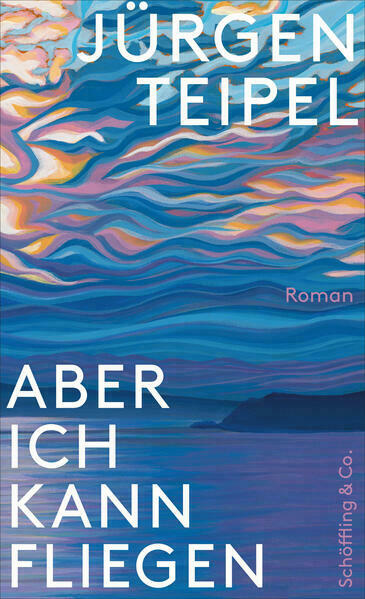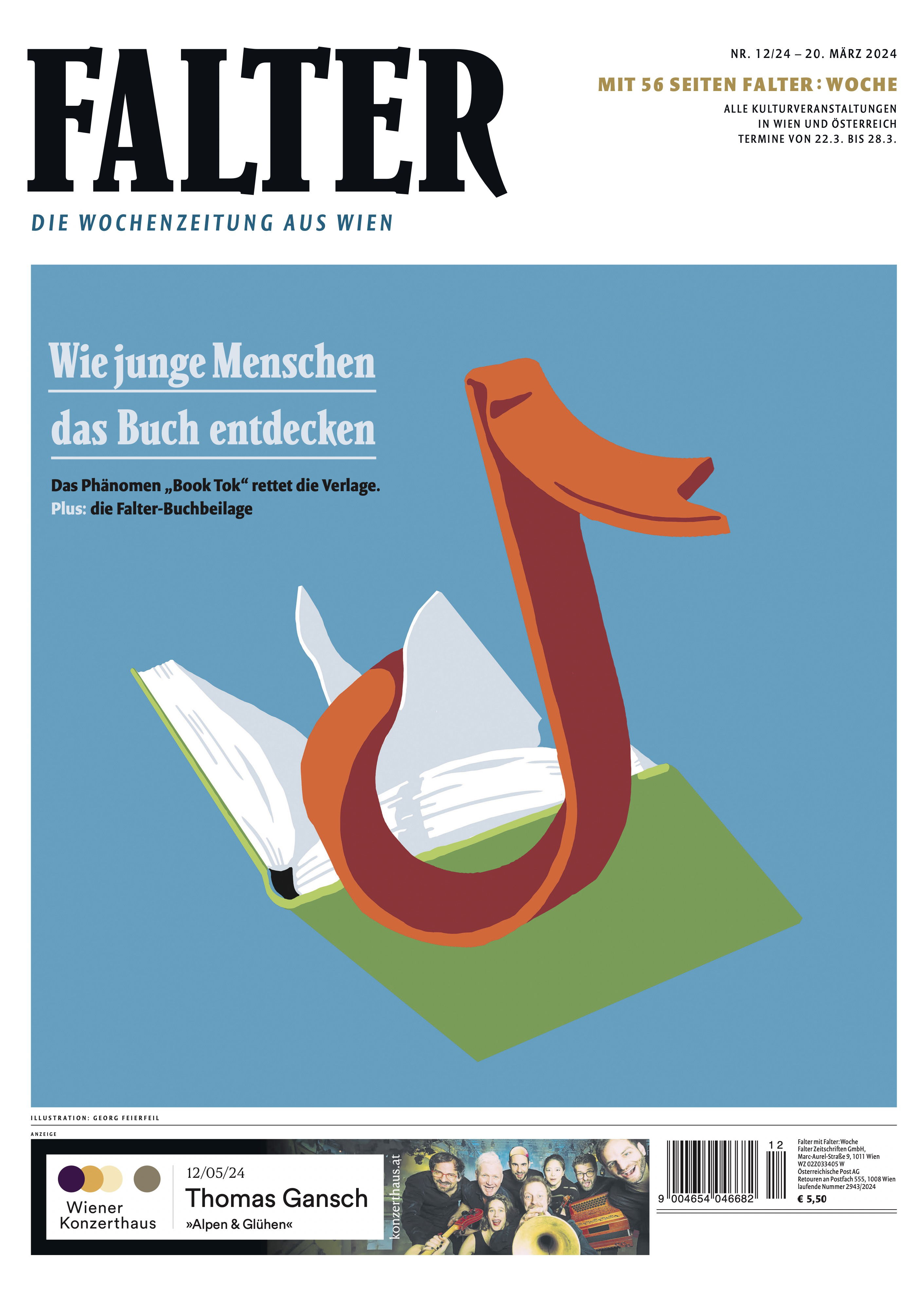
Ein selbstunsicheres Geschöpf blickt zurück
Gerhard Stöger in FALTER 12/2024 vom 20.03.2024 (S. 12)
Die Geschichte von Punk und New Wave in Deutschland hat knapp vor der Jahrtausendwende kaum jemanden interessiert. Pophistoriker, Kunstkennerinnen mit etwas weiterem Horizont und Subkulturnostalgiker, okay, aber sonst?
Mit etwas Glück fand man die alten Platten damals noch billig in Second-Hand-Läden und auf Flohmärkten. Die Toten Hosen waren längst Rockstars geworden, die Einstürzenden Neubauten Liebkinder der Hochkultur. Andere hatte es in die Clubkultur verschlagen; in den Film, ans Theater, in die bildende Kunst. Manche waren am bürgerlichen Leben gescheitert, andere tot. Thematisiert wurde all das allenfalls in nischigen Internetforen.
Kurz nach der Jahrtausendwende war plötzlich alles anders: Jürgen Teipel veröffenlichte das Buch „Verschwende deine Jugend“, eine Oral-History-Erzählung von Protagonistinnen und Protagonisten der schnellen Jahre ab 1976. Das bei Suhrkamp verlegte Buch geriet zum Bestseller, Bands reformierten sich, Ausstellungen wurden gemacht, Kinofilme gedreht, Platten neu aufgelegt.
„Verschwende deine Jugend“ setzte einer Jugendkultur ein Denkmal, die für weit mehr stand als Musik, Style, Ästhetik und ein rebellisches „Nein“. Punk war, auch in Deutschland, eine Epochenwende und ein großer Möglichmacher. Teipel gelang es, diese Geschichte ungemein fesselnd zu erzählen und auch für Nachgeborene aufzubereiten. Man musste das Werk von Bands wie Malaria!, Mittagspause, Deutsch-Amerikanische Freundschaft, Abwärts, Male oder S.Y.P.H. daher gar nicht kennen, um von diesem Buch, dieser Zeitreise mitgerissen zu werden. Vielstimmig erklangen hier unzählige kleine und eine große Heldengeschichte(n), wenn auch nicht immer mit heroischem Ende.
Über den Autor selbst wusste man nicht viel. Jahrgang 1961, einst selbst Punk-Fanzinemacher und Szeneprotagonist, später Journalist. Und dann eben: Buchautor und selbst Held, als Punk-Dokumentarist. Nach „Verschwende deine Jugend“ sollte Teipel weitere Bücher veröffentlichen, über Techno und DJ-Culture oder die Interaktion von Mensch und Tier.
Sein Opus magnum hatte er 2001 „Doku-Roman“ genannt; nun treibt er mit dem Begriff Roman erneut Schindluder. Denn Teipels neues Buch „Aber ich kann fliegen“ mag zwar mit viel gutem Willen als Autofiktion durchgehen; de facto ist es aber das therapieliterarische Dokument eines über weitere Strecken alles andere als glücklichen Lebens. Des Lebens von Jürgen Teipel.
Als da waren: schwierige Kindheit; das stete Gefühl der Fremdheit weit über die Jugend hinaus; psychische Probleme bis hin zum stationären Klinikaufenthalt; Unsicherheit in Sachen Sexualität und Begehren; eine Sprachlosigkeit, die das soziale Miteinander erschwert, von Beziehungen ganz zu schweigen; Schuldgefühle für den Tod der ersten Freundin, die mit 16 bei einem Reitunfall stirbt; Family-Issues nicht zu knapp.
All das erzählt Teipel ungeschützt und teils schmerzhaft direkt, allerdings auch ein wenig unaufgeräumt, streckenweise fast redundant larmoyant und sprachlich nicht immer ganz sauber. Hier eine Wortwiederholung, da eine unnötige Langatmigkeit, dort eine kleine Holprigkeit. Dann aber sind da wieder starke, bedrückende Sätze. „Ich war ein selbstunsicheres Geschöpf“ etwa, ganz kurz und schmerzvoll.
Oder schlicht rührende Geschichten wie jene vom Verleger Ernst Brücher (1925–2006), der früh Potenzial im Autor Jürgen Teipel sah und ihm durch selbstlose finanzielle Zuwendungen erst die Arbeit an „Verschwende deine Jugend“ ermöglichte. Ihr letztes gemeinsames Essen vergeigte der Punk-Chronist dann, einer zufälligen Frauenbekanntschaft wegen.
Das esoterisch angehauchte Ende ist versöhnlich, der Weg dorthin quälend. „Aber ich kann fliegen“ ist ein wichtiges Buch – allerdings weniger für die Leserin, den Leser als vielmehr für Jürgen Teipel.