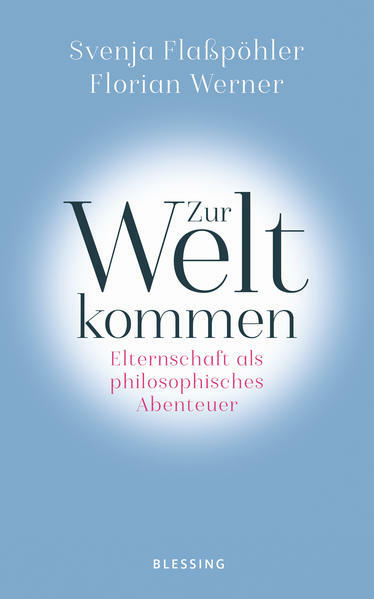Davon gibt es kein Zurück
Kirstin Breitenfellner in FALTER 19/2019 vom 08.05.2019 (S. 46)
Svenja Flaßpöhler und Florian Werner haben eine kritische Hymne auf die Elternschaft verfasst
Kinder sind, obwohl zumeist Früchte der Liebe, auch Diebe, Platzhirsche und Rivalen. Ihr Erscheinen erzeugt das Gegenteil von Planbarkeit, Optimierung, Effizienz und Autonomie, also von dem Leben, das zukünftige Eltern vorher geführt haben. So auch bei Svenja Flaßpöhler und Florian Werner. Die Philosophin und der Literaturwissenschaftler leben in Berlin und gehören zu den Powerpaaren des deutschen Kulturbetriebs.
Flaßpöhler, geboren 1975 und seit 2018 Chefredakteurin des Philosophie Magazins, legte Bücher zu Sterbehilfe und zum Verzeihen vor und landete im Vorjahr mit dem nur 40 Seiten langen Einruf zur #metoo-Debatte „Die potente Frau. Für eine neue Weiblichkeit“ einen Bestseller, der sich gegen die Selbstfestschreibung der weiblichen Opferrolle wandte und für zwei starke Geschlechter plädierte, „die sich in der Fülle begegnen“. Werner, Jahrgang 1971, schreibt erzählende Sachbücher: über Kühe, Schnecken, Schüchternheit oder den „Weg des geringsten Widerstands“.
Mit „Zur Welt kommen. Elternschaft als philosophisches Abenteuer“ legen die beiden ihr erstes gemeinsames Werk vor. Dabei gelingt es ihnen, ganz nahe bei ihren Lebenserfahrungen zu bleiben und diese durch Unterfütterung mit Reflexionen und philosophischer Lektüre auf ein allgemeines Level zu heben. Die 43 kurzen Kapitel mit Titeln wie „Abnabeln“, „Stammbaum“, „Penis“ oder „Kugelmensch“ sind jeweils von einem allein verfasst, dem anderen wird dabei aber stets Einwurf und Widerspruch gestattet, was die Lektüre lebendig macht.
Dabei verstehen sich Flaßpöhler und Werner als Menschen mit „für die Reproduktion in unterschiedlicher Hinsicht bedeutsamen Körpern“. Und natürlich mit unterschiedlichen Charakteren. Gerade diese Differenz macht für sie das Elternsein „so schön – und so kompliziert“. Elternschaft verbindet, aber sie trennt auch gleichzeitig und bietet Anlass zu Auseinandersetzungen.
Elternschaft und Philosophie erweisen sich dabei nicht nur als vereinbar, sondern auch als gegenseitig befruchtend: „Wer ein Kind dabei begleitet, wie es eine rätselhafte Welt entdeckt, dem wird die Welt selbst wieder ein Stück fremd.“ Kinder bieten in diesem Sinne auch den Eltern die Chance für einen Neubeginn. Als Kronzeugin dafür firmiert Hannah Arendt, die den Anfang zum Zentrum ihrer Philosophie gemacht hat.
Vom „Anfang“ der Elternschaft gibt es kein Zurück. Sie produziert Loyalität und Pflichtgefühl, Kontinuität und Lebenslinearität. Und ein Stück Unfreiheit. Aber in ihren Räumen geht es bunt zu. Flaßpöhler und Werner erzählen vom Gynäkologen und vom Kreißsaal, von der Spielplatzbetreuung und vom Babyschwimmen (die weitgehend Werner übernimmt, da Flaßpöhler eine Festanstellung hat).
Sie handeln Themen wie Reue, Warten, Freiheit oder Macht ab und berufen sich dabei auf Kant, Schopenhauer und Nietzsche, Kierkegaard, Bachtin und Badiou – manchmal freilich, um ihnen zu widersprechen. Wie können sich Frau und Mann die Macht teilen? Wie ergänzen sie sich? Kann man es bereuen, Kinder bekommen zu haben? Was bedeutet es, über seinen Tod, aber nicht über seine Geburt bestimmen zu können?
In der Zusammenschau entsteht aus diesen sehr persönlichen, so nachdenklichen wie manchmal komischen Reflexionen und Anekdoten eine Hymne auf die Elternschaft, die mit Georges Bataille als „unproduktive Verausgabung“ definiert wird, die Lust gebiert, indem sie aus der Tatsache, keine Gegengabe zu erwarten, ihre „ekstatische, lebensbejahende Qualität“ gewinnt.
Inspirierend sowohl für Menschen, die Eltern werden wollen, als auch für solche, die es bereits sind.