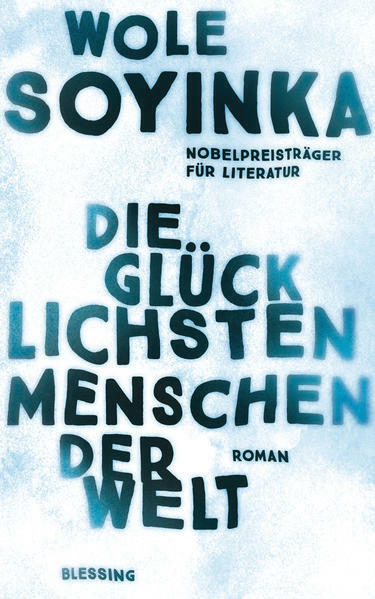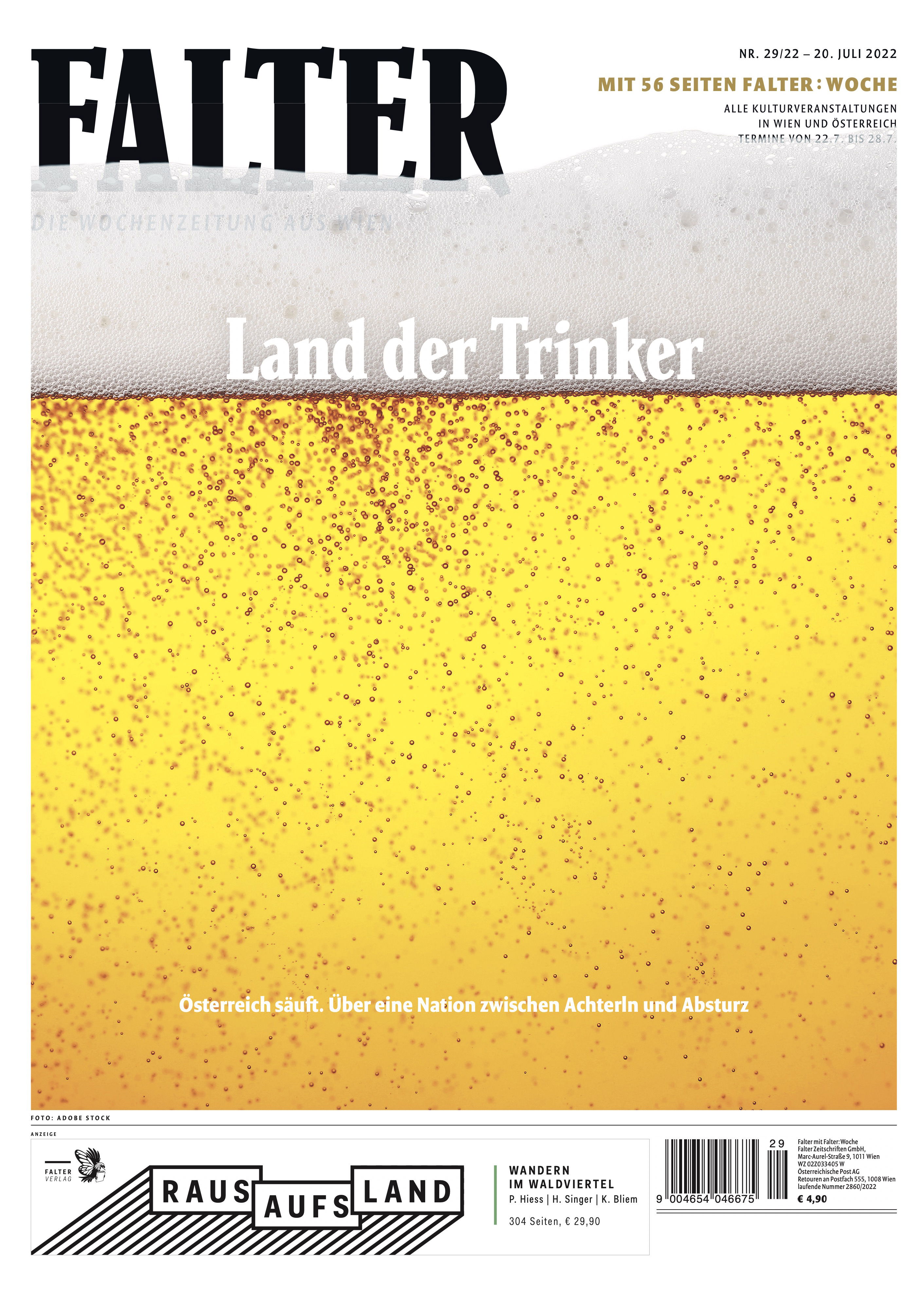
Komplotte, Kannibalismus und Korruption26
Sigrid Löffler in FALTER 29/2022 vom 20.07.2022 (S. 26)
Der Nigerianer Wole Soyinka, Afrikas erster Literaturnobelpreisträger (1986) und soeben 88 Jahre alt geworden, hat im Laufe seines langen Lebens als Dramatiker, Essayist und politischer Aktivist ein äußerst vielseitiges Werk vorgelegt, doch das Romanschreiben war nie sein Hauptgeschäft. Nun veröffentlichte Soyinka seinen ehrgeizigsten und umfangreichsten Roman, den ersten seit fast 50 Jahren.
"Die glücklichsten Menschen der Welt" ist eine Polit-Satire, das Konzentrat seiner lebenslangen Auseinandersetzung mit seinem Herkunftsland. Der Ton des allwissenden Erzählers schwankt zwischen Bitterkeit, Trauer, Ingrimm und Überdruss, durchsetzt mit schwarzem Humor und angeekeltem Zynismus.
Nigeria ist der eigentliche Protagonist. Es geht um Mordanschläge, politische Komplotte und familiäre Intrigen; Brandstiftung, Bestechung und Erpressung. Der Roman liest sich wie ein Kompendium aller Übel, die das Land heute plagen.
Der Staat brüstet sich mit einem Ministerium für Glückseligkeit und damit, dass seine Einwohner die glücklichsten Menschen der Welt seien, während Regierung und Medien das Volk mit sinnfreien, permanenten Jubelfeiern in zyklische Festivalhysterie versetzt, um es vom wahren Elend des Landes abzulenken.
Soyinka beklagt eine Nation, die ihre Seele verloren hat. Seine Empörung gilt generell dem Verlust der Menschlichkeit in einer postkolonialen Gesellschaft, für die er allerdings nicht nur die Barbarei fundamentalistischer Banden wie Boko Haram verantwortlich macht, sondern auch die Ruchlosigkeit und mörderische Gier mächtiger Eliten.
Das moralische Zentrum des Romans bilden ein erfolgreicher Ingenieur und ein angesehener Chirurg, die einander seit ihren Studententagen in England kennen und einen Freundschaftsbund gründen, mit dem idealistischen Ziel, nach Nigeria zurückzukehren um die Heimat voranzubringen. Daran arbeiten sie vorbildlich.
Die beiden kommen einem geheimen Netzwerk nigerianischer Eliten auf die Spur, das bis in die Spitzen der Regierung reicht, hier repräsentiert durch den intriganten und hinterhältigen Premierminister Sir Goddie und den falschen Propheten und religiösen Scharlatan Papa Davina. Die Freunde decken auf, dass sich hinter einer Organisation mit dem zynischen Titel "Management Humaner Primärressourcen" ein lukrativer Schwarzmarkthandel mit menschlichen Körperteilen verbirgt. Das Geschäft boomt, und es fußt auf dem kannibalistischen Aberglauben, dass die Einverleibung menschlicher Organe nicht nur die sexuelle Leistungsfähigkeit steigert, sondern auf magische Weise auch zu Macht, Erfolg, Gesundheit und langem Leben verhilft.
Das ist nicht nur metaphorisch zu verstehen, als krasse satirische Zuspitzung: Soyinka hat sich von Zeitungsmeldungen über grausige Vorfälle von rituellem Kannibalismus in Nigeria inspirieren lassen und übertreibt reale Begebenheiten nur unwesentlich. Überhaupt wimmelt es in dem Roman von Anspielungen auf tatsächliche Korruptionsskandale, auf Anschläge der Terrormiliz Boko Haram, auf kriminelle Machenschaften korrupter Politiker und Heilsprediger oder auf Propagandasendungen im staatlichen Fernsehen. Jeder Nigerianer dürfte die Anspielungen sofort verstehen. Doch wie geht es Außenstehenden mit diesem Roman?
Es geht ihnen vermutlich so ähnlich wie nicht-österreichischen Lesern mit dem Werk Elfriede Jelineks. Beide Nobelpreisträger ähneln einander im Furor ihrer Schreibhaltung, während sie mit lokalen Missständen abrechnen. Man muss nicht jede politische Anspielung entschlüsseln können, um sehr genau zu verstehen, worauf der verzweifelte kritische Impetus dieser Werke zielt.