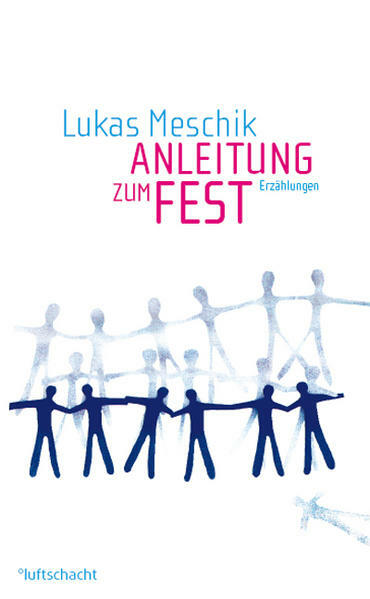Nur wer sich verliert, kann sich auch wieder finden
Alexandra Millner in FALTER 10/2010 vom 10.03.2010 (S. 19)
Die Protagonisten von Lukas Meschik sind jung, wohlhabend, misstrauisch und ständig bereit, sich selbst neu zu entwerfen
Die heile Welt zerstören, um Platz zu haben, eine heile Welt zu bauen." Die vermeintlich heile Welt, die der Wiener Autor Lukas Meschik in seinem zweiten Erzählband "Anleitung zum Fest" heraufbeschwört, ist die nächtliche Stadt: Sorglose junge Menschen tummeln sich in einer dunklen Gegenwelt, in der sie im Schein des Mondes oder der Discokugel mehr Wirklichkeitssinn zu entwickeln vermeinen als im taghellen Alltag. Ihr Hauptinteresse scheint darin zu bestehen, sich in der Begegnung mit dem anderen zu verlieren, in der Hoffnung, sich dadurch wiederfinden zu können. Ihre Erlebnisse sind Verlustanzeigen des Ich: return to sender!
Die Protagonisten sind Getriebene. Sie durchstreifen (halb-)öffentliche Räume und sind auf erotische Abenteuer programmiert, von denen sie sich einen Ausweg aus ihrer Einsamkeit erhoffen. Gezeigt werden Männer beim nächtlichen Herumstreunen, in spätpubertär-homoerotischen Symbiosen, auf Frauensuche in der Diskothek, beim Tagträumen in der Vorlesung, im inneren Zwiegespräch in der U-Bahn; Männer und Frauen in angeregtem
Dialog im Restaurant und in ausgelassener Interaktion auf einem Fest.
Zur Heilung müsse man sich als Mittel "fortgeschrittener Drastik" Verstörungen aussetzen, heißt es bei Meschik, der zwischen der Außen- und Innenwelt seiner Figuren ein Maximum an Spannung entwickelt: Während ihre sparsam gesetzten Handlungen cool und distanziert wirken, sind sie emotional verunsichert und jagen in Gedanken einem Ideal hinterher. Sie sind Romantiker im besten Sinne, intensiv bis metaphysisch in ihrer Wahrnehmung und
poetisch in der Beschreibung – moderne Repräsentanten der progressiven Universalpoesie, welche sich selbst immer weiterschreibt und von der Erfahrung der Entgrenzung in
der Einsamkeit getragen ist.
Dennoch findet der Autor über weite Strecken mit einer elegant-sachlichen Sprache sein Auslangen. Wo er dies allerdings nicht tut, verschwimmen die Grenzen zwischen mutiger Metaphorik und Sprachklischee. Die Bandbreite im Ausdruck findet in Form und Textstruktur ihre Entsprechung: Ein assoziativ dahinmäanderndes Prosalanggedicht über
das Verhältnis von Zeit, Raum und Menschen um vier Uhr früh steht neben literarischen Versuchsanordnungen, in denen jeder Absatz mit "Joe" beginnt oder der Satz "Ich denke an Blau" durchdekliniert wird.
Das Kernstück des Bandes bildet die 70-seitige Liebesgeschichte "Die Kunst des Halbierens", die in der Feinheit der klassischen Dialogführung und existenzialistisch geprägten Parabelhaftigkeit an beste Prosa aus der Nachkriegszeit erinnert. Und das, obwohl Meschiks Protagonisten eindeutig der Wiener Wohlstandsgesellschaft der Nullerjahre zuzuordnen sind. Sie sind intelligent, meist jung und mit vielen Entwicklungsmöglichkeiten ausgestattet. Zugleich misstrauen sie der heilen Oberfläche ihrer Welt, fürchten, in ihrer Bequemlichkeit eingelullt zu werden und halten an der Bereitschaft fest, sich jederzeit selbst neu zu entwerfen.
Das ist zum einen verunsichernd – und der Autor spart dabei nicht mit drastischen Beispielen –, zum anderen liegt genau darin die Kraft, die die Figuren in Bewegung hält, das Movens ihrer Lebenslust. Damit weiß Meschik die dunkle Grundstimmung seiner Prosa ins Positive zu wenden, was vielleicht auch die stoische Ruhe erklärt, mit dem seine Erzähler sowohl Eros als auch Thanatos begegnen. Sie finden dafür zwar keine kalten, sehr wohl aber sachliche, nüchterne Beschreibungen, denen – vor allem dann, wenn es um Erotik geht – beinahe etwas Technokratisches anhaftet.
Ihr Halt ist die erstaunliche Sicherheit im sprachlichen Ausdruck, die der junge Autor an den Tag legt. Damit schließt er an sein beeindruckendes literarisches Debüt, den Weltuntergangsroman "Jetzt die Sirenen" (2009), an und macht neugierig auf weitere Übungen in Sachen literarischer Verstörung.