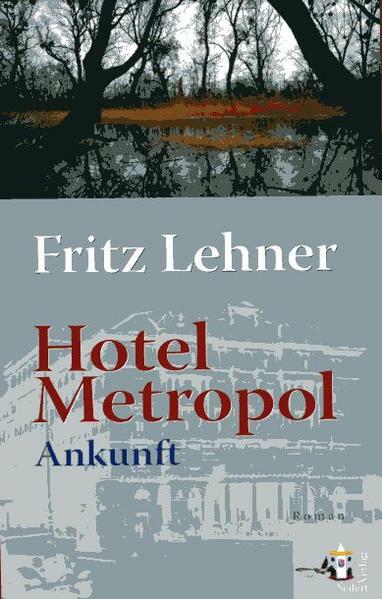„New York war noch einprägsamer als der Hauptplatz von Freistadt“
Michael Omasta in FALTER 34/2017 vom 23.08.2017 (S. 28)
Wie ein Bub aus dem Mühlviertel zum Film kam. Regisseur Fritz Lehner über Herzensbildung, räumliche Geräusche und den Bus, der den Hund überfahren hat
Fritz Lehner sagt, er habe sich nie von der Muse küssen lassen. Stattdessen arbeite er nach strengen Ritualen, hochkonzentriert, ununterbrochen: heute als Romancier, früher als Drehbuchautor und Regisseur. Sein filmisches Werk ist vergleichsweise schmal. Er hat 13 Filme gedreht, darunter den TV-Dreiteiler „Das Dorf an der Grenze“, die Schubert-Trilogie „Mit meinen heißen Tränen“ und die Geschichte eines Knechts, „Schöne Tage“, nach Franz Innerhofer – jeder Film ein Ereignis.
Nach der Produktion von „Jedermanns Fest“ mit Klaus Maria Brandauer, die für über zwei Jahre unterbrochen wurde und 2002 ins Kino kam, veröffentlichte Lehner seinen ersten Roman, „R“, über eine österreichisch-ungarische Nordpol-Expedition. Das Gespräch über seinen ersten Film indes fand an einem brütend heißen Nachmittag im wenig frequentierten Café Rathaus statt.
Falter: Herr Lehner, welchen Ihrer Filme lassen Sie als Ihr Opus 1 gelten?
Fritz Lehner: Ich würde sagen „Der große Horizont“ nach dem gleichnamigen Roman von Gerhard Roth. Dieser einstündige Film, 1975 in New York gedreht, war mein erster Auftrag in der Branche, wie’s so schön heißt. Die fünf oder sechs kurzen Spielfilme und Dokumentationen, die ich davor an der Filmakademie gemacht habe, entstanden ja unter Ausschluss der Öffentlichkeit und waren auch nie für sie gedacht.
Roths Roman endet mehr oder weniger, wo Ihr Film beginnt.
Lehner: Wir haben nicht den ganzen Roman verfilmt, sondern nur ungefähr ein Viertel, mit einem ganz anderen Beginn, aber mit der gleichen Voraussetzung: dem psychotischen Angstverhalten eines Buchhändlers aus Wien, der glaubt, dass man ihn wegen Mordes sucht – weil eine Frau, mit der er bei einem Zwischenstopp zwischen zwei Flügen eine Nacht verbracht hat, am nächsten Morgen tot ist.
Das klingt nach einem Krimi, aber ist „Der große Horizont“ wirklich einer?
Lehner: Natürlich ist die Geschichte kein konventioneller Krimi. Die 1970er waren ja eher die Zeit des Anti-Krimis, also nur nicht zu viel Spannung – siehe Wim Wenders usw. – und schon gar nicht Action! Das hat alles mitgespielt, war aber auch schon bei Gerhard Roth so angelegt ... Jedenfalls danke ich dem Autor sehr, dass er den Buchhändler nach New York geschickt hat, um sich selbst zu finden!
Machen wir einen Schritt zurück nach Wien, an die Filmakademie. Wie haben Sie das Arbeiten unter Laborbedingungen erlebt?
Lehner: Ich habe 1970 mit der Filmakademie begonnen. Das für mich Entscheidende war, dass ich dort praktisch arbeiten konnte. Ich komme aus Freistadt, einer mittelalterlichen Stadt im Mühlviertel, und kannte niemanden, der etwas mit Film zu tun hatte und bei dem ich eventuell als Regieassistent hätte anfangen können. Während des Studiums habe ich ununterbrochen gearbeitet: Drehbücher geschrieben, Filme gedreht, zum Teil selbst Kamera gemacht, und bis auf ein oder zwei habe ich sie auch alle selbst geschnitten. Sogar in den Ferien habe ich geschaut, dass ich hineinkomme und an einem Schneidetisch arbeiten kann.
Sie meinten einmal, dass Sie an der Filmakademie „von sehr vielen nichts, von wenigen aber sehr viel gelernt“ hätten. Von wem?
Lehner: Das waren zwei, drei Professoren, allen voran Drehbuchautor Harald Zusanek; dann Robert Schöfer, Kameraprofessor. Schließlich noch Alfons Stummer, der damals auch heftig bekämpft wurde und mir wenig für das Filmen beibringen konnte, aber hochinteressante philosophische Gespräche mit mir führte. Auch wenn das jetzt komisch klingt, am meisten habe ich durch mich selbst gelernt: durch die praktische Arbeit und die Reaktionen der Studienkollegen, ob es Zustimmung gab oder Eifersucht – das war das größte Kompliment. Mir hat die Filmakademie in vielerlei Hinsicht den Zugang eröffnet, und am allermeisten dadurch, dass ich danach ein paar Gesellenarbeiten hatte, die ich herzeigen konnte: „Züge“ zum Beispiel, meinen ersten Kurzfilm, oder „Hanna und Valentino“, meinen Diplomfilm mit Johanna Tomek und Klaus Wildbolz.
Haben Sie schon als Kind gewusst, dass Sie Filme machen wollen?
Lehner: Ich muss vorausschicken, dass es in meiner Jugendzeit nicht einmal mehr ein Kino gab in Freistadt – anders als heute mit der Local-Bühne, dem Sommerkino und dem sensationellen Heimatfilmfestival. Um Filme zu sehen, musste ich mit Freunden nach Linz fahren. Ich habe aber schon während meiner Jahre am Freistädter Gymnasium großes Interesse gehabt für Fotografie, für Film und für Theater. Mit 16 wusste ich: Es ist Film, weil er mit Technik verbunden ist und so viele Möglichkeiten der Gestaltung bietet.
Sie haben später einen Essayfilm über Freistadt gedreht und es als Schauplatz in einem Roman verwendet. Können Sie etwas über Ihr familiäres Umfeld erzählen?
Lehner: Mein Vater war ein kleiner Beamter, meine Mutter Hausfrau. Beide stammten aus der Umgebung und kamen aus einfachsten Verhältnissen. 1946 sind sie nach Freistadt gezogen und mein Vater hat eine Stelle als Hausbesorger bei der Bezirkshauptmannschaft bekommen. Das Gebäude diente zugleich dem Bezirksgericht, und das war am Hauptplatz, der ein Joch groß ist, der größte Hauptplatz in Österreich. Dort, hinter 1,40 Meter dicken Mauern, bin ich geboren worden und aufgewachsen, ebenerdig. Ich habe zwei Fenster auf den Platz gehabt, das war meine Schule für Film: mit Autobussen, die Hunde überfahren haben, mit Leuten, mit Fuhrwerken – alles in Cinemascope!
Wurden Ihre künstlerischen Ambitionen daheim gefördert?
Lehner: Ich bin sehr behütet aufgewachsen, aber ohne dass ich mich dadurch eingeschränkt gefühlt hätte. Von den Eltern habe ich weder Literatur- noch Filmbildung bekommen, sondern ihnen verdanke ich meine Herzensbildung. Das hat mir mehr geholfen als alles andere. Damit meine ich nicht „Der gute Mensch“ oder so, sondern die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen. Das hilft mir bis heute beim Schreiben, denn ich bemühe mich, an jeder negativen Figur auch irgendetwas zu entdecken, das sie positiv erscheinen lässt, den Lesern oder Zuschauern zugänglich macht.
Vermutlich hatten Sie als Kind noch keine Kamera, oder?
Lehner: Natürlich nicht. Ich habe mir mit Hörspielen beholfen. Vom Vater bekam ich ein Tonbandgerät geschenkt, eine Revox A77 mit Band und Spulen – damals sagte man Schnürsenkel dazu –, und habe mit den Freunden und Schulkollegen ein Hörspiel nach dem anderen gemacht: Heinrich Böll, Alfred Andersch, Wolfgang Weyrauch, Ilse Aichinger, Wolfgang Borchert ...
War das Schullektüre oder wie haben Sie sich das angeeignet?
Lehner: Nein, nein, in der Stadtbibliothek in Linz, dort habe ich mir die entsprechenden Bücher besorgt. Ganz wichtig war die Zeitschrift Theater heute. Ich war ständig auf der Suche nach Hörspielstoffen und habe in der Stadt auch immer Geräusche aufgenommen. Das war die Basis dafür, etwas mit meinen Mitschülern machen zu können, wofür sich sonst in Freistadt niemand interessiert hat. Die Schriftstellerin Brigitte Schwaiger und ich sind in dieselbe Klasse gegangen; mit 16, 17 sind wir sehr oft per Stopp nach Linz gefahren, um ins Lifka oder ein anderes Kino zu gehen. Sie hat dann auch bei den Hörspielen mitgemacht.
Was hat Sie daran so gereizt?
Lehner: Ich halte das Hörspiel immer noch für eine hohe Kunstform. Für mich damals war das Spannende, dass das geschriebene Wort zu Räumen wurde, zu Schauplätzen. Mit zwei, drei Freunden, die die Texte gesprochen haben, konnte ich in meinem Zimmer ganze Welten herstellen. Einmal habe ich ein Hörspiel gemacht, das in Amerika spielt, ich glaube in Los Angeles, da sind mir die Geräusche ausgegangen.
Hat sich das später auf Ihre Filmarbeit ausgewirkt?
Lehner: Das Schneiden der Tonbänder war eine Vorstufe zum Schneiden der Filme. Und ich habe gelernt, mich auf den Ton zu konzentrieren und habe ihn in meinen Filmen immer sehr genau behandelt. Der Nachteil dieses jahrelangen Trainings in Bezug auf Hören und Geräuschedifferenzieren ist, dass ich heute wahnsinnig geräuschempfindlich bin und alles höre. Ich brauche Ohropax zum Schreiben und auch zum Schlafen.
Von Freistadt an die Filmakademie ist es ein großer Sprung, von dort nach New York ein noch größerer. Wie sind Sie zum „Großen Horizont“ gekommen?
Lehner: Mich hat kein Talentscout gesucht, wenn Sie das meinen. „Der große Horizont“ war ein Projekt des ORF, wo man damals – Intendant: Gerd Bacher, Fernsehspielchef: Gerald Szyszkowitz – sehr darauf erpicht war, international zu werden: der ORF in New York, eine Sensation! Die erste Idee war, dass Gerhard Roth an verschiedenen Orten aus seinem Roman lesen sollte. Das hat dann aber doch nicht so überzeugt. Dann hat Rudolf Jusits, der schließlich die Hauptrolle spielte und mit dem ich zuvor einen Film über einen Schizophrenen („Roman Plavits. Darstellung einer Selbstzerstörung“, Anm.) gemacht hatte, dem zuständigen Redakteur meinen Namen genannt. Das war Hans Preiner, ein ungemein engagierter Mann, der immer Neues gesucht und Experimente gewagt hat. Der hat sich meine Akademiefilme zeigen lassen, die haben ihm gefallen, und damit erhielt ich den Auftrag.
Klingt alles sehr unkompliziert.
Lehner: Das war’s auch. Es hat sich eines nach dem anderen ergeben. Im Mai 1975 habe ich die Diplomprüfung gemacht, dann schnell das Drehbuch geschrieben, und ein paar Wochen später war ich in New York. Natürlich kam zu den Voraussetzungen, die ich mir geschaffen habe, auch Glück dazu. Es war die Blüte des österreichischen Fernsehfilms, mit 20 oder mehr Literaturverfilmungen im Jahr. Heute unvorstellbar!
Sie haben sich New York so einfach zugetraut?
Lehner: Ich habe keine Zweifel gehabt. Die einzige Sorge waren meine Englischkenntnisse, als Mühlviertler hatte ich damit schon in der Schule ein bissl Schwierigkeiten.
„Der große Horizont“ wirkt wie die Antithese zu Ihrem kammerspielhaften Diplomfilm: ein sehr beweglicher, in Farbe und on location gedrehter Film.
Lehner: Es war eine vollkommen andere Situation. Das Budget: 40.000 Euro inklusive Reisen und Hotel, Drehzeit: elf Tage. Wir hatten keine Bauten, kein Kostüm, keine Maske, nichts, aber wir hatten New York. Das Team bestand aus nur sieben Leuten, die meisten waren von dort, so auch der Kameramann Bob Fiore, der u.a. bei „Gimme Shelter“ mit den Rolling Stones dabei war. Seine Bilder hatten eine Dynamik, die ich noch nicht kannte. Er hat mit einer Reportagekamera gedreht, einer Eclair 16, deren Griff ungeheure Wendigkeit ermöglichte. Wenn man eine Filmkamera hält, genügt ja eine kleine Handbewegung und der Kinosaal gerät ins Schwanken.
Das New York im Film ist noch kein Touristenmekka. Wo haben Sie gedreht?
Lehner: Ich weiß nicht mehr die Namen aller Schauplätze, ist ja auch schon 42 Jahre her, aber der Dreh in der Nähe von Harlem ist mir noch in Erinnerung: Das wichtigste Gerät war nicht die Kamera, sondern ein Teil des Stativs, der Schwenkhebel – zum Schwenken der Kamera natürlich, aber auch zur Verteidigung!
Einmal beobachtet die Hauptfigur, wie ein Mann auf der Straße zusammenbricht. Wie haben Sie das gedreht?
Lehner: Mit versteckter Kamera, aus einem Lieferwagen heraus. Die Polizei ist informiert gewesen, dass ein Schauspieler einen epileptischen Anfall simulieren wird – wie reagieren die Passanten? Bei der ersten und zweiten Aufnahme reagierten die Leute kaum, die gingen einfach vorbei. Bei der dritten ist eine Frau stehengeblieben, hat sich hinuntergebeugt, aus ihrer Handtasche einen Teelöffel geholt und damit die Zunge des Schauspielers nach unten gedrückt. Das war schrecklich, hat er nachher gesagt, ihre Hilfe hätte ihn fast umgebracht – aber das ist die Aufnahme, die im Film ist.
Das sind Sachen, die in keinem Drehbuch stehen!
Lehner: Das ist auch das Reizvolle. Ich habe dann noch zwei, drei Tage weitergedreht, nur mit dem Produktionsleiter aus Wien, der auch zweite Kamera gemacht hat. Wir sind im Taxi herumgefahren, haben hinausgefilmt und ein paar ganz tolle Momente erwischt: Pferde auf einem Polizeiparkplatz, Graffiti, die damals gerade im Kommen waren, und einen Obdachlosen, der ein Lied von der Liebe und vom Glück singt.
Das Lied wird quasi zum Leitmotiv, und je länger die Geschichte dauert, umso mehr nehmen die Straßenszenen überhand. Der Film öffnet sich der Stadt.
Lehner: Wir haben den Gesang am Schneidetisch mit einem langen Panoramaschwenk verbunden, 360 Grad, über die Dächer mit ihren charakteristischen Wassertürmen. Ich hoffe, es ist nicht zu viel Folklore geworden, aber ich wollte dem ORF zuliebe auch etwas nach Hause bringen. New York war für mich ununterbrochen Film. Ich habe das genossen, habe den Geruch aufgesogen, die Dynamik der Stadt, und wollte nur noch schauen. New York war noch einprägsamer als der Hauptplatz von Freistadt.
Abgesehen von Rudolf Jusits wirken noch einige interessante Schauspieler mit, die heute kaum mehr in Erinnerung sind, Linda Geiser beispielsweise.
Lehner: Eine Schweizerin, die u.a. schon in „The Pawnbroker“ von Sidney Lumet eine kleine Rolle hatte. Den Polizeifotograf spielte ein New Yorker Schauspieler, die Frau, die stirbt, Angela Aschauer, eine Österreicherin, die in New York gelebt hat. Frank Hoffmann, der dann die Kinosendung „Trailer“ moderiert hat, sprach den Off-Text.
Waren das damals bekannte Gesichter?
Lehner: Nein. Ich wollte in meinen Filmen nie bekannte Gesichter nochmals sehen. Schon gar nicht solche, die durch eine Serie geprägt waren, weil der Zuschauer dann immer Schwierigkeiten hat, nicht zuallererst an die Serienfigur zu denken. Ich habe mich auch nie auf Casting-Büros verlassen, sondern selbst nach der richtigen Besetzung gesucht. Oft monatelang. Bei der Schubert-Trilogie „Mit meinen heißen Tränen“ habe ich Udo Samel nach einem Jahr Suche an der Schaubühne Berlin gefunden und war glückselig: Das ist er! Dann hat ihn Peter Stein nicht für die Dreharbeiten freigegeben. Ich habe den Film um ein Jahr verschoben, das hat Udo Samel sehr geschätzt.
Gab es keinen Plan B?
Lehner: Er war die einzige mögliche und richtige Besetzung. Es gab keine Alternative, nur etwas ganz anderes, was auch interessant gewesen wäre: Joe Cocker.
Wäre das realistisch gewesen?
Lehner: Weiß ich nicht, aber ich habe auch Juliette Gréco bekommen für „Jedermanns Fest“. Ich habe Dorothea Neff bekommen für die Schubert-Trilogie, obwohl sie schon blind war und gesagt hat, sie spielt nie wieder. Ich glaube, wenn die Rolle interessant genug ist, bekommt man fast jeden. Bei meinen Filmen habe ich da wirklich immer Glück gehabt. Ich mochte alle meine Schauspieler und mag sie nach wie vor.
Sie haben Ihren letzten Film vor 15 Jahren gemacht. Verfolgen Sie, was aktuell im Kino passiert?
Lehner: Ja, von zu Hause aus.
Seither haben Sie acht Romane veröffentlicht, ein neunter erscheint im Herbst. Wie sieht Ihr Arbeitsalltag heute aus?
Lehner: Der neue Roman heißt „Nitro“ und spielt am Donaukanal. Insgesamt habe ich neun Monate daran gearbeitet, das sind immer so Schwangerschaften, wenn’s ein Buch mit rund 300 Seiten ist. Fünf Monate Vorbereitung mit Fotoapparat, mit Videoaufnahmen, mit Leuten sprechen, in der Nationalbibliothek recherchieren, um Idee und Ablauf der Geschichte zu finden und Charaktere zu entwickeln. Danach beginnt das Schreiben, das in diesem Fall vier Monate gedauert hat, 100 Schreibtage und rund 20 Korrekturtage. Während der Zeit arbeite ich wirklich ununterbrochen. Mein tägliches Pensum sind 6000 Zeichen, Reinschrift, Endfassung. Jeden Tag, egal, ob Weihnachten oder Neujahr ist, ob ich Grippe habe oder einen Wasserrohrbruch. Ich mag dieses intensive Arbeiten, ich will etwas fertigmachen und dann ein paar Monate frei haben. Miles Davis ist mir da ein Vorbild, der ist auf die Bühne, ohne langes Herumreden, hat gespielt, weg.
Der größte Unterschied zu früher?
Lehner: Statt 25 Filmbilder in der Sekunde 26 Buchstaben auf Papier, mit beiden kann man unendlich viel erzählen. Manchmal vermisse ich das Team bei einem Film, aber mit der Einsamkeit des Schreibens bin ich immer sehr gut zurechtgekommen.
In dieser Rezension ebenfalls besprochen: