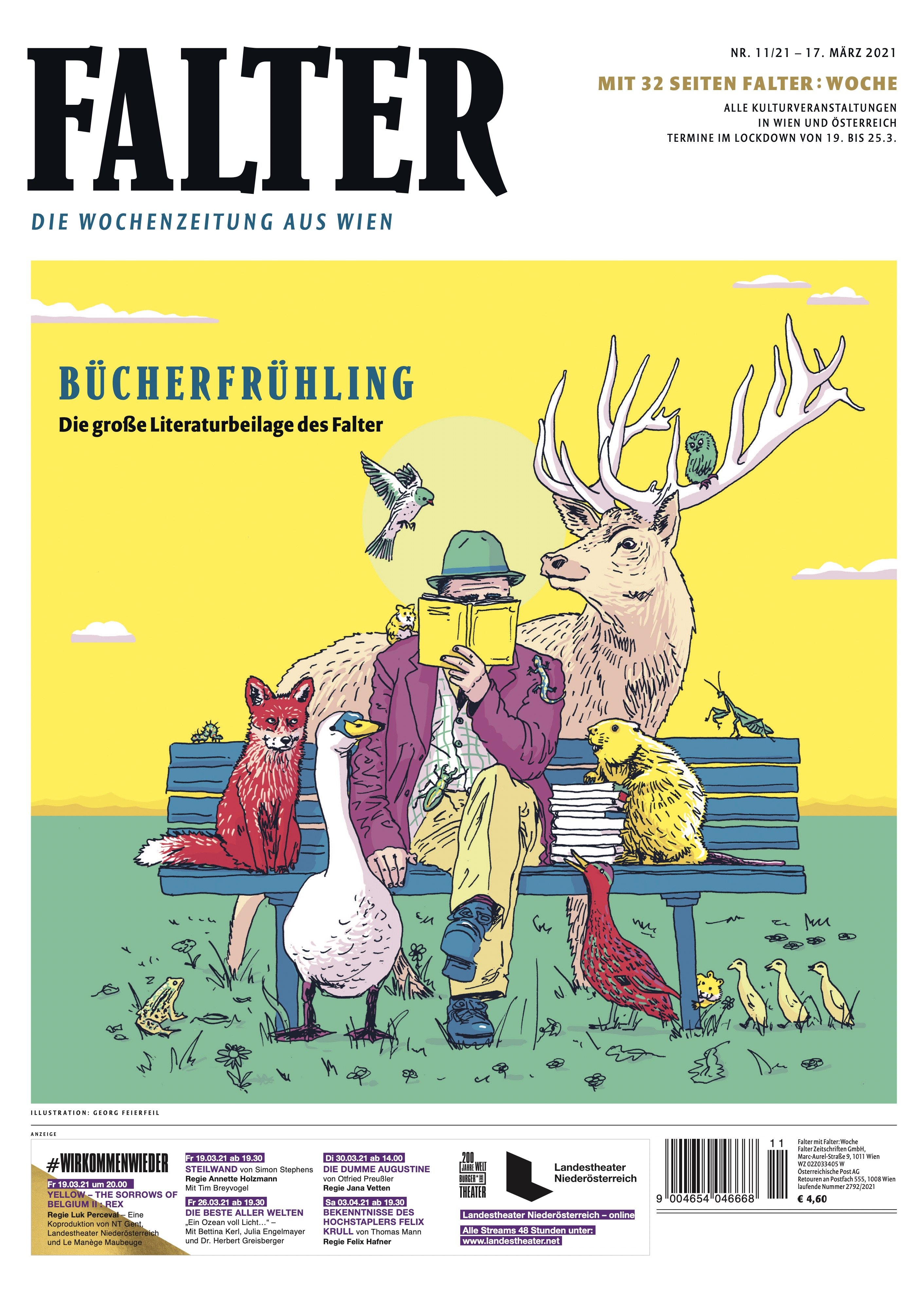
Väter und Söhne
Karl Wagner in FALTER 11/2021 vom 17.03.2021 (S. 16)
Der Bregenzerwälder Bauer und Schriftsteller Franz Michael Felder (1839–1869) hat seinen Roman „Sonderlinge“ vermutlich 1862 begonnen, im Mai 1866 abgeschlossen und 1867 im angesehenen Verlag Salomon Hirzel veröffentlicht. Erst 1912 und dann wieder 1976 erfolgten Neuausgaben. Aber Felders Roman wird nicht Roman genannt und sein Erstling, die Dorfgeschichte „Nümmamüllers und das Schwoazakaspale“ von 1863, nicht Dorfgeschichte, seit dem Erscheinen der ersten „Schwarzwälder Dorfgeschichten“ von Berthold Auerbach (ab 1843) eine europaweit erfolgreiche Gattung des Realismus. Felder nennt sie „Ein Lebensbild aus dem Bregenzerwalde“ und die „Sonderlinge“ „Bregenzerwälder Lebens- und Charakterbilder aus neuester Zeit“.
Diese Gattungsbezeichnungen sind zeitgenössisch weit verbreitet. Ähnlich wie „Genrebild“ oder „Sittengemälde“ signalisieren sie kulturgeschichtlichen Empirismus, ethnografischen Verismus nicht zuletzt durch die räumliche und geografische Eingrenzung. Neben dem damals noch aufrechten Vorbehalt gegen den Roman als lügenhafte Liebesgeschichte verweist der Plural „Lebens- und Charakterbilder“ zudem auf den Zusammenhang von kleiner Prosaform und Großepik, was mit den medialen Verwertungsmöglichkeiten und der oft additiven Struktur der Romankomposition zu tun hat. Das Bauprinzip des Mosaiks zielt nicht auf die Lebensgeschichten eines Individuums, sondern auf die Darstellung eines Figurenkollektivs und der Wechselfälle seines Alltagslebens.
Die „Sonderlinge“ beginnen mit einem Gruppenbild der Bauern auf dem Kirchenplatz. Die schon lang anhaltenden Regenfälle, Zeichen der gestörten Natur und der bedrohten bäuerlichen Arbeit, haben die Dorfleute veranlasst, sich in der Kirche zum gemeinsamen Beten um schönes Wetter zu versammeln. Die Szene auf dem Kirchenplatz führt in Nah- und Distanzaufnahmen, alle Personen des Romans vor, zeigt, wie die Einzelnen sprechen und vor allem auch, wie über den anderen jeweils gesprochen wird. Die Grundzüge des bäuerlichen Charakters – Schlauheit und Naivität, Gesprächigkeit und Schweigsamkeit, Frömmigkeit und Zerfallensein mit Gott und der Welt – werden sichtbar. In dieser Szenerie heben sich allmählich zwei Hauptpersonen ab, deren Gegensätzlichkeit den Fortgang der sparsamen Handlung bestimmt.
Es spricht für Felders Sozialroman, dass er dieses Gegensatzpaar nicht mit einer starren Schwarz-Weiß-Optik fixiert und karikiert. Es gibt zwar eine gewisse Präferenz für Sepp, den streng rationalen, autodidaktischen Volksaufklärer, der im Dorf als „Freimaurer“ verschrien ist. Er ist auch nicht in der Kirche gewesen; sein Leben ist bestimmt durch Lektüre – hervorgehoben wird die Erzählung „Das Goldmacherdorf“ (1817) von Heinrich Zschokke, einem Kämpfer für Volksbildung in der Schweiz. Vorurteilskritik und tätiges Erbarmen zeichnen ihn aus. Trotz solcher Eigenschaften ist Sepp nicht gegen Verhärtung und überhebliche Misanthropie gefeit, die in Menschenverachtung umschlagen kann.
Umgekehrt wird der frömmlerische, selbstgerechte und streng autoritäre Barthle nicht zu einer bigotten Verkörperung der Gegenaufklärung vereinfacht, wenngleich sein Verhalten gegenüber seinem Sohn, den er unter falschem Verdacht verstößt und in die Fremde treibt, deutlich zeigt, wie viel Erziehung diesem Erzieher fehlt. Auch Sepp gelangt mit der Art und Weise, in der er seinen einzigen Sohn Franz behandelt, deutlich an seine Grenzen.
Der Roman, der so stark auf den familiären Zusammenhang als Modell praktischer Weltveränderung setzt, hat seine Stärke darin, dass er die Schwäche der Patriarchen sichtbar macht, indem sich die Kinder ihnen entziehen. Es ist die Liebesgeschichte zwischen Marianne, der Tochter des verwitweten Barthle, und Franz, die schließlich auch die Väter versöhnt.
Es spricht für Felders sozialen Takt, dass dieser Romanschluss durch eine Naturkatastrophe, in Entsprechung zum Anfang, ermöglicht wird. Die Naturkatastrophe ist aber von Menschen verursacht worden: Sepp hat in selbstsüchtigem Nützlichkeitsdenken den Wald abgeholzt, der früher Schutz vor Lawinen bot; er wäre nun beinahe von der Lawine verschüttet worden, die indes durch einen Schuss seines Gegenspielers ausgelöst wurde.
Diesem handlungsstarken Ende korrespondiert über weite Strecken ein Übergewicht der besprochenen Welt. Es ist geprägt von einem Sprach- und Sprechhandeln, das Dissens und Vorurteile verhandelt, aber auch durch ein aggressives Mobbing, das durch die Kanzelreden eines fanatischen Predigers ausgelöst wird.
Zu diesem Sprechen über Sprache, das im Guten wie im Bösen Handeln auslösen kann, passt ein flexibler Gebrauch der Erzählperspektive. Sie legt, dramaturgisch reizvoll, auch nicht Ausgesprochenes frei, was nicht minder ins Elend führen kann. In längeren „Kopfmonologen“, gegeneinander versetzt, werden Prozesse der Täuschung oder aber auch der Selbsteinsicht dem Leser mitgeteilt. Die öffentliche Meinung ist ein Leitthema dieses Romans, sie reicht von der hetzerischen Rede bis zu den Sprichwörtern, von der Prägnanz des Dialektworts bis zum beharrenden Tratsch und dem hetzerischen Gerücht.
Es ist ein gar nicht hoch genug einzuschätzendes Verdienst des Felder-Archivs und des Felder-Vereins, dass Franz Michael Felders Werke in neuer Gestalt, kundig kommentiert und umsichtig präsentiert, zugänglich sind. Dazu kommen die online verfügbaren Briefe – insgesamt ein Meilenstein regionaler Literaturforschung und aufgeklärter Kulturpolitik.



