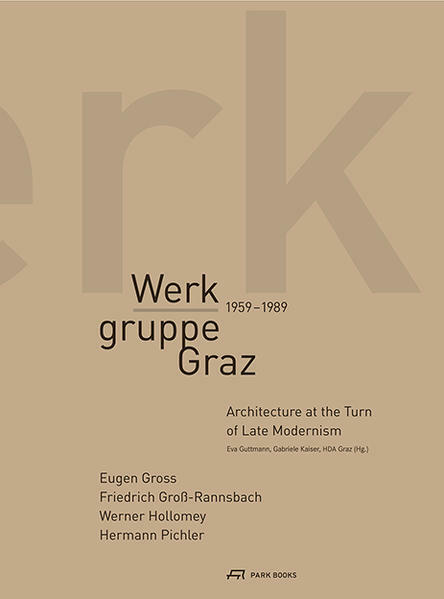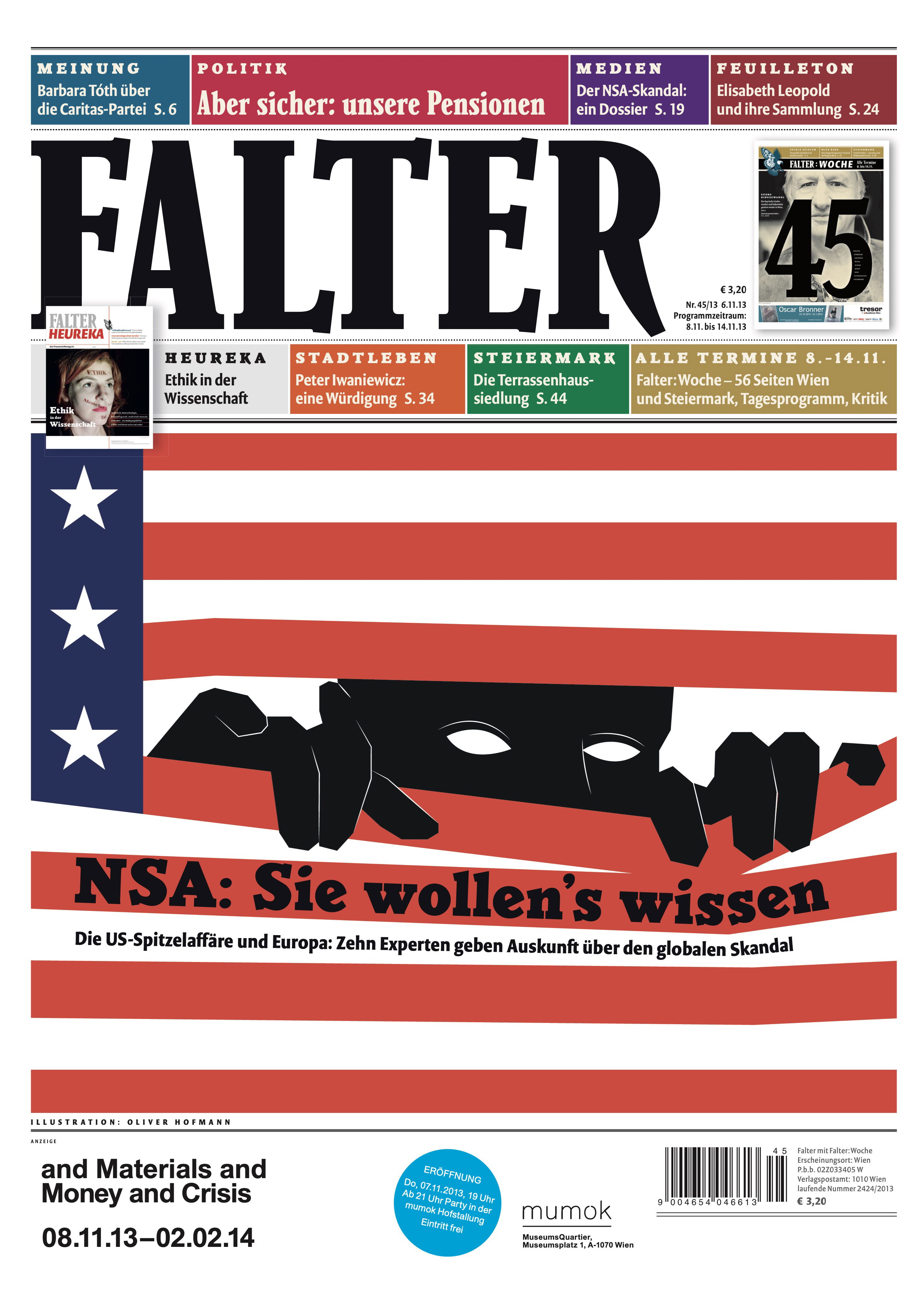
Auf den Trümmern des Zweiten Weltkriegs
Tiz Schaffer in FALTER 45/2013 vom 06.11.2013 (S. 44)
Eine Monografie und eine Ausstellung würdigen das architektonische uvre der Werkgruppe Graz. Die 35 Jahre alte Terrassenhaussiedlung in St. Peter ist ein kleines Dorf und unumstritten ihre Großtat
Wir waren schon auch übermütig und haben uns gedacht: Na ja, warum nicht? Trauen wir uns einfach drüber!", erinnert sich Eugen Gross. Der Falter trifft den Architekten an einem regnerischen Nachmittag vor dem sogenannten Terrassenhauszentrum, dem Bewohnerzentrum, das etwa für Gymnastikkurse oder Diskussionsveranstaltungen genutzt wird. Untergebracht sind die Räumlichkeiten im Erdgeschoß eines der vier imposanten Wohnblöcke, welche die Siedlung, durchlässig aber doch, abstecken. Die Terrassenhaussiedlung war zu ihrer Zeit ein mehr als gewagtes städtebauliches Großprojekt. Sie wurde in den Jahren 1972 bis 1978 erbaut, bis heute ist hierzulande nichts Vergleichbares mehr nachgekommen.
Sie war das wichtigste Projekt der Werkgruppe Graz, auch wenn das Studentenwohnheim Hafnerriegel oder das Studentenhaus mit Mensa in der Leechgasse ebenso allgemein bekannt sind. Die Werkgruppe war ein Architektenquartett, neben Gross setzte es sich aus Friedrich Groß-Rannsbach, Werner Hollomey und Hermann Pichler zusammen. Ihren 80. Geburtstag haben die Herren heute schon alle hinter sich. Genau 30 Jahre lang haben sie gemeinsam gearbeitet, bevor sie 1989 in Freundschaft, wie Gross betont, auseinandergingen. Sie waren, so halten die Herausgeberinnen Eva Guttmann und Gabriele Kaiser im Vorwort zur eben erschienenen, bislang ersten Werkgruppe-Monografie fest, nicht nur Stadt- und Raumdenker, sondern auch Bauende und Lehrende, nicht zuletzt Kulturschaffende. So ist es keine Selbstverständlichkeit, dass ein Architekturbüro über viele Jahre hinweg auch Lyrikbände herausgibt. "Wir waren die ersten", sagte Eugen Gross bei der Eröffnung der Werkgruppe-Ausstellung im Haus der Architektur (HDA), "die Gedichte von Alfred Kolleritsch publiziert haben." Und er freute sich, dass die Monografie, zusammengehalten von einem schlichten Kartondeckel, stilistisch an die "braunen Büchl" der Lyrik-Edition anknüpft. Sieben der Bände wurden dieser Tage bei der Edition Keiper neu aufgelegt.
Und so wie Architekten gemeinhin keine Lyrik veröffentlichen, findet man in Literaturzeitschriften wohl selten Ausführungen zum Städtebau. 1971, als noch ein Jahr bis zum Baubeginn der Terrassenhaussiedlung hin war, sie allerdings längst schon in ihrer Planungsphase war, bestimmte die Werkgruppe in der Literaturzeitschrift manuskripte ihre Position. Der "herkömmliche Städtebau" habe "den Zerfall des kommunalen Zusammenlebens durch die ökonomisch orientierte Gliederung in ausschließlich Arbeits-, Schlaf- und Konsumzonen beschleunigt." Das ambitionierte Konzept der Siedlung sah nicht nur vor, diese Bereiche zusammenzuführen, sondern auch die Basis für ein starkes Gemeinschaftsgefüge zu legen – urban in der Dichte, gleichzeitig aber, in seiner weitgehenden Autonomie, auch dörflich. Die Wohnungs- und Dachterrassen, die unmittelbare Nähe zur Natur, die gemeinschaftlichen Grünflächen – heute gibt es auch einen kleinen Gemüsegarten für Kinder –, die riesigen Blumentröge, aus denen kleine Bäume gewachsen sind, die "Kommunikationsebene" im vierten Geschoß, die die Begegnung der Bewohner fördern sollte, die Arztpraxen oder eben das Bewohnerzentrum – das alles sollte Menschen davon abhalten, sich am Stadtrand ein Haus zu bauen. Denn das Thema "Zersiedlung" war damals schon am Tisch. Darüber hinaus waren ursprünglich auch ein kleines Einkaufszentrum und ein Hotel garni geplant. Doch die großen Handelsketten erkannten natürlich die Kaufkraft der Siedlung – in über 500 Wohnungen sollten mehr als 2000 Menschen einziehen. Und sie stellten nach Baubeginn an der angrenzenden Plüddemanngasse ihre Supermärkte hin; der Bauherr des kleinen Einkaufszentrums sprang ab.
Ein städtebauliches Fanal ist die Siedlung auch so. Bei ihr kommt der renommierte Wiener Architekturpublizist Otto Kapfinger, der der Monografie auch einen Text beisteuerte, geradezu ins Schwärmen. Es sei die "weitaus beste große Wohnanlage dieser Quantität und dieser Dichte in Graz, in Österreich", zudem lobt Kapfinger die "wunderbar klar gestalteten Freiräume zwischen den Häusern". Auch die "Transparenz" des Wohnbaus hat es ihm angetan: "Diese große, mächtige Anlage ist so durchlässig, längs und quer, so elastisch von unten bis oben, man kann von außen überall durchgehen und immer bis vor die Wohnungstüren gehen – in Wien bei einer Wohnanlage heute vollkommen unmöglich." Vor allem gebe es "diese erstaunliche Balance zwischen dem sehr Individuellen und dem sehr Kollektiven". Die Siedlung lässt also Anonymität zu, zugleich könne das Bedürfnis nach Gemeinschaft gestillt werden.
Nachdem die Werkgruppe 1965 die Planung begann, sollten noch sieben Jahre bis zum Baubeginn 1972 verstreichen. Das Projekt musste durch viele Kommissionen und Gremien, erzählt Gross, bevor es dann schließlich von der Landesregierung zum sogenannten "Demonstrativbauvorhaben" erklärt wurde und die Finanzierung gesichert war. Schon vor der Fertigstellung konnten sich interessierte Käufer ihre Wohnungen sichern, nach und nach auch einziehen. Sie hatten sogar ein Mitspracherecht, was die Grundrisse und Ausführungen der Wohnungen betraf. Gerade diese Partizipationsmöglichkeit ist, neben der Aufbereitung des Bodens für ein gemeinschaftliches Gefüge, charakteristisch für die Terrassenhaussiedlung. Die Werkgruppe fertigte ein Modell an – derzeit steht es in der HDA-Ausstellung, traditionell im Bewohnerzentrum –, anhand dessen sich Interessenten ihre Wohnungen aussuchen konnten. Auf die Baustelle wurde eigens ein Containerbüro hingesetzt, wo sich zukünftige Bewohner mit den Architekten über ihre Wünsche austauschen konnten. "Das war natürlich ein wahnsinniger organisatorischer Aufwand", erinnert sich Gross. Die Werkgruppe war nicht nur für die Planung verantwortlich, sondern sie übernahm auch die Bauleitung und wurde eigentlich, so Gross, zum "Generalmanager".
Das Grundstück der Terrassenhaussiedlung auf einem ehemaligen Ziegeleigelände umfasst eine Fläche von 4,5 Hektar. Errichtet wurden die vier stattlichen Blöcke auf Lehmgruben, die mit Bauschutt aufgefüllt waren – Bauschutt, in dem auch zerstörte Häuser des Zweiten Weltkriegs vergraben waren. Ein solches Fundament ist nicht stabil, und so wurden Stahlpfähle bis in den tragfähigen Boden gestoßen. Deshalb spricht Gross gerne von einer "schwimmenden Anlage". Die vier Blöcke selber, die "versetzt angeordnet, in gestaffelter Höhe zugleich den Blick auf die Stadt und das grüne Umland bieten", so Gross, sind nach Süd-Ost und Nord-West ausgerichtet. Für eine Seite also scheint die Morgensonne, die andere freut sich über die Abendsonne. Insgesamt, sagt Gross, gibt es 24 verschiedene Wohnungstypen – von Atelierwohnungen über Maisonetten bis hin zu den Terrassenwohnungen, 42 bis 142 Quadratmeter groß –, was nicht zuletzt die soziale Durchmischung gewährleisten soll. Ab dem vierten Geschoß haben viele der Wohnungen Fenster in beide Richtungen, was den Lichtverhältnissen entgegenkommt. Von den Dachterrassen ganz oben kann man die ganze Stadt überblicken. Und der komplette Siedlungsbereich ist Fußgängerzone, Autos sind in die Tiefgarage verbannt.
In seiner Rede zur Ausstellungseröffnung stellte Kapfinger die rhetorische Frage: "Warum gibt es nicht 20 oder 30 solcher Bauten?" Ja, warum eigentlich nicht? Gross etwa führt das auf die veränderten Förderrichtlinien zurück, die bald nach der Fertigstellung der Siedlung in Kraft treten sollten. Man wollte wieder kleinere Bauten fördern, Wohnhäuser sollten nicht mehr als vier Geschoße haben, alles darüber hinaus, war damals die Meinung, sei Familien nicht zuträglich. Auch Kapfinger spricht von einem Paradigmenwechsel, von einem neuen Zeitgeist, der da hieß: "Small is beautiful". Da war dann die Terrassenhaussiedlung, waren ihre voluminösen Kubaturen, die Stahlbetonmassen und der offensive Strukturalismus nicht mehr gefragt.
Auch in der Bevölkerung fand und findet die Terrassenhaussiedlung nicht nur Bewunderer. "Von außerhalb wurde die Siedlung anfangs schon argwöhnisch betrachtet", sagt die Grazer Architekturkritikerin Karin Tschavgova, die immer wieder Führungen dorthin unternimmt, "obwohl die Bewohner selber immer zufrieden waren." Nicht nur Fachleute wissen heute die architektonischen und mitunter visionären Qualitäten der Siedlung zu schätzen, auch die allgemeine Akzeptanz sei, so Tschavgova, über die Jahre sicher gestiegen. Peter Deutschmann, Bewohner seit zehn Jahren und Professor für slawische Literatur und Kulturwissenschaft an der Uni Salzburg, allerdings erzählt, als er damals die Wohnung erwerben wollte, habe die Dame vom Immobilienbüro gesagt: "Aber sie wissen schon, die Wohnung ist in der Terrassenhaussiedlung." Es steht also zu vermuten, dass sich der Blick des unbedarften Betrachters ob der wuchtigen Baumassen oder des teils schon angegrauten Sichtbetons mitunter auch abwenden mag. In Bezug auf die Herangehensweise der Werkgruppe bringt Kapfinger den Begriff "brut" ins Spiel – "eben keine geschönte oder aufgemotzte Baukunst', sondern die offengelegte Werkzeughaftigkeit der Raum- und Tragstrukturen."
Wobei es laut Tschavgova der Ausnahmefall sei, dass Immobilienbüros Annoncen für frei gewordene Wohnungen in der Siedlung schalten. Das liege zum einen daran, dass die Fluktuation eher gering ist – woraus man auch auf eine gewisse Zufriedenheit schließen kann – und dass sich der Weiterverkauf auch privat regeln lasse. Zwar glaubt sie, dass der ursprünglich intendierte Gemeinschaftsgedanke heute "eher weniger Bedeutung hat", dennoch biete die Siedlung gute Möglichkeiten, nachbarschaftliche Kontakte zu knüpfen, "aber eben nicht notwendigerweise". Laut einer Untersuchung des Wohnbundes Steiermark, Gross beruft sich darauf 2003 in einem Text für die Fachzeitschrift Architektur & Bau Forum, "wurde die Terrassenhaussiedlung zu den drei mit bester Wohnzufriedenheit ausgezeichneten Grazer Wohnanlagen gezählt."
Klarerweise ist die Terrassenhaussiedlung in ihrem ästhetischen Erscheinen "ein Kind seiner Zeit", wie Johann Theurl, Präsident der IG Terrassenhaus und ein Bewohner der ersten Stunde, meint. Die IG ist ein Verein, der sich nicht nur um den Erhalt der Siedlung, sondern auch um die "Verbesserung des Zusammenlebens" kümmert und sogar eine eigene Siedlungshomepage betreibt. Der Bauherr der Siedlung, eine Wiener Wohnbauvereinigung, ging schon in der Bauphase in Konkurs und hat, wie Theurl erzählt, "eine schwierige Situation hinterlassen". Mit der Gründung der IG wollte man dann ein Bindeglied zwischen den Wohnungseigentümern – die Siedlung ist ausschließlich im Besitz der Bewohner – und der Hausverwaltung schaffen. Die IG gibt darauf acht, dass in der Siedlung mehr passiert als bloß das Nötigste, mehr als das, wozu die Hausverwaltung verpflichtet ist. Nur das Prozedere allerdings, wann etwas verändert oder verbessert werden darf oder soll, ist laut Theurl mitunter mühsam.
Wohl nicht alle Visionen, die die Architekten einst im Sinn hatten, haben sich erfüllt. Die auf dem Strukturalismus fußende Idee etwa, dass die Gebäude mit der Initiative der Bewohner weiterformuliert, also aus- und weitergebaut werden, hat nicht wirklich Früchte getragen. Nicht zuletzt deshalb, weil nach gröberen Eingriffen alles neu parifiziert, also das Verhältnis der Eigentumsanteile neu berechnet werden müsste. Anknüpfungspunkte würden die Blöcke schon bieten, es gibt auch vereinzelte Zubauten, die bei Gross allerdings wenig Begeisterung hervorrufen. Und wohl nicht alle Kommunikationszonen haben den erwarteten Zuspruch gefunden. Selbst Gross räumte im Architektur & Bau Forum ein: "Für gemeinschaftliche Nutzungsbereiche gemäß dem architektonischen Konzept wurden bisher keine brauchbaren Lösungen entwickelt." Dennoch hat sich etwa bei Peter Deutschmann über die Jahre ein gewisser "Siedlungspatriotismus" entwickelt. Die Siedlung, sagt er, dürfe nicht "als ein Kapitel der Geschichte abgehakt werden, alleine schon wegen ihrer Kühnheit". Eugen Gross wirft an diesem Nachmittag noch einen letzten Blick auf sein und das Werk der Gruppe und antwortet auf die Frage, ob er aus heutiger Sicht etwas anders machen würde: "Ich bin zufrieden. Nein, wir hätten nichts anders machen können."