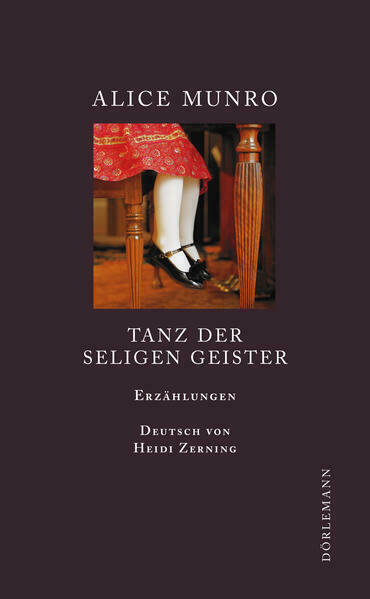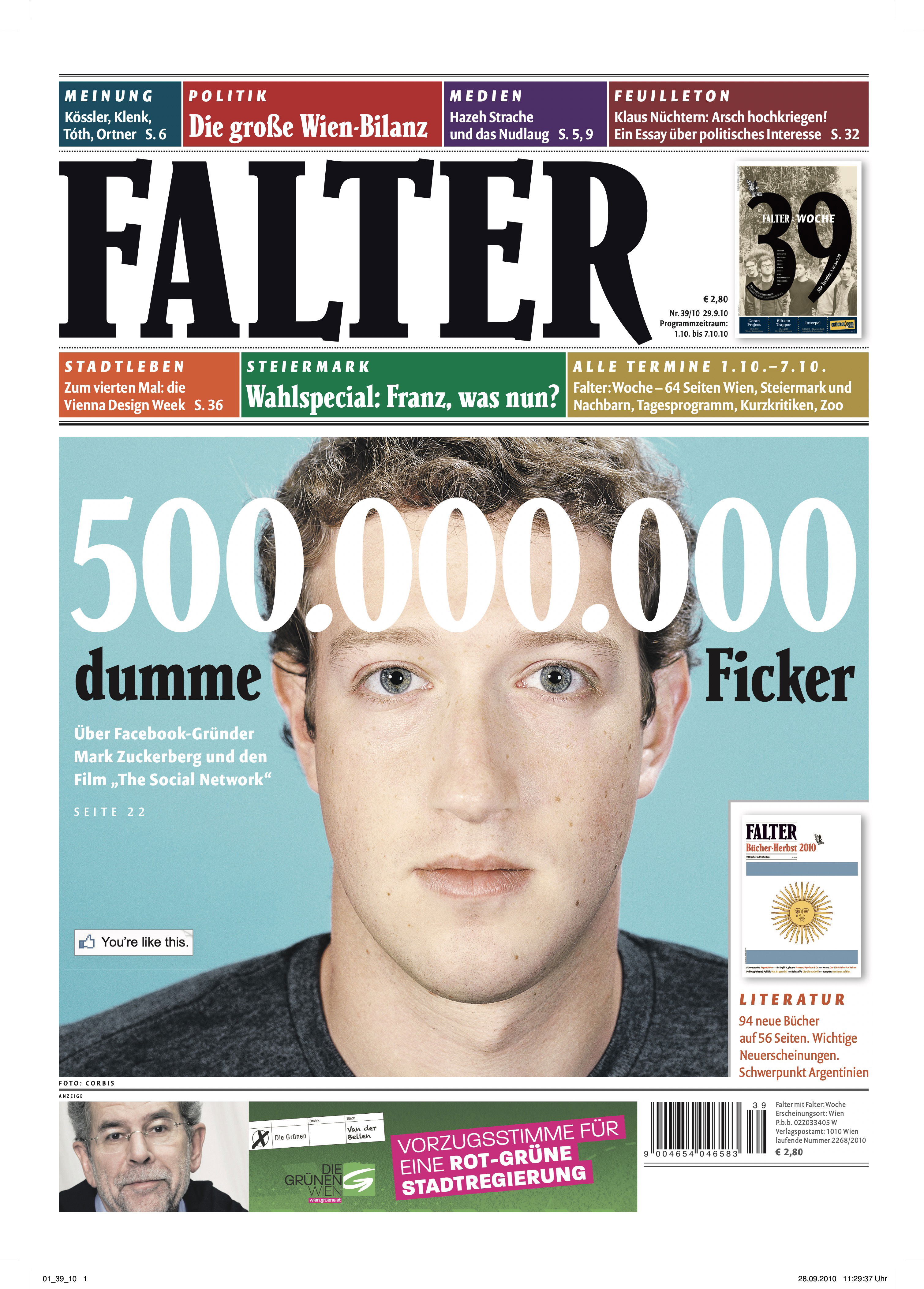
Schenk mir deine Zyste in Formaldehyd
Ulrich Rüdenauer in FALTER 39/2010 vom 29.09.2010 (S. 6)
Die Erzählerin in der ersten Geschichte von Alice Munros "Tanz der seligen Geister" ist ein Mädchen. Kein kleines Kind mehr, aber noch weit davon entfernt, eine Frau zu sein. Sie hat bereits einen Blick für die Seltsamkeiten ihrer Umgebung; und sie spürt, wie das Leben durch sie hindurchfließt, wie die Zeit ihre unsichtbare Arbeit tut.
Das Mädchen begleitet den Vater, der als Vertreter für die Drogeriefirma Walker Brothers arbeitet. Als sie bei einer alten Freundin des Vaters Halt machen, entdeckt die Erzählerin eine unbekannte Seite an diesem Mann: Man darf vermuten, dass der "Walker Brothers Cowboy" einmal in die Frau verliebt war. Er trinkt bei ihr Whisky, ist ausgelassen; er tanzt sogar. Plötzlich nimmt das Mädchen eine neue Facette an ihm wahr, entwickelt ein untrügliches Gespür für die Intimität dieses Geschehens: "Mein Vater verbietet mir mit keinem Wort, zu Hause etwas zu erzählen, aber ich weiß, allein von der Bedenkzeit, bevor er die Lakritze herumreicht, dass es etwas gibt, das nicht erzählt werden soll."
Das ist auch das Geheimnis der Storys von Alice Munro: Es gibt nichts Heimliches, aber doch Dinge, die nicht erzählt werden dürfen – und die gleichwohl im Textraum schweben. Schon in diesen ihren ersten Erzählungen aus dem Jahr 1968 ist dieser einmalige Ton da: Es sind Geschichten, die bis in die 30er-Jahre zurückreichen, in Provinzstädten im Südosten Kanadas spielen. Es sind Geschichten über den Vater, der Silberfüchse züchtet; über die verwirrenden Irritationen, die entstehen, wenn man in eine andere Lebensphase hinüberschlüpft und die alte Haut noch nicht ganz abstreifen kann; über flüchtige Liebeleien.
Munro, 1931 in Ontario geboren, gehört zu den großen Schriftstellerinnen der Gegenwartsliteratur. Das hat sie mit ihrer kanadischen Landsfrau und Freundin Margaret Atwood gemein. Es ist ein schöner Zufall, dass zugleich auch von Atwood Short Storys erschienen sind: "Tipps für die Wildnis" wurde im Original bereits 1991 veröffentlicht.
Bei Atwood, 1939 in Ottawa geboren, stehen ebenfalls Frauen im Mittelpunkt. Auch sie versteht sich auf leise Töne, aber doch sind ihre Geschichten ausgeschriebener, weniger geheimnisvoll. Manchmal blitzt in ihnen so etwas wie Sarkasmus auf: Wenn etwa eine toughe Chefredakteurin eines Modemagazins, die – während ihr im Krankenhaus eine Zyste entfernt wird – nicht nur ihren Job, sondern zugleich ihren Liebhaber verliert. Das aus ihr entfernte "Wollknäuel" bewahrt sie anschließend in Formaldehyd auf und stellt sich vor, es sei ihr ungeborenes Kind: Er symbolisiert ein verpasstes Leben und ein Menetekel, das sie ihrem Exlover und dessen nichtsahnender Gattin als Geschenk hinterlässt.
Atwood ist eine genaue Beobachterin der emotionalen Widrigkeiten, die zwischen Mann und Frau entstehen können. Sie bezieht keine Position, auch wenn die Perspektive der Heldinnen nie verlassen wird: Die Unwägbarkeiten und das Scheitern, die Beziehungskonstruktionen, die immer mit Macht und Ohnmacht zu tun haben, werden genauestens registriert.
Den Übersetzerinnen Heidi Zerning und Charlotte Franke ist es jeweils gelungen, die Sprache der Autorinnen zu bewahren, sowohl das Verschwiegene bei Munro als auch das Witzige und Bittere bei Atwood. Beide Sammlungen sind auf je eigene Weise faszinierend: Sie zeigen, was aus der kleinen Form, die hierzulande noch immer unterschätzt wird, herauszuholen ist. Es braucht nur wenige Seiten, um ein Leben zu erzählen. Und es braucht das literarische Können von Schriftstellerinnen wie Alice Munro und Margaret Atwood.