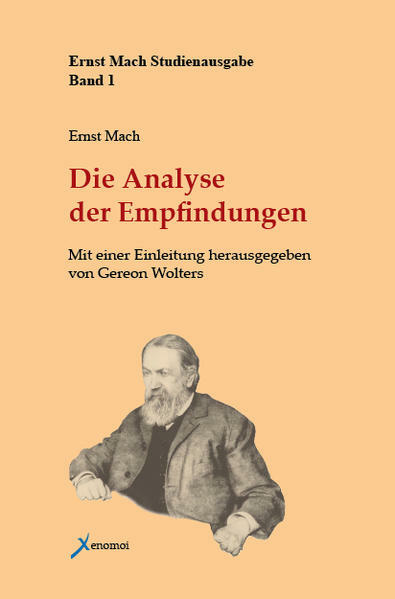Der Vater des Wiener Kreises
André Behr in FALTER 41/2011 vom 12.10.2011 (S. 37)
Eine Studienausgabe erschließt das Werk des Physikers, Philosophen und Wissenschaftstheoretikers Ernst Mach
Mit schöner Regelmäßigkeit schaffen es Meldungen aus der Welt der Physik in die Schlagzeilen, wenn sie besonders spektakulär klingen. Der Hunger nach Sensationen ist so groß, dass die meist vorsichtigen Formulierungen der Forscher untergehen, und Medien abenteuerliche Vermutungen behandeln, als seien sie bereits mehr als ein Gedankenkonstrukt.
In solchen Momenten würde man sich die kritische Stimme eines Ernst Mach wünschen. Der Experimentalphysiker, Philosoph und Wissenschaftstheoretiker, geboren 1836 in Chirlitz bei Brünn im ehemaligen Österreich-Ungarn, war einer der antispekulativsten Denker seiner Zeit – einer Zeit, in der die Newton'sche Mechanik die Lehrmeinung ebenso dominierte, wie es heute die Relativitäts- und die Quantentheorie tun. Einer Zeit auch, in der sich die Grenzen von Newtons Denken abzeichneten wie jetzt diejenigen der genannten etablierten Theorien.
Antimetaphysisches Credo
Für Mach war selbstverständlich, dass der Fortschritt in den Naturwissenschaften auf spekulative Ideen angewiesen ist. Man dürfe sie allerdings, so sein antimetaphysisches Credo, nicht mit dem Erreichen des Ziels verwechseln.
Die Erfahrungsbindung verlange von akzeptablen, wissenschaftlichen Begriffen einen direkten Bezug zum Beobachtbaren, und nur die Empirie bewahre den Forscher vor Exzessen metaphysischer, mystischer und theologischer Subjektivität, die den wissenschaftlichen Fortschritt behindert.
Ausführlicher beschreibt diesen Zusammenhang von Empirismus und Aufklärung bei Mach der an der Uni Konstanz lehrende Wissenschaftsphilosoph und -historiker Gereon Wolters in der Einleitung zu dem gemeinsam mit seinem israelischen Kollegen Giora Hon herausgegebenen dritten Band der annotierten Ernst-Mach-Studienausgabe mit dem Titel "Die Mechanik in ihrer Entwicklung historisch kritisch dargestellt", der in den kommenden Wochen erscheinen wird.
Mach war 45 Jahre alt und nach Stationen in Wien und Graz seit 16 Jahren Professor in Prag, als er dieses epochale Buch 1883 publizierte. Es hat nach Wolters, wie kein anderes Werk zur Geschichte der Physik, selbst Physikgeschichte geschrieben.
Einsteins Bewunderung
Seine hohe Wertschätzung verdankt das Buch vor allem Albert Einstein, den als Student tief beeindruckt hatte, wie Mach an dem dogmatischen Glauben an die Mechanik als gesicherte Basis aller Physik rüttelte. Das eindrücklichste Beispiel dafür war Machs Kritik am Newton'schen "Eimerversuch".
Der englische Gelehrte hatte im 17. Jahrhundert behauptet, sein Gedankenexperiment erzwinge zur Bestimmung der Rotationsbewegung von Wasser in einem Eimer die Existenz eines absoluten Raums. Mach dagegen verwies auf die von Newton nicht berücksichtigten großen Massen außerhalb des Eimers, die mit dem Wasser im Eimer interagieren könnten.
Dieses Trägheitsprinzip Machs nannte Einstein das Mach'sche Prinzip, erläutert Wolters. Es habe Einstein bei der Formulierung der Allgemeinen Relativitätstheorie mächtig angetrieben. Darüber hinaus hat Wolters in seiner Habilitationsschrift "Mach I, Mach II, Einstein und die Relativitätstheorie" (De Gruyter, 1985) weitere Stellen aufgelistet, die Ideen von Einstein vorwegnahmen.
Man könne sie in Nebensätzen finden, wenn Mach davon träumt, wie eine ideale physikalische Theorie aussehen müsste. Umgekehrt sieht Wolters in Machs "Mechanik" nichts, was heute als überholt bezeichnet werden müsste. Einzig die Rolle der Spekulation gegenüber der Erfahrung habe Mach etwas zu negativ interpretiert. Darin liege wohl der Grund, weshalb er die Existenz der sich der Beobachtung entziehenden Atome vermutlich erst kurz vor seinem Tod 1916 akzeptiert habe.
Gereon Wolters widerlegte in seinem Buch insbesondere die oft kolportierte Meinung, Mach selbst sei ein Gegner der Relativitätstheorie gewesen. Mit kriminalistischem Gespür konnte er nachweisen, dass die entsprechenden Stellen in Machs Werk von seinem ältesten Sohn Ludwig posthum gefälscht worden sind.
Ludwig hatte sporadisch bei seinem Vater im Labor gearbeitet und fühlte sich als gescheiterter Arzt in seiner Rauschgiftsucht berufen, das väterliche Werk weiterzuführen, obwohl er nur wenig davon verstand. Die von Wolters in dieser Sache selbst zusammengetragenen Dokumente liegen nun im Philosophischen Archiv der Uni Konstanz. Machs Hauptnachlass bewahrt das Deutsche Museum in München auf.
Von den fünf Kindern Machs hatten wohl nur die Tochter Caroline, die in die USA auswanderte, sowie der Sohn Viktor kein als tragisch zu bezeichnendes Leben.
Kindheit in Wien
Machs Hochbegabung zeigte sich früh und klar. Er wuchs in einer zurückgezogen lebenden Familie auf einem Landgut bei Wien auf, ging nur zwei Jahre ins Gymnasium, wurde dazwischen aber von seinem gebildeten Vater unterrichtet.
Bereits mit 15 liest er Immanuel Kants "Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können" und reflektiert unabhängig und emotional stark engagiert über den Zusammenhang der Welt. Nach dem Studium der Mathematik, Physik und Physiologie in Wien hat er bald Erfolge.
Ihm gelingen wichtige Beiträge, etwa zur Optik und dem Dopplereffekt. Und er war einer der Pioniere der wissenschaftlichen Fotografie. Aufgrund seiner Studien zu fliegenden Projektilen bezeichnet man heute die Geschwindigkeit von Flugzeugen mit "Mach 1", wenn sie so schnell wie der Schall fliegen.
Machs "Mechanik" allein sicherte ihm als Lichtgestalt wissenschaftsphilosophischer Reflexion neben Henri Poincaré und Pierre Duhem einen Platz weit über sein Jahrhundert hinaus. Er leistete jedoch ebenso Herausragendes auf den Gebieten der Physiologie und Psychologie, die ihn immer interessierten.
In Band 1, "Die Analyse der Empfindungen", der Studienausgabe, deren erste Auflage 1886 erschienen ist, präsentiert er seine Erkenntnistheorie, die auf seiner Lektüreerfahrung sowie seiner mystischen und beruflichen Erfahrung bei seinen psychophysischen Studien beruht.
Pionier der Transdisziplinarität
Auch die Titel seiner Aufsätze in "Erkenntnis und Irrtum", dem soeben erschienenen Band 2 der Studienausgabe, dokumentieren die fächerübergreifende Bandbreite von Machs Forschen. Diese 1905 erstmals publizierten "Skizzen zur Psychologie der Forschung" bildeten das letzte große Werk von Ernst Mach. Ab 1898 war er nach einem Schlaganfall rechtsseitig gelähmt, wurde in der Folge 1901 als Professor für Philosophie in Wien emeritiert und zog 1913 zu Sohn Ludwig nach Vaterstetten bei München, wo er 1916 im Alter von 78 Jahren starb.
Friedrich Stadler, dem leitenden Herausgeber der Studienausgabe, gilt Mach aufgrund seiner Vielfalt als Pionier für das, was man heute oft etwas salopp mit Transdisziplinarität bezeichnet. Machs originelle Zugangsweise und seine innovativen Methoden, sagt der wissenschaftliche Leiter des Institut Wiener Kreis und Professor an der Uni Wien, seien heute hochaktuell, weil Mach das Feld geöffnet habe für die Überlegung, wie man zu Wissen und Theorien komme. Die rein abstrakte Wissenschaft und die normative Wissenschaftstheorie habe er als unfruchtbar in die reine Philosophie zurückgewiesen.
Die Qualität der Inhalte und des Schreibens ist für Stadler ein Grund, weshalb Ernst Mach weit über die Akademikergemeinschaft hinaus wahrgenommen worden ist. Der evolutionäre Gedanke, sein funktionales Denken sowie seine Ansätze von Sprachkritik, erläutert Stadler, haben beispielsweise wichtige Wiener Literaten fasziniert, zum Beispiel Robert Musil, der über Mach seine Doktorarbeit schrieb, oder den Journalisten Fritz Mauthner.
Fast alle Mitglieder des Wiener Kreises, der später explizit Verein Ernst Mach hieß, beriefen sich mehr oder weniger stark auf Mach.
Anhänger der Arbeiterbewegung
Mach war als Mensch bescheiden, immer bereit, seine Position zu korrigieren, und korrespondierte mit vielen Zeitgenossen. Zudem hing er dezidiert der Arbeiterbewegung und der Sozialdemokratie an. Mit seiner Auffassung von Wissenschaft räumte er prinzipiell jedem die Möglichkeit ein teilzunehmen.
Deshalb gehörte auch der österreichische Politiker Friedrich Adler zu seinen Bewunderern. Umgekehrt brachte ihm seine "neutraler Monismus" genannte Erkenntnistheorie harsche Kritik von Lenin ein, für den man nur entweder Materialist oder Idealist sein konnte.
Friedrich Stadler hat mit Rudolf Haller zu "Ernst Mach. Werk und Wirkung" ein umfangreiches Buch herausgegeben (Hölder-Pichler-Tempsky, 1988). Die vom Berliner Kleinverleger und Philosophen Wolfgang Sohst initiierte neue Studienausgabe liegt ihm am Herzen.
Er hofft, wie Wolters, dass sie zur Wiederentdeckung Machs beiträgt, insbesondere auch im Bereich der Lehre und Forschung. Deshalb wurde jeder Band mit einer Einleitung und ausführlichen Anmerkungen versehen. "Die Lektüre lohnt sich", sagt Friedrich Stadler, "denn Ernst Mach lässt den Leser an seinem Denken teilhaben."
In dieser Rezension ebenfalls besprochen: