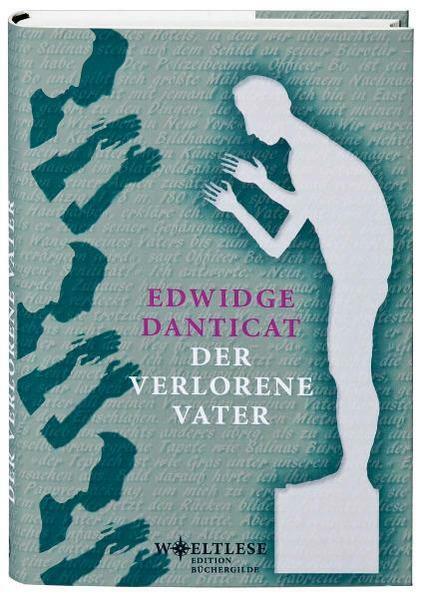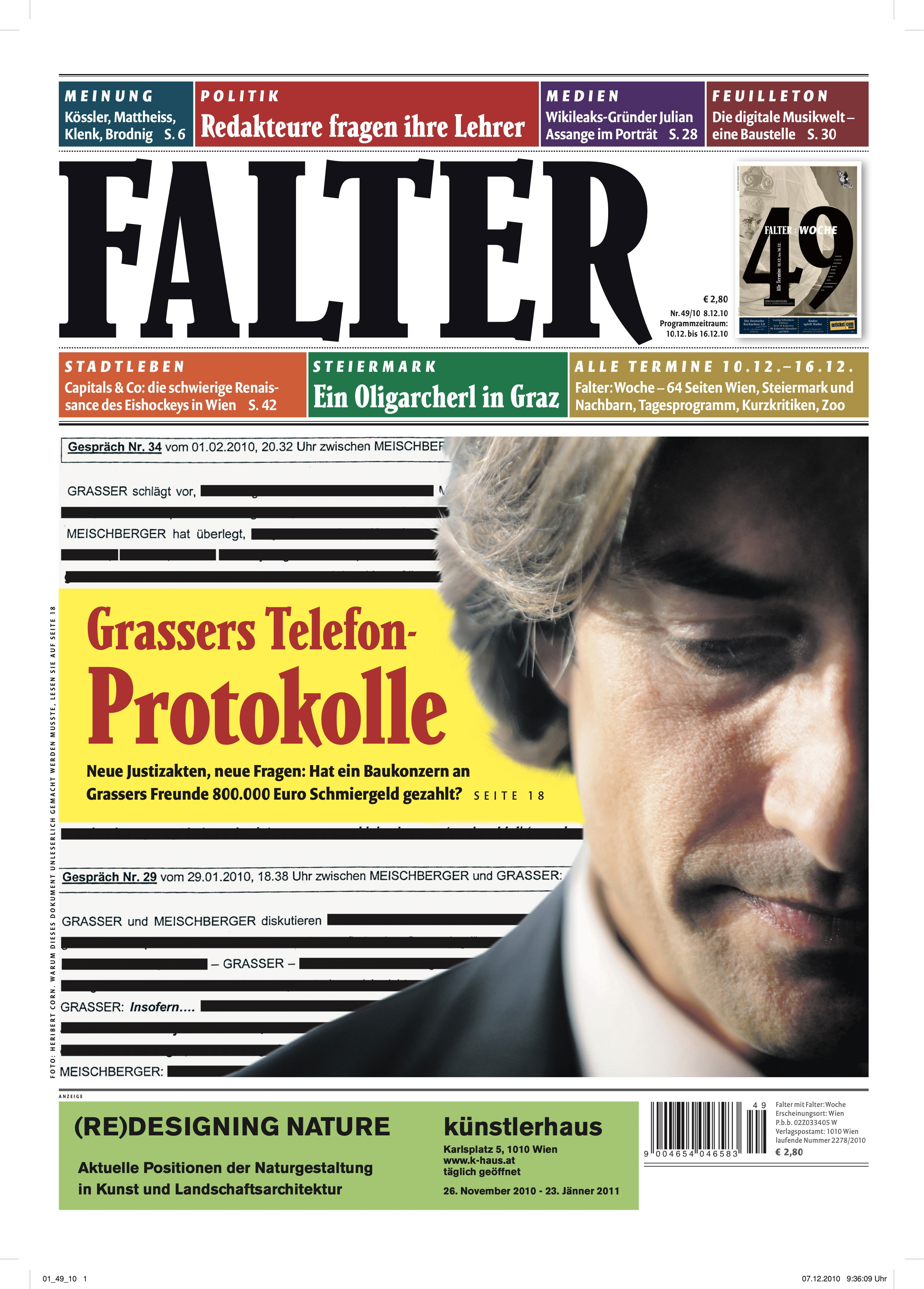
Der Gejagte war schon damals der Jäger
Karl-Markus Gauß in FALTER 49/2010 vom 08.12.2010 (S. 35)
In ihrem locker gefügten Roman "Der verlorene Vater" zeigt uns Edwidge Danticat jenes Haiti, von dem nichts in der Zeitung steht
Ka Bienaimé, eine haitianische Bildhauerin, geht mit ihrem hinfälligen Vater auf die Reise ihres Lebens. Seit langem wohnen sie in New York, jetzt sind die beiden auf dem Weg nach Florida, wo eine reiche Exil-Haitianerin von Ka eine Skulptur erstehen möchte. Doch dann ist der alte Herr plötzlich verschwunden, und mit ihm jene Holzskulptur, die wie alle Werke von Ka den Vater zeigt: den gemarterten, sanftmütigen Mann, dessen Gesicht von einer gewaltigen Narbe verunstaltet ist und der mit seiner ins Auge springenden Verletzung, seiner schweigsamen Traurigkeit für all die Verfolgten und Vertriebenen steht, deren Leben vom grausamsten aller grausamen Despoten Haitis, Papa Doc Duvalier, zerstört wurde.
Dass der Vater verschwindet, damit beginnt der Roman "Der verlorene Vater" von Edwidge Danticat, die 1969 in Haiti geboren wurde und inzwischen selbst in New York lebt. Dass Ka den Vater nach ein paar Tagen wiederfindet, ihn gerade dadurch verliert und am Ende doch eine neue Beziehung zu ihm herzustellen versucht, das bildet den Bogen dieses Romans, der aus neun sich verselbstständigenden Erzählungen gebaut ist. Ka muss vielleicht das Schlimmste, das sie über ihren Vater erfahren konnte, herausfinden. Der war in Florida ausgerissen, um die Skulptur, die ihn als geschundenen Mann zeigt, in dessen Antlitz sich die Geschichte Haitis spiegelt, zu beseitigen und in einem See zu versenken. Erst jetzt, da die Tochter Aufklärung verlangt über diese seltsame Tat, kann er ihr sagen, was er ihr seit vielen Jahren sagen will: "Ich verdiene keine Skulptur ... Ich war der Jäger, nicht der Gejagte."
Er war nicht im Gefängnis inhaftiert, sondern hat in diesem gearbeitet, als gefürchteter Schläger und Folterer der Tontons Macoutes, der bizarr gewalttätigen und korrupten Geheimpolizisten von Papa Doc Duvalier. Zahllose Menschen hat er gequält, manche getötet; bis ihm etwas widerfuhr, was Anne, seine Frau, als Beweis dafür nimmt, dass in der Welt ein Wunder wirkender Geist tätig ist: Der letzte Häftling nämlich, ein sozialrebellischer Pastor, schlitzt ihm, bevor er getötet wird, mit einem spitzen Holzstück die Wange auf; und ausgerechnet der Schmerz, den der Gewalttäter, der gewohnt ist, anderen Schmerz zuzufügen, verspürt, lässt ihn innehalten – und aussteigen. Über 30 Jahre ist das schon her, und Ka ist das Kind der Liebe zwischen dem Folterer und der Schwester des ermordeten Pastor.
Das klingt nicht nur kitschig, sondern geradezu übel: eine verwerflich konstruierte, bittersüße Liebesgeschichte zwischen Täter und Opfer, angesiedelt an einem Höllenort auf Erden, mit der wundersamen Heilung des Täters und der alles verzeihenden Liebe des Opfers. Aber Edwidge Danticat gibt es keineswegs kitschig, sie schreibt vielmehr klar, karg, unerbittlich.
Die erste und die letzte Erzählung sind dem Vater, seinen Verbrechen, der Sühne und dem Verhältnis der Tochter zu ihm, dem Helden ihrer Kindheit, gewidmet. Nach dem ersten Schock denkt sie, dass ihre Zukunft eine glücklichere geworden wäre, wenn sich ihr Vater so spät nicht doch noch offenbart hätte. Selbst als Bildhauerin wird sie in die Krise geraten: "Ich habe mein Motiv verloren, meinen Vater, den Häftling, den ich liebte und bedauerte."
Die sieben Erzählungen dazwischen, Kapitel eines locker gefügten Romans, der auch als Zyklus eindringlicher Kurzgeschichten durchgehen könnte, haben alle mit dem Vater und dem, was er verbrochen hat, zu tun – die einen mehr, die anderen weniger. Was so entsteht, ist nicht allein das Porträt eines geläuterten Mörders, eines glaubhaft zur Besinnung gekommenen Folterknechts, sondern auch das Bildnis eines Landes, über das scheinbar die Verdammnis verhängt worden ist.
Die einzelnen Teile des Romans spielen auf Haiti und New York: auf Haiti, wo sich ein jeder danach sehnt, der Gewalt, dem Elend, den periodisch wiederkehrenden Katastrophen zu entrinnen und in die USA zu gelangen; und in New York, wo sich die Haitianer nicht zurechtfinden, sich nach der Heimat sehnen, in der sie zugrunde gehen würden, und einander, je nachdem, mit Misstrauen begegnen oder in alltäglicher Solidarität beistehen.
Wie nebenhin weiß Edwidge Danticat vom Leben der Exilanten zu erzählen, von Männern, die den Frauen ins Gelobte Land vorausfahren, um die Übersiedelung der Familie vorzubereiten, und die es nach sieben Jahren immer noch zu keinem eigenen Zimmer gebracht haben, sondern mit anderen einsamen Flüchtlingen zusammenhausen. Sie schicken ihren Lieben Geld nach Haiti, haben deren Bild im Spind hängen, träumen vom Familienglück und erfahren doch, wie darüber in einer ganz anderen Welt ihr fremdes Leben vergeht.
Gerade die Frauengestalten Danticats überzeugen. Etwa Rézia, deren Eltern ermordet wurden und die bei der Tante in Port-au-Prince im Bordell aufwuchs, es aber geschafft hat und jetzt ein kreolisches Restaurant in Brooklyn besitzt. Und die eine Abendschule besucht, nicht so sehr, um doch noch richtig Englisch zu lernen, sondern um dort junge Frauen aus Haiti kennenzulernen, die gerade erst ins Land gekommen sind, und mit ihnen über dieses verdammte Land zu reden, das ihnen trotz allem abgeht.
Von Haiti hören wir regelmäßig in den Weltnachrichten. Wir sind wohlinformiert und wissen doch fast gar nichts. In den Erzählungen von Edwidge Danticat erfahren wir, was nicht in den Zeitungen steht, die wahre Geschichte dieses Landes und seiner traurigen und tapferen, seiner ohnmächtigen und wütend dreinschlagenden Menschen, zu deren Unglück es gehört, dass sich manche von ihnen in die Unterdrückung verstricken, die sie selbst erleiden müssen.