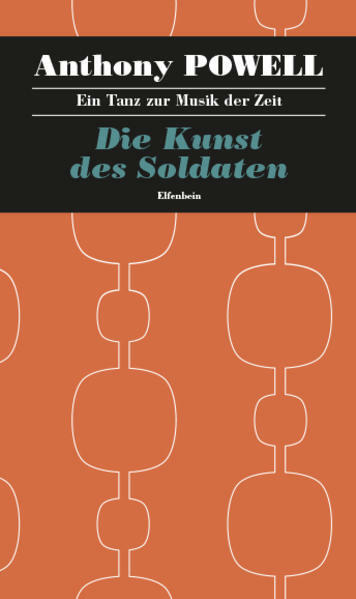Der mit dem Zwölfbänder tanzt
Peter Kislinger in FALTER 11/2017 vom 15.03.2017 (S. 16)
Eine verlegerische Großtat: Anthony Powells Romanzyklus „Ein Tanz zur Musik der Zeit“ erscheint auf Deutsch
A Dance to the Music of Time“ ist das zwölfbändige Hauptwerk von Anthony Powell (1905–2000), der mit Kollegen wie Graham Greene, Evelyn Waugh, T.S. Eliot oder Kingsley Amis befreundet und für George Orwell „Tony, der einzige sympathische Tory“ war. Die in sich abgeschlossenen Bände des Romanzyklus erschienen zwischen 1951 und 1975. Sie sollten chronologisch gelesen werden.
Drei deutsche Verlage schafften es mit einer Eindeutschung bisher nie weiter als bis Band fünf. Der Berliner Elfenbein Verlag ist nun bei Band acht angelangt. Titelgebend war ein allegorisches Gemälde von Nicolas Poussin. Nicholas Jenkins, Powells Erzähler, erinnert sich an einen Aspekt dieses Gemäldes und beschreibt, auf Schopenhauer anspielend, den Wechsel von Unberechenbarkeit und Kontrolle. Mit der implizierten Harmonie kontrastiert am Ende des zwölften Bandes das Chaos in einem Zitat aus Robert Burtons „Anatomie der Melancholie“. Für mehr als 400 Figuren aus Gesellschaft, Politik, Militär Großbritanniens und Londons Boheme (Künstler, Musiker, Literaten) choreografiert Powell einen Tanz, der vom 29. Juni 1914 bis Herbst 1971 dauert.
In Band acht kommt es zwischen einem französischen Offizier des Zweiten Weltkrieges und Jenkins zu einem kurzen Dialog: „,Sie wissen schon, der Schriftsteller, über den Sie da gesprochen haben? Irgendwas mit einer plage … Badestrand – in der Normandie?‘ ‚Proust?‘ ‚Ja, der. Hab’ mich über ihn schlau gemacht. Er wird nicht in den Schulen unterrichtet.‘ Kernével blickte streng. Er gab zu verstehen, die Standards der Literatur müssten hoch gehalten werden. Ich weiß, warum Jenkins nichts erwidert. Ich kenne solche Situationen: ‚Irgendwas mit dinner parties – upper class, in England?‘ ‚Powell?‘ ‚Ja, der. Hab’ …‘“
Die deutschsprachige Kritik, selbst begeisterte, reagiert oft nicht anderes als Kernével, mit Klischees und Schlagworten und aus Unkenntnis aller Bände: ewige Dinnerparty, very British, Erzählen mit Spazierstock, traditionell. „Fürs Romanlesen braucht es fast genauso viel Talent wie fürs Schreiben“, ätzt der (fiktive) modernistische Autor X. Trapnel in Band elf. Poussin hat es im 17. Jahrhundert so gesagt: „Zur Betrachtung vollkommener Dinge braucht es Zeit, Verstand und Verständnis. Sie zu beurteilen verlangt dasselbe Verfahren wie sie herzustellen.“
Von Antworten halte er nichts, meinte Powell einmal. So etwas wie Antworten geben Passagen vorher und nachher. Der Text animiert zum Zurückblättern (oder -navigieren), zum Wiederlesen. Es soll Mitglieder der Anthony Powell Society geben, die die rund 2800 Seiten mehr als 70 Mal gelesen haben.
Welche Antworten hätte Powell zu folgenden Stichworten geben können? Romanbegriff? Leben darstellen, wie es ist, beobachten, aufzeichnen. Kommentar erst, wenn Gegenwart Vergangenheit geworden ist. Nur ein Roman kann gewisse Wahrheiten andeuten, was exakter Definition unmöglich ist. Der Autobiograf ist Gefangener seines Egos. Dabei kommt Wahrheit abhanden. Transzendentales? Keine Meinung. Religion? Mir immer mehr oder weniger bedeutungslos gewesen. Theorien? Theoretiker und Menschen, die auf das Leben Antworten haben, machen mich fertig. Menschenbild? Menschen nehmen, wie sie sind. Wenig Sympathie für Opportunisten und Machertypen. Macht? Misstrauen. Satiriker? Nein, denn die wissen „alles besser“. Eiskalter Spott entmenschlicht. Humorist? Ja. Niemanden schonen, aber mitleiden und Ähnliches in sich selbst entdecken. Ironie? Ja, aber nicht die kalte rhetorische.
Der Erzähler Jenkins teilt das Humorverständnis seines Autors. Er reagiert mit mildem Spott etwa auf Marxisten und Trotzkisten, ebenso auf Aristokraten, die sich aus Langeweile und Schuldgefühlen der „revolutionären Sache“ annehmen und einen spartanischen Lebensstil zur Schau stellen. Der Autor lässt sie – zu Geld, Macht und Ansehen gekommen – in den 1960er-Jahren übellaunig enden.
Bereits im ersten Band, im Internat, ist alles im Keim angelegt. Drei junge Herren und eine der großen Figuren der Weltliteratur, der Sonderling Widmerpool, der Karriere macht: Finanzwelt, Großindustrie, Militär, Labour-Abgeordneter, Lord, Uni-Rektor und 1971 Mitglied einer esoterischen Sekte. Er nervt nicht nur den eleganten Melancholiker Stringham, die eigentlich tragische Figur des Zyklus: „Dieser Junge wird noch mal mein Tod sein.“ Widmerpool bleibt auch mit dem unentschlossenen, kalt wirkenden, aber neugierigen Beobachter Jenkins wie ein Jung’scher Schatten, „rätselhaft“, die Bände hindurch verbunden. Beide bringen auf ihre Art Ordnung ins Chaos. Widmerpool zwingt den Menschen, der Zeit seinen Willen auf, dem er alles unterordnet: Empathie zeigt er dann, wenn sie seinen Zwecken nützt. Jenkins sucht, findet, erfindet Muster. Aber: „Finality is never certain.“
Nimmt dieser undogmatische Relativist alles hin? Nein. Schwächen werden verziehen, nicht aber ressentimentgeleitetes, unverantwortliches Handeln. Jenkins ist „wütend“ über Major Widmerpool und dessen Plan für den nunmehrigen Gefreiten Stringham, sogar „angewidert“ von „diesem völligen Außerachtlassen, was mit ihm passieren könnte, ihn weiß Gott wohin zu versetzen“.
Marcel Proust und Thomas Mann in Ehren, aber keiner weiß Zeit so zu vermitteln wie Powell. Zu Geschichten – den eigenen und jenen anderer – tun sich, mosaikartig aus zweiter oder dritter Hand, neue Perspektiven auf. Jenkins nennt sie „Tricks, die die Zeit uns innerhalb ihrer eigenen Bereiche zu spielen vermag – Tricks, die die Unsicherheit verdeutlichen, in der jene leben, die dieser trügerischen Vorstellungsform allzu sehr vertrauen.“ Andere helfen sich mit Bonmots: „Alt werden ist in zunehmendem Maße wie eine Bestrafung für ein Verbrechen, das man nicht begangen hat.“
Nicht erst in der Kriegstrilogie (die Bände sechs bis acht) begegnet Jenkins Menschen aus verschiedensten Schichten. Glorifizierung, Verfall, Verkommenheit der Upper Class? Nostalgie? Nein. Wandel? „Alles ändert sich und dennoch bleibt alles gleich.“ Hunderte Verweise auf Malerei, Musik (U und E), Architektur, Literatur, Mythen, Politik, Geschichte bestätigen den Satz und brechen die Ich-Perspektive auf. Am Ende des „Tanzes“ wartet nicht, wie beim Erzromantiker Proust, eine Epiphanie. Die „Kunst“ hebt Zeit nicht auf.
Fungiert Jenkins als Sprachrohr seines Autors? Nein. Powell hat seine Erfahrungen in verschiedenen Genres gestaltet, er hat 19 Romane, vier Memoirenbände und drei Tagebücher hinterlassen, und er teilt das Misstrauen, das Moderne (Conrad, Henry James, Woolf, Joyce, Faulkner) gegen verbrauchte Erzählkonventionen hegten. Die von ihm eingesetzten Mittel – Collage, Pastiche, multiperspektivisches Erzählen, Intertextualität, Rückblenden, Asynchronien et al – sind so modern(istisch) wie postmodern und stets thematisch verankert, aber so unauffällig eingesetzt, dass ihn Literaturkritik und -wissenschaft lange rechts liegen ließen.
Moral von der Geschicht? Eine der Figuren gibt folgende Antwort: „Es gibt keine, außer dass sie mich nicht loslässt. Ich weiß nicht so recht, warum. Alles schien so gut anzufangen und ging so schlimm aus. So sollten, vielleicht, gut gebaute Geschichten enden.“