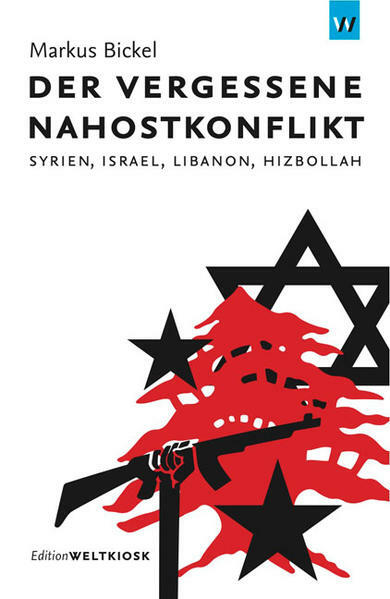Wie der Westen von Syriens Folterknechten profitierte
Thomas Schmidinger in FALTER 44/2011 vom 02.11.2011 (S. 18)
Während der "Arabische Herbst" einzieht, erinnert ein Buch an den vergessenen Nahostkonflikt zwischen Syrien, Libanon und Israel
Mit der Eskalation des Konflikts in Syrien verschiebt sich auch das mediale Interesse am "Arabischen Frühling" zunehmend von Nordafrika in Richtung Naher Osten. Das Buch des FAZ-Journalisten Markus Bickel leistet eine ebenso leicht lesbare wie fundierte Einführung in den "anderen Nahostkonflikt" zwischen Syrien, dem Libanon und Israel.
Bickel, der von 2005 bis 2008 als Korrespondent für verschiedene deutschsprachige Medien in Beirut eine entscheidende Phase der jüngeren Geschichte des Libanon miterlebte, schöpft aus einem Fundus an persönlichen Erfahrungen wie aus seinem umfassenden Wissen über Geschichte und Politik des Libanon und Syriens. Wer eine Einführung in die gegenwärtigen politischen Konflikte der Region sucht, die nicht auf den israelisch-palästinensischen Konflikt fokussiert, wird von diesem Buch nicht enttäuscht.
Der multireligiöse Libanon, der seine Unabhängigkeit von Syrien genau dieser konfessionellen Vielfalt verdankt, kam bereits kurz nach seiner Unabhängigkeit in das Fahrwasser des Nahostkonfliktes. Syrien, das die Abtrennung seiner Küstenregionen nie akzeptierte und den Staat bis heute als Einflussbereich betrachtet, versuchte ebenso seine Interessen zu sichern wie der südliche Nachbar Israel, der sich in den 1970er-Jahren noch von den bewaffneten Organisationen der palästinensischen Flüchtlinge im Libanon bedroht sah. Mit der vom Iran unterstützten schiitischen Hisbollah wuchs dem südlichen Nachbarland allerdings ein neuer Feind heran, der militärisch weit stärker ist, als es Fatah oder PFLP jemals waren.
Im Libanon begann der "Arabische Frühling" allerdings schon 2005 mit der Zedernrevolution, die nach dem Attentat auf Premierminister Rafiq al-Hariri den Abzug der syrischen Besatzungstruppen erzwang. Mit einer Fülle an Details schildert Bickel die Hoffnungen, die an diese Revolution geknüpft waren, sowie die bis heute nicht aufgeklärten Anschläge auf antisyrische Politiker und die Rückkehr prosyrischer Kräfte unter Führung der Hisbollah an die Macht. Die von Syrien und der Hisbollah blockierte Suche nach Hariris Mördern, stellt eines der zentralen Themen des Buches dar.
Interessant sind dabei die geschilderten Windungen transatlantischer Nahostpolitik. Das Regime der arabisch-nationalistischen Baath-Partei, das sich 1963 an die Macht geputscht hatte und in dem sich seit 1970 ein der religiösen Minderheit der Nusairier angehöriger Clan um Hafez al-Assad durchgesetzt hatte, war keineswegs immer so isoliert wie heute.
Dabei spielte weniger die kurze Öffnungspolitik unter dem Sohn und Nachfolger Assads, Bashar al-Assad, eine Rolle als die Zusammenarbeit mit westlichen Geheimdiensten gegen islamistische Gruppen nach 9/11.
"Die Informationen sprudelten reichlich in diesen Tagen, auch Hinweise auf geplante Anschläge. Innerhalb kürzester Zeit konnten die Central Intelligence Agency (CIA) und das Federal Bureau of Investigation (FBI) in Aleppo eigene Operationen starten, mit syrischer Genehmigung", schreibt der Autor.
Westliche Geheimdienste hatten offenbar wenig Bedenken, die mangelnden Menschenrechtsstandards klassischer Folterstaaten zu nutzen. Dies betraf nicht nur die CIA, sondern auch europäische Geheimdienste wie den deutschen Bundesnachrichtendienst (BND) und das deutsche Bundeskriminalamt (BKA).
Bickel schildert dies am Fall des in Syrien geborenen deutschen Staatsbürgers Mohammed Haydar Zammar, der 2001 in einer Kooperation zwischen BND, BKA, CIA und dem marokkanischen Geheimdienst entführt und an den syrischen Geheimdienst übergeben wurde: "Da, wo rechtsstaatliche Verfahren einer Verurteilung oder Verhaftung Terrorverdächtiger entgegenstanden, wurden andere Mittel eingesetzt. Entführungen etwa oder die Abschiebung in Folterstaaten wie Syrien, wo brutale Verhörmethoden gang und gäbe sind. Im November reisten mehrere BND- und BKA-Mitarbeiter nach Syrien, um Zammar im Gefängnis zu verhören."
Diesem Vorgehen der Geheimdienste entspricht übrigens auch die Abschiebepraxis Deutschlands, die leider keinen Platz in dem Buch fand. Fälle wie jener des abgewiesenen kurdischen Asylwerbers Xalid Mio Kenco, der nach seiner Abschiebung im September 2009 in Syrien verhaftet wurde, weil er sich allein aufgrund seines Asylantrags strafbar gemacht hatte, hätten die Kollaboration Deutschlands mit dem syrischen Folterregime weiter unterstrichen.
Fest steht: Solange das Regime fest im Sattel saß, kam aus dem demokratischen Westen keine Kritik am Umgang mit Regimegegnern. Im Gegenteil, man nutzte den mangelnden Respekt vor Menschenrechten für eigene Zwecke.
Deutlich wird bei der Lektüre einmal mehr, dass nicht Menschenrechte, sondern die außenpolitische Orientierung Syriens entscheidend für die westliche Syrien-Politik war und ist. Insbesondere Damaskus' Verhältnis zum Verbündeten Iran und zum Hauptfeind Israel spielt dabei eine Rolle. Ähnlich wie beim Iran steht auch im Falle Syriens die Frage nach einem geheimen Atomreaktor, der 2007 von der israelischen Luftwaffe zerstört worden sein soll, im Mittelpunkt des Interesses. Im Frühjahr bestätigte die IAEA, dass sich in der Anlage Uran befunden hatte. Syrien drohe nun, "womit sein Verbündeter Ahmadinejad bereits seit Jahren konfrontiert ist: ein strenges Überwachungssystem durch die UN-Aufsichtsbehörde."
Es sei denn, das Regime fällt schneller, als es der Autor des Buches erwartet hatte. Wer sich für die Hintergründe dieser Entwicklung interessiert, wird bei Markus Bickel jedenfalls fündig.