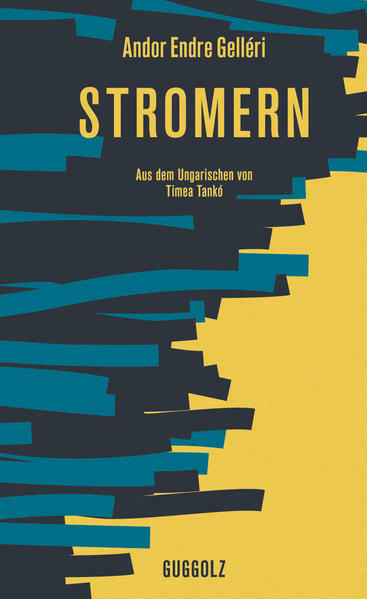Ein feenhafter Realist in fragwürdigen Vierteln
Ulrich Rüdenauer in FALTER 41/2018 vom 10.10.2018 (S. 8)
Die neue Übersetzung der Erzählungen von Andor E. Gelléri (1906–1945) laden zur Wiederentdeckung des Autors ein
Wie viele Väter hatte auch der von Andor Endre Gelléri keinen Sinn für die Träumereien seines Sohnes. Papa Gelléri, der Schlosser war und mit Panzerschränken reüssieren wollte, nötigte seinen 15-jährigen Filius, etwas Anständiges zu lernen. Der hat sich stattdessen in allerlei Berufen verdungen – ein Fluch, der zugleich auch ein Segen war. Denn was er unter Arbeitern erlebte, floss direkt in seine Texte ein. Die schlecht beleumundeten Viertel Budapests kannte er von klein auf. Er wusste, wie rau und elend diese waren, dass dort aber auch Wünsche und Fantasien gediehen. Er machte diese Welt literaturfähig.
Die 20er- und 30er-Jahre, in denen Gelléris Geschichten entstanden, waren eine Zeit der wirtschaftlichen Krisen und Nöte. Wer Arbeit hatte, wurde schamlos ausgebeutet. In seinen Erzählungen und Novellen – mehr als 100 davon sollte er bis zu seinem Tod verfassen – wandte Gelléri sich diesem proletarischen Milieu zu. Aber nicht als Ankläger, sondern als Beobachter. Und sparte nicht mit Witz und Ironie, denn in allem Leid sah er immer auch das Absurde, das Bizarre, manchmal sogar das Glück.
Dieses war auch dem Autor selbst zunächst durchaus hold. Redakteure einflussreicher Literaturzeitschriften wurden auf diesen aufmerksam. Gelléri hatte mit seinen Erzählungen Erfolg. Er veröffentlichte kontinuierlich, und auch wenn er davon nicht leben konnte, so pries man doch sein Talent. Der Schriftsteller Dezső Kosztolányi lobte den „feenhaften Realismus“ des Kollegen. Was diese seltsam paradoxe Kombination bedeutet, kann man gerade in seinen Erzählungen entdecken. Sie liegen nun in einer Auswahl und in der Übersetzung von Timea Tankó vor.
Gelléris Geschichten handeln von Arbeitern und kleinen Angestellten wie Vera, die in einem Musikgeschäft tätig ist, von der eigenen Mutter vernachlässigt und von ihrem Chef schikaniert wird, bis sie eines Tages die Ungerechtigkeit nicht länger erträgt und diesem die Meinung geigt – was natürlich ihre Entlassung zur Folge hat. Vera erlebt sie als Befreiung. Und befreiend wirkt auch der Gedanke, nun endlich das Unvorstellbare tun zu können und Tänzerin zu werden.
Auch wenn es gewiss eine Illusion bleiben wird – es ist ein Moment der Selbstermächtigung, der dem schreibenden Schlossersohn Andor Endre Gelléri recht vertraut gewesen sein dürfte. Immer wieder beschreibt er den Augenblick, in dem die detailgenau gezeichnete Wirklichkeit ins, pathetisch ausgedrückt, Utopische umschlägt. Und es gibt jene Kippmomente, die vom Realistischen unvermittelt ins Groteske führen. Oder ins Poetische. Ins Verzauberte.
Dass die Wirkung dieser Texte so stark und frisch ist, hat aber auch mit der Übersetzung zu tun. Das merkt man, wenn man sie mit einer Auswahl von Erzählungen vergleicht, die 1969 unter dem Titel „Budapest und andere Prosa“ erschienen ist. Übertragen hat diese Barbara Frischmuth, und nicht immer sind Schriftsteller auch die besseren Übersetzer. Vielleicht, weil sie zu sehr ihrem eigenen Ton verhaftet bleiben. Timea Tankó jedenfalls nimmt sich größere sprachliche Freiheiten, ihre wagemutigere Übersetzung besticht durch Rhythmus und Eleganz.
Man müsse, so hat Tankó angemerkt, Gelléris Texte nicht aus dem Ungarischen, sondern aus dem Gellérischen übersetzen. Das gilt auch für den einzigen Roman des Autors, „Die Großwäscherei“, der vor drei Jahren im Guggolz Verlag erschienen ist. Als dieses Buch erstmals herauskam, war der 1906 in Budapest geborene Gelléri gerade einmal 24 Jahre alt. Nur 15 Jahre sollte er da noch zu leben haben.
Als Jude musste Gelléri ab 1940 Zwangsarbeit leisten. Damals begann er, an einem autobiografischen Roman zu schreiben. Er starb kurz nach der Befreiung des KZs Mauthausen, in das er nach der deutschen Besetzung Ungarns deportiert worden war, an einer Typhusinfektion. Es ist ein schmales Werk, das er hinterlassen hat. Aber es ist ein großes Vermächtnis – das hoffentlich bald zur Gänze auf Deutsch vorliegen wird.