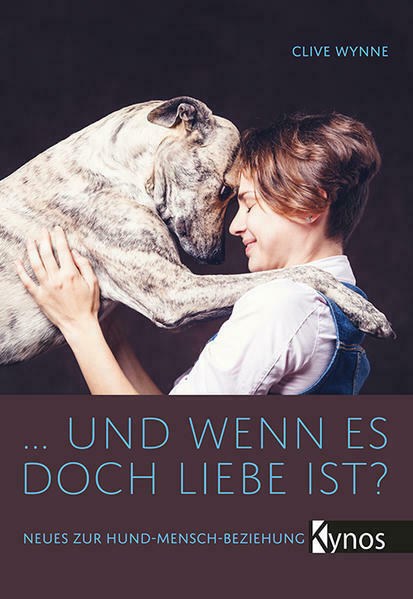Wann ist ein Hund ein Hund?
Katharina Kropshofer in FALTER 15/2023 vom 12.04.2023 (S. 43)
Das Leckerli wartet in der hohlen Hand. Dafür muss Mia nur brav an der Leine gehen, sich auf Befehl setzen. Standardrepertoire für jeden halbwegs routinierten Hund. Doch für Mia ist das trotzdem eine große Sache. Denn sie ist eine Füchsin.
Seit 1959 läuft in Nowosibirsk, einer Stadt im Süden Sibiriens, ein ungewöhnliches Experiment: Der Genetiker Dmitri Beljajew wollte vor über 60 Jahren verstehen, wie Hunde zahm wurden, domestiziert, zum besten Freund des Menschen. Denn weder in den Tiefen der Sowjetunion noch sonst wo wussten wir damals mit Sicherheit, dass der Hund vom Wolf abstammt.
Und erst recht nicht, wie die wundersame Verwandlung vom wilden Waldtier zum folgsamen Schoßhund vonstatten ging. Beljajews Idee: Füchse züchten, Verwandte des Hundes, um so zu verstehen, wie schnell die Domestizierung voranschreitet. Evolution im Schnellkochtopf. Und was diese Entwicklung nicht nur für die Tiere, sondern auch für uns Menschen bedeutet.
"Gäbe es keine Domestizierung, würden maximal ein paar Millionen Menschen auf diesem Planeten leben", sagte Greger Larson, Archäologe und Genetiker an der renommierten Universität Oxford, dem Magazin The Atlantic. "Stattdessen haben wir sieben Milliarden, Klimawandel, die Möglichkeit zu reisen, Innovation." Die Domestizierung wilder Tiere hat die Erde und ihre Bewohner also massiv verändert.
Nicht erst vor 10.000 Jahren, als Menschen sesshaft wurden und begannen, Tiere für Landwirtschaft oder als Transporttiere zu halten. Im Sandstein einer Klippe, dort in der Wüste des heutigen Saudi-Arabien, sieht man es schwarz auf rot: ein Jäger begleitet von 13 Hunden, um seine Hüfte und um den Hals der Tiere haben die alten Ägypter eine Art Leine gezeichnet.
Wegen dieser 8000 Jahre alten Zeichnung und in Höhlen gefundener Hundeschädel glauben viele Forscher, dass die Beziehung zwischen Mensch und Hund schon vor 35.000, mindestens aber 15.000 Jahren begann. Vielleicht sogar zweimal, parallel, im westlichsten und östlichsten Teil Eurasiens. Der Wolf wird schließlich nicht innerhalb weniger hundert Jahre zum Hund.
Noch bevor es also Literatur oder Mathematik gab, er Pflüge oder Bronze verwendete, Reis oder Weizen anbaute, dürfte sich der Mensch schon mit einer anderen Spezies angefreundet haben. Mensch und Wolf begannen gemeinsam, Mammuts und andere Tiere zu jagen, Steinzeitmenschen zogen Wolfsbabys auf, züchteten die besonders zahmen weiter, so die Hypothese. Und mit der Zeit wurden die Wolfsohren schlapp, Pfoten, Schädel, Zähne kleiner, und für den Urmenschen entscheidend: Die Tiere wurden freundlicher.
Sie waren glücklich miteinander: der Mensch, der plötzlich einen Beschützer, irgendwann auch einen Hirten, Blindenführer, Krebserschnüffler, Therapiehund und immer Kompagnon hatte. Hundebesitzer haben weniger Allergien, ein widerstandsfähigeres Mikrobiom, laut manchen Studien sogar weniger Depressionen. Und der zum Hund gewordene Wolf, der sich nicht mehr durch die harsche Wildnis schlagen musste, stattdessen Essensreste bekam und am warmen Feuer sitzen durfte.
Auch Schimpansen oder Elefanten können in menschlicher Gesellschaft leben - ob ein Tier aber wirklich domestiziert, also nachhaltig an das gemeinsame Leben angepasst ist, verraten erst seine Gene.
Höhlenmalereien nahe der spanischen Küstenstadt Valencía zeigen zum Beispiel, wie ein Mann schon vor 8000 Jahren Honig erntet. Heute sind Honigbienen so gezüchtet, dass sie mehr ihrer süßen Masse produzieren, resistent gegenüber vielen Krankheiten sind. Mäuse im Central Park können durch angepasstes Erbmaterial fettiges Menschenessen verdauen, manche Vogelarten singen in der Stadt lauter als ihre wilden Cousins, damit sie ihre Artgenossen auch über dem Straßenlärm hören können. Die Gene von Katzen sind dafür noch viel wilder, als man meint, ähnlich denen von Jaguar oder Tiger - Jahrhunderte des Zusammenlebens mit Menschen haben sie nicht weiter beeindruckt.
Was also macht nun den Hund zum Hund? Zu 350 verschiedenen Rassen von Chihuahua bis Golden Retriever, zu schätzungsweise 300 Millionen Exemplaren, die heute als Haustiere leben?
"Ich sage immer, sie sind die Gewinner der Herzen und nicht des Verstandes", hat der Verhaltensforscher Clive Wynne der Autorin vor fünf Jahren erzählt. Für die Arizona State University vergleicht er Hunde und Wölfe in Experimenten, auch in Kooperation mit dem WolfScienceCenter im niederösterreichischen Ernstbrunn. Der Verhaltensbiologe Kurt Kotrschal ist damit berühmt geworden. Wynnes Erkenntnis: Intelligenz zeichnet den Hund nicht aus, beim Problemlösen gewinnen meist die Wölfe.
Aber Hunde schlagen ihre Verwandten in Beziehungsfragen. In einem frühen Experiment bekamen Hunde ein Leckerli, sobald sie die Menschenhand kurz mit ihrer Schnauze berührten oder nachdem sie kurz gestreichelt, gelobt wurden. Später rannten die Hunde immer zuerst auf die Gruppe Menschen zu, die extra freundlich zu ihnen gewesen war. Sie verzichteten sogar kurzfristig auf Futter, um ihre Besitzer zu begrüßen. Hunde wollen uns einfach gefallen.
"Hyper sociability" nennt Wynne dieses Verhalten als Forscher, als Hundebesitzer einfach "Liebe". Das sieht man sogar in drei veränderten Stellen in ihrem Erbgut: Sie machen die Tiere distanzloser, extrovertiert - kurz: freundlicher als Wölfe. Hunde können diese Bindung biologisch gesehen auch zu anderen Tieren aufbauen, der Mensch hat sich nur quasi ein Monopol geschaffen.
Heute ist diese Liebe auf beiden Seiten grenzenlos: Menschen bestellen Gemälde ihres Haustiers, stricken ihnen Mäntelchen, zahlen tausende Euro für Hundetrainer oder lebenserhaltende Maßnahmen. Und wenn alles nichts mehr hilft, dann lassen sie das verstorbene Tier eben klonen. Besitzer in den USA, die besonders an ihren felligen Begleitern hängen, blechen bis zu 50.000 Dollar, um eine genetisch idente Kopie ihres Tieres zu bekommen.
Doch obwohl viele Forscher die Hundwerdung seit Jahrzehnten erforschen, wissen sie vieles noch nicht: Wenn Wölfe schon zu Hunden wurden, könnte es nicht auch bei ihren hundeartigen Verwandten, den Füchsen, passieren? Zurück nach Sibirien. Dmitri Beljajew wollte beweisen, dass jede Domestizierung dasselbe Erfolgsrezept hat: immer die ruhigsten, dem Menschen am wohlsten gesinnten Tiere auszuwählen. Oder zumindest jene, die einem in unaufmerksamen Momenten nicht in den Kopf bissen.
Also reiste Beljajew von Farm zu Farm, kaufte die zahmsten Silberfüchse der Gegend auf, dazu holte er einige von kanadischen Pelzfarmen. Und begann seine wegweisende Arbeit für das Institut für Zytologie und Genetik in Nowosibirsk. Er verpaarte die wenig aggressiven Füchse miteinander, Doggy Style.
Innerhalb von sechs Generationen ließen sich die Tiere hochheben und streicheln, begannen mit dem Schwanz zu wedeln. Nach zehn Generationen waren 18 Prozent der Füchse Teil dieser zahmen Gruppe. "Wie Hunde suchen diese Füchse den Kontakt mit bekannten Personen, kommen ihnen nahe und schlecken Hände und Gesichter ab", schrieb Beljajew 1979.
Heute, mehr als 60 Jahre und Dutzende Generationen später, sind 70 bis 80 Prozent der Silberfüchse des russischen Experiments "domestiziert". Und nicht nur ihr Verhalten änderte sich: Die Ohren der zutraulichen Füchse bleiben als Welpen länger hängen. Ihre Schnauzen sind hundeähnlicher, sie haben weniger Stresshormone, dafür mehr vom "Glückshormon" Serotonin im Blut. Der starke Jagdinstinkt hat sich aber noch gehalten, ganz stubenrein sind sie auch nicht zu machen, und sie stinken, ähnlich wie Moschus. Die sibirischen Füchse sind wohl zahm, als perfekte Haustiere gelten sie noch nicht.
Eine wichtige Frage scheint Beljajews Versuch trotzdem zu beantworten: Die Veränderungen zeigen sich nicht nur im Verhalten, man sieht sie auch. Charles Darwin nannte dieses Phänomen, wonach mit charakterlicher Milde körperliche Merkmale einhergehen, "domestication syndrome". Und das kann auch ganz von selbst kommen: Britische Forscher fanden etwa heraus, dass ans Stadtleben angepasste Füchse plötzlich ähnliche Merkmale zeigten: einen stärkeren Biss, um Menschenmüll besser fressen zu können, kürzere und breitere Schnauzen, kleinere Gehirne als ihre ruralen Cousins. Das Resultat menschlicher Nähe. Schließlich mussten auch die Stadtfüchse ihre Angst vorm Menschen überwinden, um zu seinen Abfällen zu kommen.
Und heute? Kann man sich natürlich fragen, ob die Mensch-Hund-Allianz für beide Seiten die gleichen Vorteile bringt. Ob Hunde, die teilweise bessere Leben führen als manche Menschen, unter den Shows, der Mode, der manchmal zwanghaften Nähe, nicht auch leiden. Eines ist jedenfalls klar: Die Geschichte, wie Hunde - und zum Teil auch Füchse - unsere Gefährten, ja Freunde und Familienmitglieder wurden, erzählt auch davon, wie der Mensch seine Umwelt prägt, einst wilde Tiere und Orte gezähmt hat. Viel mehr ist es also eine Geschichte darüber, wie der Mensch überleben konnte, sich Vorteile in seiner Umwelt verschaffte, in dem er (Zweck-)Beziehungen mit anderen Arten einging.
Und das bis heute macht. Kein Wunder, dass Kurt Kotrschal es in einer Fachzeitschrift so ausdrückt: Eine Welt, die sich immer mehr beschleunigt, hat massive Auswirkungen auf unsere physische und mentale Gesundheit. Und wer könnte Menschen nicht wieder mit den wesentlichen Dingen in Kontakt bringen wenn nicht Hunde als "soziale Schmiermittel"?
In dieser Rezension ebenfalls besprochen: