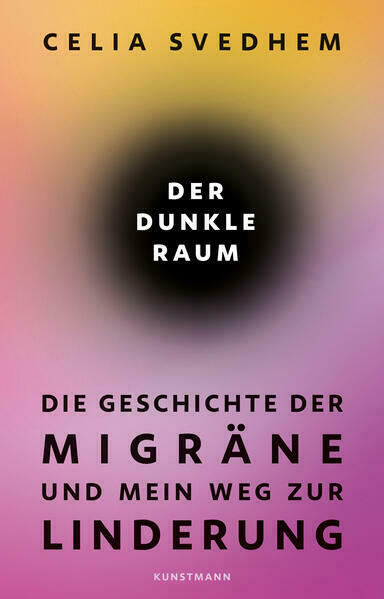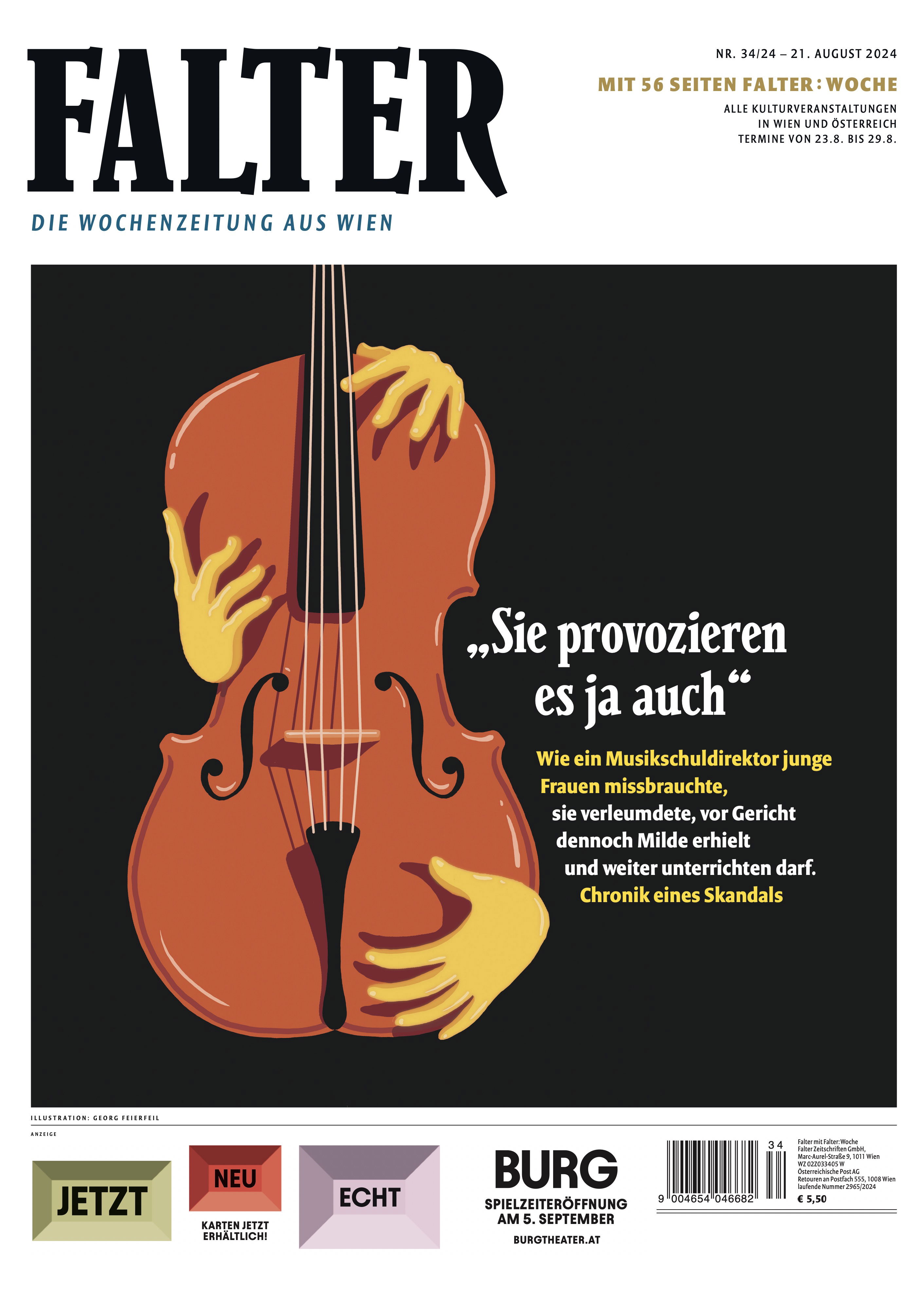
Roter Dampf hinter den Lidern
Anna Goldenberg in FALTER 34/2024 vom 21.08.2024 (S. 35)
Nicht einmal im Bett aufsetzen durfte sie sich allein. Der englischen Schriftstellerin Virginia Woolf war Neurasthenie diagnostiziert worden, eine "Überlastung des Nervensystems". Die Symptome: Kopfweh, das gemeinsam mit Übelkeit sowie mit einer Überempfindlichkeit gegenüber Licht und Geräuschen auftrat. Die Behandlung: strenge Bettruhe, und zwar für sechs bis acht Wochen. Neben dem Aufsetzen hatte auch das Umdrehen nur unter ärztlicher Aufsicht zu geschehen.
Vielleicht hätte die Schriftstellerin, die 1941 im Alter von 59 Jahren Suizid beging, ein erfüllteres Leben gehabt, wenn ihre Krankheit richtig diagnostiziert worden wäre. Liest man ihre Aufzeichnungen heute, scheint es nämlich naheliegend, dass Woolf an Migräne litt.
Von der chronischen neurologischen Krankheit, die wiederkehrende Kopfschmerzattacken verursacht, sind weltweit rund eine Milliarde Menschen betroffen, schätzt die Weltgesundheitsorganisation (WHO). In Österreich sind es rund eine Million Menschen.
Schon rund 9000 Jahre alte Schädel zeugen von Versuchen, das hämmernde, oft auf einer Seite auftretende Kopfweh in den Griff zu bekommen: Damals bohrte man den Patienten ein Loch in die Schädeldecke. Vor 2400 Jahren beschrieb der Arzt Hippokrates im alten Griechenland erstmals einen Migräneleidenden; er empfahl Abführmittel zur Linderung.
Anders als zu Virginia Woolfs Zeiten bietet die moderne Medizin des 21. Jahrhunderts zwar schon deutlich bessere Behandlungsmöglichkeiten; von einer Heilung ist die Forschung aber noch weit entfernt. Dennoch wurden in den vergangenen Jahren enorme Fortschritte gemacht. Welche Ansätze sind vielversprechend?
Die Zeiten, in denen Migräne als Leiden "hysterischer" Frauen abgetan wurde, scheinen vorbei. Stattdessen wächst das Bewusstsein, dass das Problem ein gesellschaftlich relevantes ist, betrifft Migräne doch vor allem Menschen zwischen 15 und 50 Jahren; jene also, die mitten im Leben stehen. Kopfschmerzerkrankungen gehören nach Schlaganfall und Demenz zu jenen Leiden mit der höchsten Krankheitslast. So misst die WHO, wie stark ein beschwerdefreies Leben beeinträchtigt wird.
Die Medizin unterscheidet die drei häufigsten Migräneformen: jene mit Aura, also Sichteinschränkungen. Rund 15 bis 20 Prozent der Migränebetroffenen haben sie. Am meisten verbreitet ist die Migräne ohne Aura. Die schwerste Form ist die chronische Migräne, bei der es mehr Tage mit als ohne Kopfschmerzen gibt. Migräne ist zumindest teilweise erblich, auch wenn die genetische Grundlage noch nicht entschlüsselt ist. Umweltfaktoren wie grelles Licht, Lärm, aber auch Stress oder Schlafmangel können Attacken auslösen.
Mit 16 Jahren hatte sie ihre erste Attacke, nun sind es bei der Anfang 30-Jährigen bis zu 18 Tage im Monat, an denen sie mehrere Stunden schwere Kopfschmerzen hat. Die schwedische Psychotherapeutin Celia Svedhem erzählt im kürzlich erschienenen Buch "Der dunkle Raum" ihren Leidensweg: "Der Schmerz explodiert in meinem Kopf. Roter und beigefarbener Dampf hinter meinen Lidern."
Svedhem ist in vielen Aspekten eine typische Betroffene. Zunächst einmal aufgrund ihres Geschlechts. "Frauen sind rund dreimal so häufig betroffen wie Männer", sagt Christian Wöber. Er leitet die Kopfschmerzambulanz an der Universitätsklinik für Neurologie des AKH Wien und ist Koautor eines neuen Buchs über Kopfschmerzen. "Weibliche Geschlechtshormone begünstigen die Migränebereitschaft", sagt Wöber.
Welche Rolle das weibliche Sexualhormon Östrogen exakt spielt, ist ebenso wenig restlos geklärt wie die Frage, wie Migräne im Gehirn eigentlich entsteht. Als gesichert gilt mittlerweile, dass Migräne über das Nervensystem vermittelt wird. Der Schmerz entsteht durch eine Entzündungsreaktion in der Hirnhaut. Ein wichtiger Botenstoff, der diese Entzündung auslöst, ist eine körpereigene Substanz, ein Eiweißmolekül, Calcitonin Gene-Related Peptide, das als CGRP abgekürzt wird.
CGRP wurde zwar bereits 1985 entdeckt, doch die Arzneimittelindustrie interessierte sich lange nicht für dieses Peptid, sondern setzte auf einen anderen Botenstoff, der sich aber als wirkungslos herausstellte. Erst in den 2000ern wandte man sich wieder CGRP zu.
Die CGRP-Ausschüttung scheint mit dem Geschlechtshormon Östrogen in Zusammenhang zu stehen. "Die Östrogenentzugshypothese gibt es seit den 1970ern", sagt Bianca Raffaelli, Oberärztin an der Berliner Universitätsklinik Charité. "Sie besagt, dass der Östrogenabfall, zum Beispiel vor der Menstruation, nach der Geburt oder in der Pillenpause, zu vermehrten Migräneattacken führt."
Das passt zu epidemiologischen Daten: Vor der Pubertät sind Buben und Mädchen gleich häufig betroffen; dann trennen sich die Leidenswege - vermutlich weil bei Männern die Geschlechtshormone nicht so stark schwanken wie bei Frauen. Männer haben zudem nur sehr wenig Östrogen. Rund sechs Prozent der Frauen im gebärfähigen Alter leiden an menstrueller Migräne, bekommen also Attacken nur rund um ihre Monatsblutung. Im höheren Alter, wenn Frauen den Wechsel hinter sich haben, gleichen sich die Zahlen wieder an.
Experimentell nachgewiesen werden konnte der Zusammenhang zwischen CGRP und Östrogen lange nicht. Bis Raffaelli 2023 im renommierten Fachjournal Neurology eine Studie veröffentlichte. Ihrer Forschungsgruppe war es erstmals gelungen, die CGRP-Konzentration bei Frauen mit und ohne Migräne zu messen, und zwar über verschiedene hormonelle Zustände hinweg. Rund um den Eisprung ist der Östrogenspiegel am höchsten und bei Beginn der Menstruationsblutung am niedrigsten.
Die Höhe des CGRP-Spiegels wurde in der Tränenflüssigkeit gemessen. "Wenn der Östrogenspiegel zur Einleitung der Periode sinkt, schütten die Migränepatientinnen vermehrt CGRP aus", sagt Raffaelli. Während der Menstruation hatten Migränepatientinnen also einen deutlich höheren CGRP-Spiegel als gesunde Frauen.
Auf CGRP setzte auch die Forschung ihre Hoffnung. Denn wenn man den Botenstoff, der Migräne verursacht, ausschaltet, lässt sich die Häufigkeit der Attacken reduzieren. "Lange Zeit hieß es, man kann nichts dagegen tun", sagt Gregor Brössner, Leiter der Kopfschmerzambulanz an der Universitätsklinik für Neurologie der Medizinischen Universität Innsbruck. Behandelt wurden lediglich die Kopfschmerzen selbst, von Vorbeugung oder gar Heilung war man weit entfernt.
"In den vergangenen sechs, sieben Jahren kamen so viele Medikamente auf den Markt wie in den letzten 50 Jahren", sagt Brössner, eine Entwicklung, die auch andere neurologische Erkrankungen betrifft. Die wichtigsten neuen Mittel enthalten monoklonale Antikörper. Antikörper sind Proteine, die das menschliche Immunsystem normalerweise selbst herstellt. Monoklonal heißt, dass sie ein bestimmtes Ziel, beispielsweise einen Erreger, erkennen. Das macht sie besonders wirkungsvoll -aber auch schwierig zu entwickeln, weil sie sehr passgenau sein müssen. Im Einsatz sind sie bereits in der Krebstherapie und bei Autoimmunerkrankungen.
Der erste monoklonale Antikörper gegen das migräneauslösende CGRP wurde 2018 zugelassen. Mittlerweile sind in Österreich vier Mittel auf dem Markt. Das Präparat wird einmal im Monat gespritzt. "Wenn ich morgens aufwache, fühle ich mich okay. Und so bleibt es meist den ganzen Vormittag", schreibt die Schwedin Svedhem, die ebenfalls einen Antikörper nimmt. "Gegen Mittag setzt die Migräne zwar wieder ein, verschwindet aber über Nacht, wenn ich schlafe."
"Es ist kein Allheilmittel", sagt Brössner, dessen Forschungsgruppe an zwei klinischen Zulassungsstudien beteiligt war. "Aber für 70 bis 80 Prozent reduziert es die Häufigkeit der Anfälle um die Hälfte."
Dass nicht alle Migränebetroffenen darauf ansprechen, hat damit zu tun, dass CGRP nicht der einzige Botenstoff ist, der Migräne auslöst. Die Suche nach weiteren Botenstoffen läuft; neuere Studien deuten etwa darauf hin, dass das Peptid PACAP eine Rolle spielen könnte. "Da wird sich in den nächsten Jahren sicher einiges tun", sagt der Wiener Neurologe Wöber.
Seit vielen Jahren sind blutdrucksenkende Betablocker, Epilepsiemedikamente und Antidepressiva als vorbeugende Medikamente im Einsatz. Sie helfen einigen Patienten; Neben-und Wechselwirkungen sind aber oft ein Problem.
Eine solche medikamentöse Migränevorbeugung, sei es mit etablierten Medikamenten oder monoklonalen Antikörpern, empfiehlt der Neurologe Wöber, wenn Migräneattacken an vier oder mehr Tagen pro Monat auftreten und nichtmedikamentöse Maßnahmen nicht wirken. Welche zum Beispiel? "Entspannungstechniken, Akupunktur, ausreichendes Trinken, regelmäßige Mahlzeiten, genug Schlaf und Ausdauersport."
Schmerzstillende Medikamente brauchen alle Betroffenen dennoch. Die Zeiten, in denen, wie im 11. Jahrhundert empfohlen, ein Maulwurf um den Kopf gebunden wurde oder, wie im 18. Jahrhundert üblich, ein Blutegel hinter dem Ohr angelegt wurde, sind glücklicherweise längst vorbei.
Die Wirkstoffgruppe der Triptane kennt man seit den 1990ern; sie wurden gezielt gegen Migräne entwickelt. Das Medikament muss möglichst am Anfang der Episode eingenommen werden. In der Praxis kommen Triptane aber wenig zum Einsatz. Eine Studie der Medizinischen Universität Wien, an der auch Wöber beteiligt war, erhob alle Triptanverordnungen in Österreich: Gerade einmal 33.000 Menschen bekamen die Medikamente. "Rechnet man hoch, dass in Österreich rund zehn Prozent der Bevölkerung an Migräne leiden, erhalten nur sechs Prozent der Betroffenen diese Medikamente", sagt Wöber.
Warum? Es mag jene geben, die mit herkömmlichen Schmerzmitteln wie beispielsweise Aspirin gut auskommen. Andere, bei denen Nebenwirkungen wie etwa Müdigkeit auftreten. "Außerdem hatten Triptane von Anfang an eine schlechte PR", sagt Wöber.
Wegen einer geringen gefäßverengenden Wirkung sei ein erhöhtes Schlaganfall-und Herzinfarktrisiko befürchtet worden. Doch eine riesige dänische Studie mit 450.000 Migränepatienten zeigte ein verschwindend geringes Risiko.
Bleibt eine weitere Erklärung: die Unterdiagnose. Vor allem bei Männern. Die, erzählt Wöber, verirrten sich deutlich seltener in seine Ambulanz als Frauen. "Sie denken sich, ich habe halt hin und wieder mal Kopfweh." Bis zur kompletten Heilung wird es noch dauern; aber wochenlange Bettruhe ohne Umdrehen gibt es zum Glück nicht mehr.
In dieser Rezension ebenfalls besprochen: