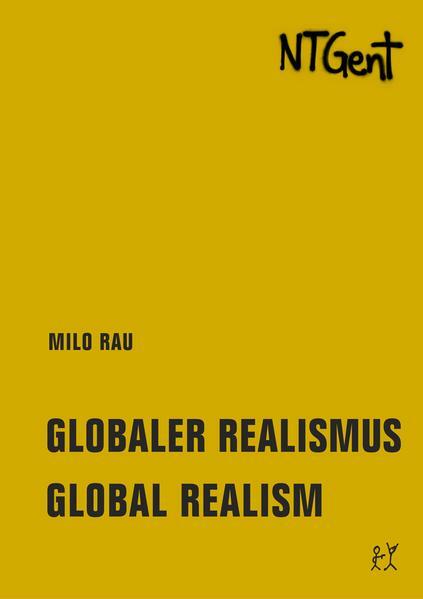Der Aktivist der Herzen
Matthias Dusini in FALTER 23/2019 vom 05.06.2019 (S. 28)
Der Schweizer Theatermacher Milo Rau, einer der herausragenden Künstler der Gegenwart, kommt mit einem Stück über Krieg nach Wien. Wer ist der Kunstextremist, der gerne Grenzen verletzt?
Das Parfum wurde Leila zum Verhängnis. Ein IS-Kämpfer kam in ihre Schulklasse, um nach einer Frau zu suchen. Der Duft zog ihn an. Ein mehrjähriges Martyrium begann: Zwangsheirat, zweifache Schwangerschaft, Todesangst. Die Tragödie wäre im Strudel der Zeit verschwunden, wenn sie der Theatermacher Milo Rau nicht eingefangen hätte. Leilas Geschichte gehört zu den Stimmen aus der Hölle, die Rau in „Orest in Mossul“ auf die Bühne bringt.
Der Autor, Filmemacher und Regisseur Milo Rau, 42, gehört zu den interessantesten Künstlern der Gegenwart. „Orest in Mossul“, das nach der Uraufführung am Nationaltheater Gent (NTGent) auch bei den Wiener Festwochen zu sehen ist, verlagert einen antiken Tragödienstoff in die kriegszerstörte Millionenstadt am Tigris. Gemeinsam mit dem Genter Ensemble und Schauspielschülern aus Mossul entwickelte Rau im vergangenen Winter ein Stück zum Thema Rache.
In der antiken Vorlage, der Trilogie
„Orestie“ des griechischen Dichters Aischylos (525–456 v. Chr.), opfert ein Vater im Krieg seine Tochter. Die Gattin ermordet den Ehemann, ehe der Sohn Orest seinen Vater rächt. Vor dem Hintergrund endlosen Blutvergießens stellte Aischylos die Frage: Wer verzichtet auf Sühne, um Versöhnung zu ermöglichen?
In dem vom Islamischen Staat terrorisierten Mossul bekommt der Klassiker eine brutale Gegenwärtigkeit. Die Storys der Überlebenden wirken wie Zitate aus dem Original. Die Schauspieler lebten während der Proben in ständiger Angst vor Anschlägen. Filmaufnahmen von den Ruinen und Hinrichtungsplätzen begleiten die Theateraufführung. Das Team probte auf einem Dach, von dem Homosexuelle in den Tod gestürzt wurden. Das Rauschen des Realen grundiert den Raum der Imagination.
Ein Ideal der Theatergeschichte ist die ästhetische Erziehung, durch Einfühlung in das Geschehen Emotionen auszulösen und damit das Denken zu verändern. Rau kommt dieser Absicht nahe. Ein melancholischer Popsong verleiht dem Drama Pathos. Spätestens sobald die Stimme Leilas zu hören ist, die gegenwärtig, obwohl selbst ein Opfer, in einem Gefangenenlager für IS-Familien lebt, springt der Funke über. Eine leise Stimme aus dem Handy: „Ich will zu meiner Familie zurück, aber sie hat mich verstoßen.“
„Die ‚Orestie‘ ist der Klassiker schlechthin“, sagt Milo Rau. „Wir sind aber nicht mehr imstande, in ihren tieferen Sinn einzudringen, der eine soziale Frage stellt: Sollen wir die Spirale der Gewalt fortsetzen oder aufhören?“ Mossul war für ihn ein Hilfsmittel, um ein Werk zu verstehen, das ihm sehr entfernt vorkam. Das Grauen bekam ein Gesicht.
Das Gespräch mit Milo Rau findet nach der Nachmittagsvorstellung im Genter Direktionszimmer statt. Es ist Sonntag, und obwohl er eigentlich bei der Freundin und den beiden Töchtern in Köln sein sollte, hat Rau einen Probentag hinter sich. Das neue, für 2020 geplante Stück „Familie“ beschäftigt sich mit einem realen Verbrechen; eine Mutter wollte nach der Scheidung ihre Kinder ermorden. Zugleich bereitet der Regisseur einen Film über süditalienische Landarbeiter vor, eine Aktualisierung der Jesus-Passion.
Rau blättert in dem frischgedruckten Filmtreatment, in dem ein Foto des italienischen Filmemachers Pier Paolo Pasolini zu sehen ist. Pasolini drehte ebenfalls in der Höhlenstadt Matera einen Jesusfilm und wie Rau tauchte er in die Moderne ein, um die Antike zu verstehen. In der Kritik an Konsum und kapitalistischer Ausbeutung schwingt bei beiden die Sehnsucht nach einem authentischen Leben außerhalb der westlichen Metropolen mit.
Rau spricht entspannt, ohne missionarischen Unterton. Ob in Mossul, bei einer Premiere oder beim Interview; man sieht Rau nie anders als in T-Shirt, Jeans und Sneakers. Wie ein guter Reporter besitzt er die Fähigkeit, sofort eine Nähe zum Gegenüber aufzubauen. Ein Schmunzeln begleitet die Ausführungen. So klingen Raus Polemiken weniger schneidend; das traditionelle Theater und der liberale Westen sind seine Lieblingsgegner.
Er bezeichnet die Auseinandersetzung zwischen Linken und Rechten als „Zickenkrieg zwischen Bürgern der Komfortzone“ und den Humanismus als Ideologie für Privilegierte. „In der Welt, in der wir sind, sind wir Europäer die Arschlöcher, und zwar durch Geburt.“ Da das aus Migranten und Flüchtlingen bestehende Subproletariat, dort wir, die Aristokratie des Wohlstands. In der Mitte der Künstler als Schmerzensmann, der sich bußfertig die Dornenkrone aufsetzt.
Statt Hermann Hesse las Rau in jungen Jahren Trotzki und Lenin. Mit 19 verliebte er sich in eine Zapatistin und ging in den mexikanischen Urwald, um sich für die Rechte der indigenen Bevölkerung einzusetzen. Zurück in der Schweiz, organisierte Rau Studentendemos gegen die Privatisierung des öffentlichen Sektors.
Er studierte in Paris bei dem Soziologen Pierre Bourdieu und reiste nach Afrika, Russland und Südamerika. „Damals begann ich, an dem zu arbeiten, was ich heute den globalen Realismus nenne: an der Beschreibung des weltumfassenden Innenraums des Kapitals.“ Für Rau gibt es weder Westen noch Osten noch Süden, sondern ein einziges, von Profitinteressen beherrschtes Ganzes.
Wenn die Revolution schon nicht auf der Straße stattfindet, dann zumindest drinnen im Theaterraum. So entstanden Stücke wie das 2015 uraufgeführte „Kongo Tribunal“. Rau reiste in den Ostkongo, wo seit 20 Jahren ein Bürgerkrieg tobt, der 20 Millionen Opfer forderte. Das Gebiet ist reich an Bodenschätzen, sodass die militärischen Auseinandersetzungen von den Interessen westlicher Firmen überlagert werden: Bürgerkrieg als Wirtschaftskrieg.
Rau gelang es, Opfer, Täter und Zeugen des Kongokrieges in einem Volkstribunal zu versammeln. Höchste Regierungs- und Militärvertreter reisten an. Auch wenn die Verurteilten keine strafrechtlichen Folgen zu befürchten hatten, bekamen die Bürger eine Vorstellung davon, was eine funktionierende Rechtsordnung sein könnte. Das westliche Publikum wiederum, das die Bühnen- und Filmadaption sah, erkannte im „Kongo Tribunal“ die verheerenden Folgen europäischer Politik.
Wie sein Freund Jean Ziegler betrachtet Rau den Neokolonialismus durch eine Schweizer Brille. In keinem anderen Land lägen Kapital und Verbrechen, Blut und Diamanten so eng beieinander wie in dem Bankenparadies. „Die Schweiz ist eine Möglichkeit, die sich aus dem Unglück anderer Weltregionen ergibt“, erklärt Rau. „Das Schlimmste, was dir hier passieren kann, ist, dass du kein Grundeinkommen kriegst oder dein Chef nicht lieb zu dir ist.“ Auf seinen Reisen erforscht er die Zusammenhänge zwischen Glück und Unglück sowie zwischen Reichtum und Armut. Aktion erscheint Rau wichtiger als kritische Theorie.
So wie in dem 2011 entstandenen „Hate Radio“, einem Stück über den Völkermord in Ruanda. Der Künstler recherchierte die Geschichte des Radiosenders RTLM, der 1994 eine wichtige Rolle bei der Eskalation der Gewalt spielte. Innerhalb weniger Monate wurden in dem zentralafrikanischen Staat eine Million Angehörige der Tutsi-Minderheit ermordet.
In der Zeit vorher hatten die RTLM-Moderatoren gegen die Tutsi gehetzt und zum Mord aufgerufen, dazwischen lief Popmusik. Rau rekonstruierte den giftigen Cocktail aus Fun und Gewalt und führte das Programm 2011 im ehemaligen Radiostudio in Kigali mit einheimischen Schauspielern auf. Ähnlich wie im „Kongo Tribunal“ inszenierte Rau ein kollektives Trauma als Drama, das die Grenze zwischen Realität und Fantasie verwischte. Das Verdrängte kehrte als verstörender Tagtraum wieder.
So will Rau die Empfindungen an das globale Nervensystem anschließen und jene Kluft verkleinern, die die Kunst von der Gesellschaft trennt: „Was unsere Wahrnehmungs- und Aktionsweisen angeht, liegen wir gut 50 Jahre hinter der Wirtschaft zurück.“
Das Label „dokumentarisches Theater“, das ihn mit Gruppen wie Rimini Protokoll verbindet, zielt an der Sache vorbei. Obwohl Rau mit dokumentarischem Material arbeitet, bilden die Zeitungsausschnitte und Gerichtsprotokolle die Wirklichkeit nicht nur ab. Reenactements (Wiederaufführungen) wie das „Hate Radio“ oder „Die letzten Tage der Ceaușescus“ über den Prozess gegen das rumänische Diktatorenpaar leben von den Reaktionen des Publikums, und auch die Textgattung bleibt offen. So verzichtet „Orest in Mossul“, obwohl es um Krieg geht, auf überwältigende Aktionen. In seiner pathetischen Langsamkeit erinnert es eher an melodramatische Opern.
Die Schauspieler selbst, ob Laien oder Profis, müssen sich auf radikale Brüche einstellen. Von Kindern verlangt Rau komplexe Monologe oder Küsse, also Dinge, die jungen Menschen erstmal unmöglich oder unangenehm erscheinen. Er verdonnert Schauspieler, die gern gestikulieren, zum Stillsitzen, damit sie die Macht kreisender Gedanken kennenlernen. 2012 ließ der Künstler die Verteidigungsrede des norwegischen Rechtsterroristen Anders Breivik von einer deutschtürkischen Schauspielerin vortragen. Die Zerstörung von Routinen als mentales Trainingsprogramm.
Einem Kriegsreporter nicht unähnlich, verlässt Rau gern die Schutzzonen. So entwickelte er in Mossul die Idee, Orest schwul sein zu lassen. Eine Kussszene in einer Stadt, in der Homosexuelle vor kurzem noch hingerichtet wurden, führte beinahe zum Scheitern der Produktion. Die einheimischen Schauspieler weigerten sich mitzuspielen. Sie fürchteten die tausenden Schläfer, die auf den Tag der Rache warten. Obwohl Rau versprochen hatte, den Kuss auf der öffentlichen Abschlusspräsentation nicht zu zeigen, zeigte er ihn doch. Das Süddeutsche Zeitung Magazin berichtet in einer Reportage über die Wut der Beteiligten.
Die Aktion berührt den wunden Punkt kultureller Aneignung. Dient sie dem Kitzel westlicher Abenteurer oder hilft sie den Menschen vor Ort? Rau meldet sich nach dem Erscheinen des SZ-Artikels noch einmal zu Wort. Man habe sich sehr wohl um die irakischen Kollegen gekümmert und nach wochenlangem Tauziehen auch Visa für zwei von ihnen bekommen. Auch im Kongo lässt Rau den Kontakt nicht abreißen; im Juli gehen die Tribunale weiter.
Nach zehn Jahren in der freien Szene war Rau zu Höherem berufen, er bekam ein Angebot vom Zürcher Schauspielhaus. Seine Stücke touren in verschiedenen Versionen durch die halbe Welt. Festivals wie der Steirische Herbst oder die Wiener Festwochen beteiligen sich an den Produktionskosten und bekommen dafür einen echten Rau, ohne dass der Künstler vor Ort arbeiten würde. Auch „Orest in Mossul“ wandert von Gent zuerst nach Bochum, bevor es in Wien und an zahlreichen weiteren Orten Station macht. 2007 gründete Rau die Firma IIPM (International Institute of Political Murder), die die Produktionen organisiert und die Theaterinszenierungen, Aktionen und Filme verwertet. Milo Rau ist längst eine globale Marke, die für Theater mit Kick steht. Revolution als Performance mit Ursprungszertifikat.
2017 gab Rau bekannt, dass er nicht nach Zürich, sondern nach Gent gehen wird. Der Künstler zog ein kleines Theater einem dem Burgtheater vergleichbaren Tanker vor. Statt mit 46 Millionen Euro, die dem Schauspielhaus Zürich zur Verfügung stehen, muss er am NTGent mit sechs Millionen Euro jährlich auskommen. „Wie Hegel sagte, man erkennt das Wesen des Kämpfers an seinen Waffen und ich habe gewusst, warum ich das Florett wähle und nicht die Stalinorgel Schauspielhaus“, erklärt Rau seine Entscheidung.
Der Kapitalismuskritiker führte in Gent vor, wie sich auch eine kleine Bühne auf dem internationalen Kulturmarkt behaupten kann. Ein von den Boulevardmedien gezündeter Skandal machte Rau auf Anhieb in Belgien bekannt. Sein erstes Stück „Lam Gods“ war eine Rekonstruktion des berühmten Genter Altars, der sich direkt neben dem Theater in der Kathedrale befindet. Im Zentrum der Szene steht das Lamm Gottes, das Christus symbolisiert und zu dem Heilige und Kreuzritter pilgern. Der Regisseur ließ das Geschehen durch Bürgerinnen und Bürger Gents nachspielen, als Drama über Leben, Tod und Erlösung. Ein Schäfer brachte Tiere mit, bei Kreuzrittern dachte Rau an religiöse Fanatiker.
Das Theater schaltete eine Anzeige, um ein Mitglied des Islamischen Staates zu finden. Das trug dem NTGent den Vorwurf ein, den Terrorismus zu verharmlosen. Plötzlich waren Rau und seine Art, Theater zu machen, in aller Munde. Das Publikum soll die Distanz zur Bühne aufgeben und das Lokale den großen Zusammenhang berühren, eine Rechnung, die zumindest im Feuilleton aufgeht. Zur Premiere kamen der Guardian und die New York Times angereist.
Zur Publizität trug auch ein Manifest bei, das den frischen Geist der Avantgarde in das gemütliche Provinztheater wehte. Die zehn Punkte des Genter Manifests skizzieren ein Stadttheater der Zukunft und sollen den Betrieb davor bewahren, in schlechte Gewohnheiten zurückzufallen. Zu den Forderungen gehört etwa, dass ein Stück nicht mehr als 20 Prozent eines vorliegenden Textes enthalten darf.
Ein Viertel der Probezeit muss außerhalb eines Theaterraums stattfinden, mindestens zwei Sprachen müssen gesprochen werden. Eine Produktion pro Saison soll in einem Krisengebiet entstehen und jede Inszenierung in mindestens drei Ländern gezeigt werden. So versucht Rau, die Kreativität der freien Szene mit den Möglichkeiten eines fixen Ensembles zu verbinden. Theater sind oft behäbige Apparate mit eng getakteten Arbeitsplänen. Rau will auf aktuelle Themen reagieren und auch weiterhin touren.
„Orest in Mossul“ verzichtet auf eine eindeutige Botschaft. Wohin mit dem Hass und wo bleibt die Gerechtigkeit? Anders als in seinen Essays und Interviews bleibt Rau eine Antwort auf die Frage nach dem Bösen in der Welt schuldig. Eine Band mit einheimischen Musikern intoniert im Hof der zerbombten Akademie den Popsong „Mad World“. Musik stand während der IS-Herrschaft unter Todesstrafe. Verrückte Welt. Für Rau, den Anhänger einer tragischen Weltsicht, gibt es keine Erlösung. Nicht die Moral ist sein Material, sondern der Schmerz.
In dieser Rezension ebenfalls besprochen: