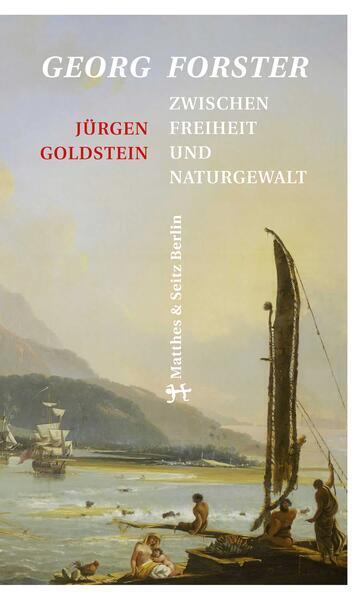Ein Entdecker und literarisierender Naturkundler
Sebastian Kiefer in FALTER 42/2015 vom 14.10.2015 (S. 40)
Seine erste große Reise machte Georg Forster im zarten Alter von neun Jahren: Einem Auftrag der russischen Zarin Katharina II. folgend, führte sie ihn an der Hand des Vaters bis zur Wolga. Danach ging er alsbald in die englische Migration und 1772 für drei Jahre auf ein Schiff.
Vater und Sohn begleiteten James Cook auf seiner zweiten Weltumsegelung und entdeckten nebst einigen Inselparadiesen vor allem, dass der Kontinent um den Südpol, von Zeitgenossen gerne als blühendes Land imaginiert, nichts als eine gigantische Eismasse war. Zeitlebens wird Georg Forster (1754–1794) schreibend, denkend und fühlend von diesem Abenteuer zehren und sich nach Wiederholung sehnen, um einem gedemütigten Leben zu entfliehen, dem er einige der glänzendsten Prosastücke der deutschen Literatur abrang.
Forster machte seine Leidenschaft für theorielose Beobachtung zum Beruf und wurde ein geschätzter literarisierender Naturkundler, der Goethes Hochachtung gewann und Alexander von Humboldt entscheidend prägte. Aber er war auch eine Hass- und Sehnsuchtsfigur nachfolgender Intellektueller, weil er in Mainz, wo er seit 1788 als Universitätsbibliothekar darbte, Präsident des Jakobinerklubs wurde und die kurzen Monate der ersten Republik auf deutschem Boden feurig mitgestaltete.
Diesem Tausendsassa hat Jürgen Goldstein, Professor für Philosophie, eine Studie gewidmet, verfasst nicht im Stil eines Kathederpädagogen, sondern eines veritablen Homme de Lettres. Forsters Grundbegriff „Natur“ war allerdings nicht, wie Goldstein insinuiert, eine Erkenntniskategorie, sondern eher eine Projektionsfläche für alles Mögliche. Goldsteins stilistische Anverwandlung an seinen Helden weigert sich außerdem, das psychologisch Offensichtliche zu benennen: dass Forster ein Prototyp des modernen Intellektuellen war, der seine Zerrissenheit und seinen gekränkten Ehrgeiz durch mal ressentimentgeladene, mal süß-idealistische Träume erträglich zu machen suchte. Insofern ist Goldsteins Buch sozusagen ein wenig zu schön, um ganz wahr zu sein.