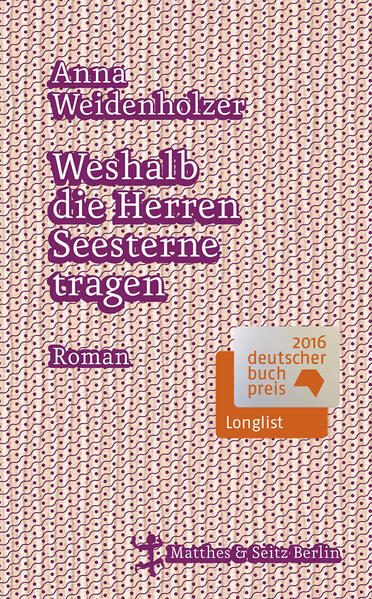Wie hoch ist das Bruttonationalglück?
Sebastian Fasthuber in FALTER 40/2016 vom 05.10.2016 (S. 33)
Mit Feingefühl und Kunstfertigkeit schreibt Anna Weidenholzer über Freuden und Sorgen der Menschen von Nebenan
Wir dürfen nicht aufhören, Fragen zu stellen, und wir müssen viele sein.“ In Wahrheit ist Karl, Anfang 60 und pensionierter Lehrer, in einer einsamen Mission unterwegs. Er will die Lebenszufriedenheit der Österreicher erforschen. Nachdem er im Fernsehen eine Dokumentation über das buddhistische Königreich Bhutan gesehen hatte, in dem neben der Wirtschaft auch der Mensch zählt und eine eigene Kommission das Bruttonationalglück der Bevölkerung ermittelt, fasste er den Plan, hierzulande eine ähnliche Bestandsaufnahme zu machen.
Überstürzt brach er eines Tages auf, ohne seiner Frau Margit etwas davon zu sagen. Karl will „herausfinden, woher diese Unzufriedenheit kommt, diese Angst, die manche in die falsche Richtung treibt“. Es geht ihm nicht so sehr um das individuelle Glück oder Unglück, sondern um die allgemeine (Un-)Zufriedenheit im Land. Er steigt dafür in einem verschlafenen Ort am Rand eines Wintersportgebiets ab. Die Touristen werden von Jahr zu Jahr weniger, weil die Autobahn zu weit entfernt ist, weil es kaum Schnee und daher auch keine Lifte mehr gibt.
Mit „Warum die Herren Seesterne tragen“ legt die in Wien lebende Linzerin Anna Weidenholzer (Jg. 1984) ihren zweiten Roman vor. Er folgt auf das so leise wie tolle Debüt „Der Winter tut den Fischen gut“, der von einer arbeitslos gewordenen älteren Verkäuferin aus einer Kleinstadt handelt. Thematisch bleibt sich die Autorin treu: Sie interessiert sich nicht für Metropolen, in denen das Leben pulsiert, sie schaut lieber dorthin, wo die Zeit stehengeblieben zu sein scheint.
Weidenholzer schreibt auch nicht, wie viele Kolleginnen und Kollegen, aus ihrem Alter heraus. Ihre Figuren könnten ihre Eltern sein. Wirklich erklären kann sie sich dieses Faible nicht: „Vielleicht kommt es, weil ich lieber ein Stück weit weg von mir schreibe als nah an meinem eigenen Leben. Welche Figuren entstehen, kann ich aber gar nicht beeinflussen. Die ploppen einfach auf und sind da. Dann müssen sie auch erzählt werden.“
Karl bezieht im Hotel Post ein Zimmer, er ist der einzige Gast. Die Wirtin spart, wo’s nur geht, kontrolliert den Wasserverbrauch und dreht abends rigoros die Heizung ab. Bei mehr als 15 Grad Zimmertemperatur gäbe es sowieso keinen gesunden Schlaf! Nicht nur das Ankommen, auch die ersten Befragungen von Ortsansässigen gestalten sich schwierig. Karl bemüht sich, objektiv zu bleiben, die Leute aber wollen ihm lieber ihr Herz ausschütten, anstatt seine Fragen zu beantworten. Letztere haben – Weidenholzer kann auch Humor – skurrile Züge: „Wann sind Sie zuletzt Bus gefahren? Bauen Sie Gemüse an, haben es Ihre Eltern und Großeltern getan? Sind Sie fremden Menschen eher zu- oder abgeneigt? Mögen Sie Feste? Falls ja, auch in Zelten?“
Sechs Wochen verbringt Karl in dem Ort, ehe er wieder heimfährt. Lang bleibt er kein Außenstehender. Mag er auch als Forscher eine tragikomische Gestalt abgeben, so baut er doch Beziehungen zu einigen Bewohnern auf und bringt sie zum Reden. Darunter ist ein Hansi-Hinterseer-Fan, der sich aus Sehnsucht nach ein bisschen heiler Welt im Keller seines Hauses eine Insel gebaut hat; einer, den die „Holzkrankheit“ erwischt hat („Hat man einen Tag lang Holz gemacht, kann er nicht schlecht gewesen sein“); oder eine Frau, die wider Willen zur Schneekugelsammlerin geworden ist („Man bekommt eine geschenkt, und der nächste Besuch bringt wieder eine, weil angenommen wird, dass einem das gefällt“).
Weidenholzer verfügt über ein feines Gespür für die Freuden, Sorgen und Ängste der sogenannten kleinen Leute. Und sie gibt ihre Figuren nie der Lächerlichkeit preis. Im Gegenteil, diese dürfen en passant auch sehr Weises von sich geben: „Wir sind ein kleines Land mit kleinen Zeitungen.“ Was an dem neuen Roman fast noch mehr beeindruckt, ist die Kunstfertigkeit, mit der die Autorin vorgeht. Oberflächlich betrachtet, reiht sie nüchterne, in Alltagssprache gehaltene Sätze aneinander. Tatsächlich ist „Warum die Herren Seesterne tragen“ hochartifiziell konstruiert und zieht dem Leser mittels harter Schnitte und unerwarteter Zeit- und Ortssprünge immer wieder den Boden unter den Füßen weg.
Leerstellen und Aussparungen gehören ebenfalls zu Weidenholzers erzählerischem Programm. Im Grunde erzählt ihr Roman auch eine Liebesgeschichte – nur tritt Karls Frau Margit nie in Erscheinung, wir erleben sie nur als große anwesende Abwesende. Wie es um die Beziehung der beiden bestellt ist, bleibt bis zum Schluss unklar. Darüber soll jeder Leser sein eigenes Urteil fällen. Überhaupt hat der in der zeitgenössischen Literatur um sich greifende Trend, den Leser für etwas blöd zu halten und ihm ständig alles erklären zu wollen, die Autorin zum Glück noch nicht erfasst.
Dass sie sich für ihren zweiten Roman vier Jahre Zeit ließ, haben viele in der Branche nicht verstanden und ihr geraten, schneller einen Nachfolger zu publizieren, um nach dem erfolgreichen Erstling nicht gleich wieder vergessen zu werden. Weidenholzer aber bewegt sich ruhig und selbstbewusst in ihrem eigenen Tempo. Das Resultat ist ein echter Wurf und gibt ihr recht.