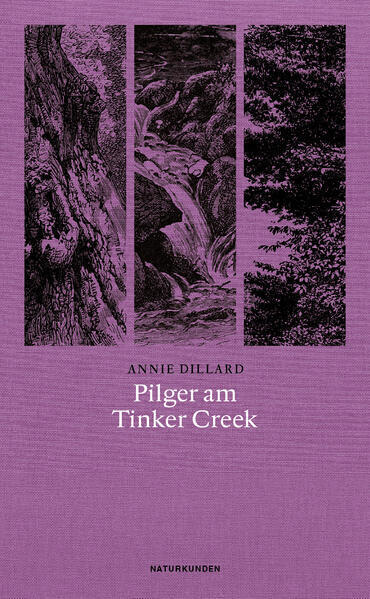Ein Verein von Extremisten
Jörg Magenau in FALTER 11/2017 vom 15.03.2017 (S. 29)
Bei Annie Dillard geht es um alles: die Natur, das Leben, den Sinn, die Schönheit
Am Flussufer sitzt ein Frosch, der sich nicht regt. Annie Dillard ist früh am Morgen am Tinker Creek in Virginia unterwegs. Sie bewundert das Licht auf den Bäumen, hört Vogelstimmen, denkt über die aus Europa importierten Stare nach, und da ist dann dieser Frosch. Vor ihren Augen schrumpelt er zusammen wie ein Ball, aus dem jemand die Luft herauslässt. Er scheint verblüfft zu sein; in seinen Augen ist abzulesen, dass er nicht begreift, was da geschieht, aber da erlöschen sie schon und verlieren den Lebensglanz. Schließlich bleibt nur die leere Haut, die im Wasser versinkt wie ein welkes Blatt. Der Frosch wurde von einer Riesenwanze ausgesaugt, die ihre Beute mit einem Stich lähmt und das Körperinnere mit ihrem Gift verflüssigt. Natur kennt keine Skrupel.
Immer wieder sind es derartige Szenen, die Annie Dillard faszinieren, etwa jene, in der eine Gottesanbeterin mit diesem durchaus niedlichen, grünen Gesichtlein, das Männchen, von dem sie gerade begattet wird, langsam verspeist. Sie frisst zuerst den Kopf, dann den Rumpf. Der Unterleib des Männchens vollendet unterdessen sehr ökonomisch die Fortpflanzungspflicht.
„Was ist das für eine Schöpfer?“, mag sich mancher fragen, der derartige Kreaturen erschaffen hat. Annie Dillard kommt ständig vom ganz Kleinen zum ganz Großen. Jede Mücke verweist aufs Universum; jeder Lichtstrahl auf Zeit und Raum.
Warum gibt es das alles? Warum ist etwas schön? Wozu hat die Ulme gezackte Blätter, und jeder Zacken ist wieder gezackt? Warum all dieser gigantische Aufwand? Wozu diese unendliche Vielfalt, wenn es doch so viel einfacher wäre, es gäbe nur wenige Formen oder nur eine einzige, die sich bewährt hat?
Annie Dillard stellt Fragen, auf die es keine Antworten gibt. 1972, als sie sich auf den Spuren von Henry David Thoreau in die Natur und in die Einsamkeit zurückzog, war sie Mitte 20. Sie war examinierte Anglistin, erholte sich von einer lebensbedrohlichen Lungenentzündung und von der Ehe, die sie mit ihrem Professor eingegangen war.
Doch von all dem erfährt man nichts. Hier ist Dillard nichts als Beobachterin, die sieht und staunt und nach Worten und Namen sucht. Sie braucht nur die Haustür zu öffnen und die Welt ist voller Wunder. Aber alles, was sie sieht, verweist diese Pilgerin des Daseins auf einen abwesenden, sich verbergenden Gott – auch wenn es sich dabei womöglich um einen „schwer gestörten Manisch-Depressiven“ handelt, der sich bizarre Spielzeuge erfunden hat und ein Universum, das kein Mensch überblicken kann. Die Schöpfung „besteht aus nichts als extremistischen Randgruppen“.
Dillards Blick ist unsentimental, wissbegierig und niemals kitschig. Dennoch – oder gerade deshalb – vermag sie auch all die grandiosen Schönheiten zu würdigen und zu gewahren, die es doch auch gibt, gleich neben der Grausamkeit und der Gleichmut der Natur. Schönheit ist für die Autorin keine Geschmacksfrage, sondern etwas „objektiv Gegebenes“, und es ist die Schönheit ihrer poetischen Sprache, mit der sie diese erfasst. Dillard ist Naturforscherin ebenso wie Lyrikerin. Die Schönheit der Sprache ist der Schlüssel zum Verständnis der Dinge und Lebewesen. Sie weiß, dass auch das Sehen „natürlich weitgehend eine Sache der Verbalisierung“ ist. Was wir nicht sagen können, können wir auch nicht sehen.
„Pilger am Tinker Creek“ erschien 1974 und wurde 1975 mit dem Pulitzer Preis ausgezeichnet. Eine deutsche Übersetzung gab es unter dem Titel „Der freie Fall der Spottdrossel“ 1995 bei Klett-Cotta. Jetzt ist das Buch in der Reihe „Naturkunden“ bei Matthes und Seitz wiederzuentdecken. Die zyklische Wiederkehr im 20-Jahres-Rhythmus passt zu diesem unvergänglichen Werk, dessen Beobachtungszeitraum ein Jahr von Winter zu Winter umfasst und darin den Zyklus alles Lebendigen nachzeichnet.
Dillard bezeichnet ihre Suche als ein „meteorologisches Tagebuch der Seele“. Ihr Blick auf die Vielfalt der Lebensformen einer Natur, in der nichts zu abwegig ist, um vorzukommen, ist ihre Art der Theodizee. Das hat nichts mit Frömmelei zu tun. „Gott bewahre uns vor Meditationen“, schreibt sie. Und doch ist es eine Art von Gebet, oder, wenn es so eine literarische Gattung gäbe, ein naturwissenschaftliches Langgedicht. Es ist eine Einübung ins Loslassen, um sich den Phänomenen ganz zu öffnen. Und so entfaltet sich die Welt in diesen wunderschönen, unbestechlichen Texten in ihrer ganzen grandiosen Unerklärlichkeit.