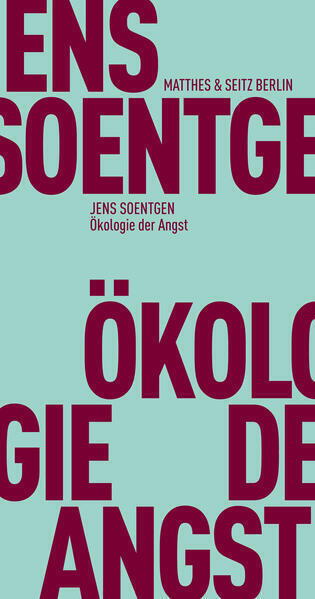Man kann nur schützen, was man auch versteht und liebt
Gerlinde Pölsler in FALTER 41/2018 vom 10.10.2018 (S. 44)
Ökologie: Drei Bücher werben für einen neuen Naturbezug und warnen vor Endzeitstimmung. Die Zukunft lässt sich immer noch gestalten!
Was manchen heute der Wolf ist, das war einst der Wal: Er galt als Inbegriff des Bösen schlechthin, als gefährliches Monster, das den Tod verdient. „Moby-Dick“ erzählt vom Hass Kapitäns Ahab auf einen weißen Pottwal. Außer seinem schlechten Image hatte der Wal noch das Pech, eine Art schwimmendes Rohstofflager zu sein: Nicht nur zu Kerzen und Seifen kann man ihn verwerten, sondern auch Nitroglyzerin aus ihm kochen: für Sprengstoff. Die Ausrottung der Wale schien bereits besiegelt.
Doch dann kamen die Meeresforscher und spielten den Menschen Walgesänge vor. Wir konnten hören, wie die Wale richtige musikalische Einheiten, Strophen und Choräle durch das Meer schicken. Das war ihre Rettung. Der Wal mutierte zum „freundlichen Riesen“, die Macht der Pro-Walfang-Nationen schwand. Ohne diese Wendung wären die Wale längst ausgerottet. Ihre Gesänge eröffneten den Menschen einen emotionalen Naturbezug, der für jegliche wirksame Naturpolitik, die Anhänger mobilisieren muss, unentbehrlich sei, schreibt Jens Soentgen.
Es ist eine der zentralen Aussagen in seinem schmalen, aber dichten Buch „Ökologie der Angst“. Nicht nur hier gibt es einen Berührungspunkt zwischen diesem und zwei anderen interessanten Neuerscheinungen auf dem Gebiet der Ökologie: mit „Das Ende der Natur“ von Susanne Dohrn, dass nun in einer erweiterten Taschenbuchausgabe vorliegt, und Birgit Schneiders „Klimabilder“. Die drei legen den Fokus sehr unterschiedlich: Jens Soentgen, Leiter des Wissenschaftszentrums Umwelt in Augsburg, charakterisiert das Anthropozän, in dem der Mensch „das herrschende Tier auf diesem Planeten“ ist, als Zeitalter der Angst (vornehmlich der Tiere vor den Menschen).
Die deutsche Historikerin und Journalistin Susanne Dohrn beschreibt das Verschwinden der Arten im Wald und vor der Tür. Birgit Schneider wiederum, Professorin für Medienökologie an der Universität Potsdam, schaut sich detailliert an, wie über den sogenannten Klimawandel geredet wird, welche Bilder wir uns von ihm machen und warum das nicht egal ist.
Alle drei lassen keine Zweifel an der Dringlichkeit ihrer Botschaften. Alle warnen aber auch vor einer Endzeit- und Eh-schon-wurscht-Stimmung: Nein, die Zukunft lässt sich noch gestalten. Doch damit Menschen ökologisch klug handeln, brauchen sie eine innere Motivation: Noch so vernünftige Argumente holen uns nicht hinterm Ofen hervor. Nur wenn der Mensch eine Beziehung zu den anderen Lebewesen und zur gesamten Natur aufbaut, bewegt sich etwas. Aber wie geht, wie entsteht das?
„Die Landschaften meiner Kindheit waren voller Leben“, zitiert Susanne Dohrn in „Das Ende der Natur“ aus einem ihrer vielen Gespräche, in diesem Fall mit Michael Succow, Landschaftsökologe und Träger des Alternativen Nobelpreises. Vom Fenster seines Kinderzimmers beobachtete er Großtrappen bei der Balz, tausende Finkenvögel, im Teich auf dem Feld tummelten sich Wasserläufer und Kammmolche. „Ich meinte damals, das bliebe immer so“, sagt Succow. Kommt er heute in die Gegend, ist der Gesang der Gartenammer verstummt, der Teich ausgetrocknet.
Auch in der Autorin ist die Sehnsucht nach den Blumen und Insekten, die sie als Kind als selbstverständlich hingenommen hatte, erwacht. Sie legt eine kleine Wiese an: „Sie soll so aussehen wie früher“, schreibt sie, als rosa Kuckucks-Lichtnelken blühten, lila Wiesenschaumkraut, blaue Rundblättrige Glockenblumen. „Ich will den Tisch decken für Hummeln und Bienen, für Falter und Fliegen.“ Nun kann man ein paar Quadratmeter Wiese natürlich als kleines Ding abtun, das im Großen nichts ändert. Aber: Von der ersten Packung „regionaltypischem Saatgut“ nimmt Dohrn die Leser mit, Monat für Monat erfährt man, was wächst und wer welches Tier anlockt.
Es macht Spaß, von den „ausgebufften“ Überlebensstrategien mancher Lebewesen zu lesen. Nebenbei lernt man viel über die Ursachen der zunehmenden Leere in den Landschaften. Dohrn stellt klar: Ihr Buch ist „ein J’accuse gegen die intensive Landwirtschaft“ und gegen „eine Politik, die es fördert, dass tonnenweise Raps, Getreide und Mais in Biogasanlagen und Autotanks landen“. Auf hoffnungsvolle Kapitel wie „Dornröschen unter der Erde“ folgen solche, in denen Klartext geredet wird: „Teuflische Wirkstoffe“ oder „Die Natur wird zur Latrine“.
Dohrns Angriffspunkt ist nicht der einzelne (kleine) Bauer, es sind die Agrarkonzerne und jene Funktionäre und Politiker, die in Wahrheit nicht im Sinne (des Großteils) der Landwirte agieren. Vielmehr ließen sie ihnen nur eine Wahl: „Wachse oder weiche!“
Je länger man Susanne Dohrn auf ihre Wiese begleitet, desto mehr wird man unversehens ebenfalls zur Anwältin von Laubfröschen und Regenwürmern. Damit gelingt der Autorin genau das, was Soentgen empfiehlt: Sie schafft „emotionalen Naturbezug“. Die Autorin selbst weiß inzwischen, dass sie den Aurorafalter gekillt hat, als sie früher das Wiesenschaumkraut mähte: „Man kann nur schützen, was man kennt.“
Über das Schützen und das Kennenlernen zerbricht sich auch Jens Soentgen den Kopf. Jagd, Verfolgung, Ausrottung hätten die Tiere die Angst vor dem Menschen gelehrt. Zu den bewährten Feuerwaffen kommt heute das Abholzen und Abfackeln ganzer Wälder, um etwa Sojaplantagen für die Massentierhaltung anzulegen. Wildtiere hätten daher gelernt: Der Mensch ist der „Universalfeind“, vor ihm muss man flüchten.
Dabei sei das kein Naturgesetz: „Anders als wir meinen, ist es nämlich nicht selbstverständlich, dass Tiere panische Angst vor uns haben und davonrasen, -fliegen oder -kriechen, sobald sie uns auch nur von fern sehen.“ Als im Zeitalter der Entdecker die Europäer zahlreiche Inseln ansteuerten, hätten deren Tiere kaum Scheu vor den Menschen gezeigt. Auch Charles Darwin und „Brehms Thierleben“ hätten über die Zutraulichkeit wilder Tiere berichtet. Der Rückzug der Tiere vor dem „Raubtier“ Mensch führe zu noch mehr Entfremdung, doch es sei „möglich und dringend geboten, zumindest lokal und punktuell Schritte der Versöhnung zu tun“.
Zwei Möglichkeiten führt Soentgen dazu aus: Erstens sollten die hermeneutischen Naturwissenschaften uns helfen, die (Wild-)Tiere besser zu verstehen – siehe Wale. Zweitens gelte es, mehr Räume zu schaffen, in denen Tiere den Menschen nicht als Gefahr wahrnehmen. Wo der Mensch „nur noch ein einfaches Mitglied der natürlichen Gemeinschaft ist“ und „die Souveränität der Natur“ akzeptiert. Daraus kann nach Soentgen ein innerer Naturbezug entstehen, und aus abstrakten, rationalen Zielen werden im besten Fall emotionale Ziele: Wer Walgesänge bewundert, will, dass die Wale leben.
Was es braucht, damit Wissen zu konstruktivem Handeln führt, das ist auch Birgit Schneiders zentrales Thema. Wer die Botschaft von Grafiken wie dem Hockey Stick, der den Gang des Klimas für die letzten 1000 Jahre rekonstruiert, verstanden habe, der werde auch handeln und die notwendigen Entscheidungen treffen. „Dies zumindest ist die Hoffnung innerhalb eines rationalen Verständnisses aufgeklärter Wissenskommunikation“, schreibt die Medientheoretikerin und liefert den Zweifel gleich mit.
Schneider hat eine beeindruckende Kollektion an Darstellungen des Klimas und dessen Veränderung zusammengetragen, beginnend mit den beinahe 200 Jahre alten Isolinien-Karten des Forschungsreisenden Alexander von Humboldt. Ausführlich analysiert sie, was der Begriff „Klimawandel“ suggeriert, und zeigt, wie die Klimawandel-Leugner arbeiten. Sie erklärt, wie das Bild des „Blauen Planeten“ („our home planet“) der NASA zur Ikone eines neuen Umweltbewusstseins wurde. Dem gegenüber stellt sie die Bilder des erhitzten Planeten in brennendem Rot und diskutiert, was diese „burning worlds“ in den Betrachtern auslösen. Studien würden nahelegen, dass solch bedrohliche Bilder zwar Aufmerksamkeit erregen, „dann jedoch keine Handlungen nach sich ziehen“: Die Geschichte von der Apokalypse lässt uns bloß ohnmächtig zurück.
Am Ende des Buchs überlegt Schneider, was das alles nun für Wissenschaft, Kunst und Medien bedeutet. Eines aber will sie nicht: maßgeschneiderte PR-Strategien für eine Stopp-Klimawandel-Kampagne ersinnen. Das sei schon auch wichtig, ihr gehe es aber um die „Praxis der Kritik und des kritischen Denkens“. Um das Ruder herumzureißen, brauche es ganz neue Sichtweisen, schreibt sie. Und zitiert einen Albert Einstein zugeschriebenen Satz: „Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind.“
Man kann nur schützen, was man auch versteht und liebt
Gerlinde Pölsler in FALTER 41/2018 vom 10.10.2018 (S. 44)
Ökologie: Drei Bücher werben für einen neuen Naturbezug und warnen vor Endzeitstimmung. Die Zukunft lässt sich immer noch gestalten!
Was manchen heute der Wolf ist, das war einst der Wal: Er galt als Inbegriff des Bösen schlechthin, als gefährliches Monster, das den Tod verdient. „Moby-Dick“ erzählt vom Hass Kapitäns Ahab auf einen weißen Pottwal. Außer seinem schlechten Image hatte der Wal noch das Pech, eine Art schwimmendes Rohstofflager zu sein: Nicht nur zu Kerzen und Seifen kann man ihn verwerten, sondern auch Nitroglyzerin aus ihm kochen: für Sprengstoff. Die Ausrottung der Wale schien bereits besiegelt.
Doch dann kamen die Meeresforscher und spielten den Menschen Walgesänge vor. Wir konnten hören, wie die Wale richtige musikalische Einheiten, Strophen und Choräle durch das Meer schicken. Das war ihre Rettung. Der Wal mutierte zum „freundlichen Riesen“, die Macht der Pro-Walfang-Nationen schwand. Ohne diese Wendung wären die Wale längst ausgerottet. Ihre Gesänge eröffneten den Menschen einen emotionalen Naturbezug, der für jegliche wirksame Naturpolitik, die Anhänger mobilisieren muss, unentbehrlich sei, schreibt Jens Soentgen.
Es ist eine der zentralen Aussagen in seinem schmalen, aber dichten Buch „Ökologie der Angst“. Nicht nur hier gibt es einen Berührungspunkt zwischen diesem und zwei anderen interessanten Neuerscheinungen auf dem Gebiet der Ökologie: mit „Das Ende der Natur“ von Susanne Dohrn, dass nun in einer erweiterten Taschenbuchausgabe vorliegt, und Birgit Schneiders „Klimabilder“. Die drei legen den Fokus sehr unterschiedlich: Jens Soentgen, Leiter des Wissenschaftszentrums Umwelt in Augsburg, charakterisiert das Anthropozän, in dem der Mensch „das herrschende Tier auf diesem Planeten“ ist, als Zeitalter der Angst (vornehmlich der Tiere vor den Menschen).
Die deutsche Historikerin und Journalistin Susanne Dohrn beschreibt das Verschwinden der Arten im Wald und vor der Tür. Birgit Schneider wiederum, Professorin für Medienökologie an der Universität Potsdam, schaut sich detailliert an, wie über den sogenannten Klimawandel geredet wird, welche Bilder wir uns von ihm machen und warum das nicht egal ist.
Alle drei lassen keine Zweifel an der Dringlichkeit ihrer Botschaften. Alle warnen aber auch vor einer Endzeit- und Eh-schon-wurscht-Stimmung: Nein, die Zukunft lässt sich noch gestalten. Doch damit Menschen ökologisch klug handeln, brauchen sie eine innere Motivation: Noch so vernünftige Argumente holen uns nicht hinterm Ofen hervor. Nur wenn der Mensch eine Beziehung zu den anderen Lebewesen und zur gesamten Natur aufbaut, bewegt sich etwas. Aber wie geht, wie entsteht das?
„Die Landschaften meiner Kindheit waren voller Leben“, zitiert Susanne Dohrn in „Das Ende der Natur“ aus einem ihrer vielen Gespräche, in diesem Fall mit Michael Succow, Landschaftsökologe und Träger des Alternativen Nobelpreises. Vom Fenster seines Kinderzimmers beobachtete er Großtrappen bei der Balz, tausende Finkenvögel, im Teich auf dem Feld tummelten sich Wasserläufer und Kammmolche. „Ich meinte damals, das bliebe immer so“, sagt Succow. Kommt er heute in die Gegend, ist der Gesang der Gartenammer verstummt, der Teich ausgetrocknet.
Auch in der Autorin ist die Sehnsucht nach den Blumen und Insekten, die sie als Kind als selbstverständlich hingenommen hatte, erwacht. Sie legt eine kleine Wiese an: „Sie soll so aussehen wie früher“, schreibt sie, als rosa Kuckucks-Lichtnelken blühten, lila Wiesenschaumkraut, blaue Rundblättrige Glockenblumen. „Ich will den Tisch decken für Hummeln und Bienen, für Falter und Fliegen.“ Nun kann man ein paar Quadratmeter Wiese natürlich als kleines Ding abtun, das im Großen nichts ändert. Aber: Von der ersten Packung „regionaltypischem Saatgut“ nimmt Dohrn die Leser mit, Monat für Monat erfährt man, was wächst und wer welches Tier anlockt.
Es macht Spaß, von den „ausgebufften“ Überlebensstrategien mancher Lebewesen zu lesen. Nebenbei lernt man viel über die Ursachen der zunehmenden Leere in den Landschaften. Dohrn stellt klar: Ihr Buch ist „ein J’accuse gegen die intensive Landwirtschaft“ und gegen „eine Politik, die es fördert, dass tonnenweise Raps, Getreide und Mais in Biogasanlagen und Autotanks landen“. Auf hoffnungsvolle Kapitel wie „Dornröschen unter der Erde“ folgen solche, in denen Klartext geredet wird: „Teuflische Wirkstoffe“ oder „Die Natur wird zur Latrine“.
Dohrns Angriffspunkt ist nicht der einzelne (kleine) Bauer, es sind die Agrarkonzerne und jene Funktionäre und Politiker, die in Wahrheit nicht im Sinne (des Großteils) der Landwirte agieren. Vielmehr ließen sie ihnen nur eine Wahl: „Wachse oder weiche!“
Je länger man Susanne Dohrn auf ihre Wiese begleitet, desto mehr wird man unversehens ebenfalls zur Anwältin von Laubfröschen und Regenwürmern. Damit gelingt der Autorin genau das, was Soentgen empfiehlt: Sie schafft „emotionalen Naturbezug“. Die Autorin selbst weiß inzwischen, dass sie den Aurorafalter gekillt hat, als sie früher das Wiesenschaumkraut mähte: „Man kann nur schützen, was man kennt.“
Über das Schützen und das Kennenlernen zerbricht sich auch Jens Soentgen den Kopf. Jagd, Verfolgung, Ausrottung hätten die Tiere die Angst vor dem Menschen gelehrt. Zu den bewährten Feuerwaffen kommt heute das Abholzen und Abfackeln ganzer Wälder, um etwa Sojaplantagen für die Massentierhaltung anzulegen. Wildtiere hätten daher gelernt: Der Mensch ist der „Universalfeind“, vor ihm muss man flüchten.
Dabei sei das kein Naturgesetz: „Anders als wir meinen, ist es nämlich nicht selbstverständlich, dass Tiere panische Angst vor uns haben und davonrasen, -fliegen oder -kriechen, sobald sie uns auch nur von fern sehen.“ Als im Zeitalter der Entdecker die Europäer zahlreiche Inseln ansteuerten, hätten deren Tiere kaum Scheu vor den Menschen gezeigt. Auch Charles Darwin und „Brehms Thierleben“ hätten über die Zutraulichkeit wilder Tiere berichtet. Der Rückzug der Tiere vor dem „Raubtier“ Mensch führe zu noch mehr Entfremdung, doch es sei „möglich und dringend geboten, zumindest lokal und punktuell Schritte der Versöhnung zu tun“.
Zwei Möglichkeiten führt Soentgen dazu aus: Erstens sollten die hermeneutischen Naturwissenschaften uns helfen, die (Wild-)Tiere besser zu verstehen – siehe Wale. Zweitens gelte es, mehr Räume zu schaffen, in denen Tiere den Menschen nicht als Gefahr wahrnehmen. Wo der Mensch „nur noch ein einfaches Mitglied der natürlichen Gemeinschaft ist“ und „die Souveränität der Natur“ akzeptiert. Daraus kann nach Soentgen ein innerer Naturbezug entstehen, und aus abstrakten, rationalen Zielen werden im besten Fall emotionale Ziele: Wer Walgesänge bewundert, will, dass die Wale leben.
Was es braucht, damit Wissen zu konstruktivem Handeln führt, das ist auch Birgit Schneiders zentrales Thema. Wer die Botschaft von Grafiken wie dem Hockey Stick, der den Gang des Klimas für die letzten 1000 Jahre rekonstruiert, verstanden habe, der werde auch handeln und die notwendigen Entscheidungen treffen. „Dies zumindest ist die Hoffnung innerhalb eines rationalen Verständnisses aufgeklärter Wissenskommunikation“, schreibt die Medientheoretikerin und liefert den Zweifel gleich mit.
Schneider hat eine beeindruckende Kollektion an Darstellungen des Klimas und dessen Veränderung zusammengetragen, beginnend mit den beinahe 200 Jahre alten Isolinien-Karten des Forschungsreisenden Alexander von Humboldt. Ausführlich analysiert sie, was der Begriff „Klimawandel“ suggeriert, und zeigt, wie die Klimawandel-Leugner arbeiten. Sie erklärt, wie das Bild des „Blauen Planeten“ („our home planet“) der NASA zur Ikone eines neuen Umweltbewusstseins wurde. Dem gegenüber stellt sie die Bilder des erhitzten Planeten in brennendem Rot und diskutiert, was diese „burning worlds“ in den Betrachtern auslösen. Studien würden nahelegen, dass solch bedrohliche Bilder zwar Aufmerksamkeit erregen, „dann jedoch keine Handlungen nach sich ziehen“: Die Geschichte von der Apokalypse lässt uns bloß ohnmächtig zurück.
Am Ende des Buchs überlegt Schneider, was das alles nun für Wissenschaft, Kunst und Medien bedeutet. Eines aber will sie nicht: maßgeschneiderte PR-Strategien für eine Stopp-Klimawandel-Kampagne ersinnen. Das sei schon auch wichtig, ihr gehe es aber um die „Praxis der Kritik und des kritischen Denkens“. Um das Ruder herumzureißen, brauche es ganz neue Sichtweisen, schreibt sie. Und zitiert einen Albert Einstein zugeschriebenen Satz: „Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind.“