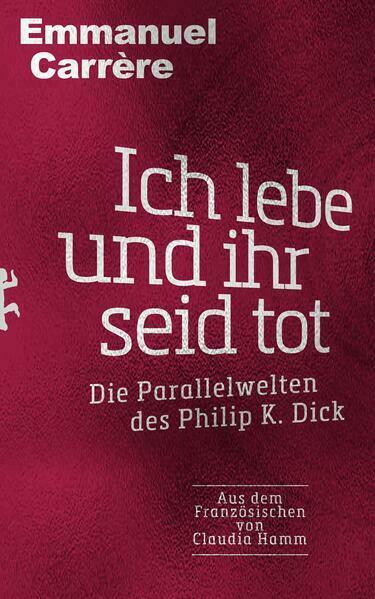Wer Visionen hat, braucht einen Arzt
Klaus Nüchtern in FALTER 12/2025 vom 19.03.2025 (S. 7)
Wenige Monate nachdem der bis dahin nur Science-Fiction-Fans bekannte Philip K. Dick im Alter von 53 Jahren stirbt, kommt „Blade Runner“, die Verfilmung eines seiner insgesamt 43 Romane, ins Kino und sorgt für posthumen Ruhm, der seitdem durch Adaptionen für Kino und Fernsehen – „Total Recall“, „Minority Report“, „A Scanner Darkly“ et al. – prolongiert wurde.
Emmanuel Carrère, Jahrgang 1957, hält bereits als Teenager Dick für den „Dostojewski unserer Zeit“ – wie er in seinem bereits 1993 auf Französisch und nun in deutscher Übersetzung erschienenen Buch erzählt. Laut Verlag handelt es sich bei „Ich lebe und ihr seid tot“ um eine Biografie in Form eines „leichtfüßigen, hypnotischen Romans“, wie man ihn von dem schillernden Romancier, der zuletzt die Reportage „V 13“ über den Prozess zum IS-Anschlag aufs Bataclan vorgelegt hat, erwarten darf.
Möchte man meinen. Ist aber leider nicht der Fall. Der Autor verrät zwar, wie er vorgegangen wäre, wäre sein Buch tatsächlich ein Roman; warum er es aber überhaupt – nur vier Jahre nachdem Lawrence Sutins Dick-Biografie „Divine Invasions“ erschienen war – geschrieben hat, erschließt sich nicht. Es mangelt dieser Lebenserzählung nämlich schlicht an Perspektive. Anstatt eine These zu wagen und klar zu machen, was genau ihn an diesem Autor interessiert und fasziniert, breitet Carrère Dicks Traumata, Passionen und Visionen bis in nebensächliche Details aus und gleicht sie mit dessen Werk ab. Darin lassen sich eine dominante Mutter und fünf immer jünger werdende, tunlichst schwarzhaarige und biegsame Ehefrauen als stereotype Frauenfiguren ebenso wiederfinden wie die Spuren der todlangweiligen theologischen Spekulationen, die den zum Katholizismus konvertierten, von einem gnostischen Weltbild geprägten Dick zeitlebens umtreiben.
Alles andere als leichtfüßig kommen auch die seitenlangen Inhaltsangaben daher, die auch noch mit ausgiebigen Zitaten garniert sind, allerdings keinen wörtlichen, sondern „freien“, wie es in einer Fußnote heißt. Carrère hat Dick, den er (nicht zu Unrecht) für einen „armseligen Stilisten“ hält, nach Gutdünken umgedichtet, und die Übersetzerin hat es ebenso gehalten. Sie wurde dabei, wie sie versichert, von keiner KI unterstützt. Was vielleicht keine schlechte Idee gewesen wäre, so ungelenk und nicht immer Deutsch, wie sie ausgefallen ist. Ob die Verschwurbeltheit der Prosa, durch die schon mal ein „vom eigenen Deckmantel verzehrter Polizist“ geistert, auf den Autor oder seine Übersetzerin zurückgehen, bleibt unklar.