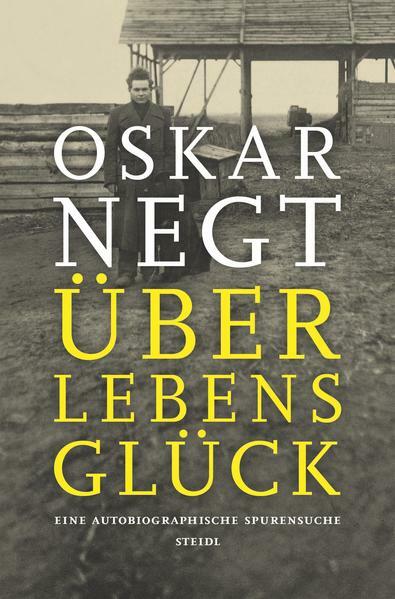Aufwachsen in Zeiten des Zweiten Weltkriegs
Rudolf Walther in FALTER 9/2017 vom 01.03.2017 (S. 18)
Der Sozialwissenschaftler Oskar Negt erinnert sich an seine Kindheit auf der Flucht – und wie sie ihn fürs Leben prägte
Der Philosoph und Soziologe Oskar Negt beginnt seine Autobiografie mit einer scharfsinnigen Analyse der Untiefen und Fallstricke jeder Autobiografie. Im Unterschied zum Historiker, der die Biografie einer Person schreiben will und dazu in die Tiefen der Archive taucht, um Quellen für sein Vorhaben aufzuspüren und zu bewerten, hat der Autobiograf oft nur wenige schriftliche Quellen zur Verfügung und ist im Wesentlichen auf seine Erfahrungen und Erinnerungen angewiesen. Das gilt besonders für die eigene Kindheit.
Erfahrungen und Erinnerungen sind für Negt kein Besitzstand, sondern Fragmente aus einem kontinuierlichen Lernprozess. Deshalb versucht er erst gar nicht, seine Lebensgeschichte als stetiges Fortschreiten im Sinne eines linearen Fortschritts oder gar eines ungebrochenen Aufstiegs von unten nach oben zu erzählen, sondern begnügt sich mit Fragmentarischem und Exemplarischem, für das er klare Erinnerungen und prägende Erfahrungen und Lernprozesse geltend machen kann, aber das er auch aus der Perspektive des Erwachsenen kritisch reflektiert und ergänzt.
Oskar Negt wurde als siebentes und jüngstes Kind im ostpreußischen Dorf Kapkeim in eine Kleinbauernfamilie hineingeboren. Im Fachjargon heißen diese Bauern Instleute. Sie kauften großen Gutsbesitzern einen kleinen Hof ab, verschuldeten sich dadurch und blieben von Gutsbesitzern und Banken abhängig.
Vernunftglaube der Schwestern
Negts Vater war seit 1918 SPD-Mitglied. Die Kinder erinnern sich an ihn vor allem als Zeitungs- und Zeitschriftenlesenden bzw. jemanden, der sich fast nur um Politik kümmerte. Im Jänner 1945, die Rote Armee hatte fast ganz Ostpreußen erobert und Königsberg eingekesselt, entschloss sich die neunköpfige Familie zur Flucht. Die älteste Tochter arbeitete bereits als Verkäuferin in Berlin. Zwei Schwestern Oskar Negts – 16 und 17 Jahre alt – sollten mit dem zehneinhalbjährigen Oskar mit der Bahn nach Berlin fliehen. Die Eltern und die restlichen drei Kinder schlossen sich einem Treck an, der über die gefrorene Ostsee nach Westen gelangen wollte.
Der Zug, in dem Oskar und seine beiden Schwestern saßen, wurde in einen Unfall verwickelt und konnte, mitten im strengen Winter, erst nach vier Tagen bis Königsberg weiterfahren. Dort angekommen, erfuhren die drei Kinder bzw. Jugendlichen, dass von Königsberg kein Zug mehr nach Berlin fuhr, die Stadt stand unter Artilleriefeuer und war schon fast zerstört. „An diesem Tag endete meine Kindheit“, stellt der 83-jährige Oskar Negt fest.
Was Negt von der Fortsetzung der Flucht erzählt, die das Geschwistertrio nach Dänemark führte, wo es für zweieinhalb Jahre interniert wurde, ist vor allem eine Hommage an die beiden Schwestern. Die beiden brachten sich selbst und den kleinen Bruder mit Mut und Nervenstärke durch lebensbedrohende Gefahren. Beim autobiografischen Rückblick auf die eigene Kindheit reflektiert Negt darüber, was den dreien das Leben und Überleben unter garstigen Umständen gerettet hat: Es war nicht sozialdarwinistisch unterlegtes Kämpfertum, sondern das Vertrauen auf- und Solidarität untereinander. Die verlässlichen Beziehungen zu den umsichtigen Schwestern waren letztlich lebensrettend. Negt spricht in diesem Zusammenhang von „Kraftquellen“ und – in Anlehnung an Kant – vom „Vernunftglauben“. Auf den verließen sich die Mädchen, auch wenn sie das Wort nicht kannten, etwa als sie den kleinen Bruder gegen bürokratische Versuche, das Trio zu trennen, hartnäckig verteidigten und zusammenblieben.
Dänische Flüchtlingspolitik
Im Internierungslager in Dänemark, zuerst unter deutscher, dann unter dänischer Regie, verbrachten die drei Negt-Kinder zweieinhalb Jahre ohne Schulbesuch. Insbesondere Oskar war auf Selbstbeschäftigung angewiesen, denn die Mädchen wurden zum Küchendienst herangezogen.
Über die dänische Flüchtlingspolitik unter dem beschönigenden Namen „Verhandlungspolitik“ erfuhr Negt Näheres erst viel später und durch „nachträgliche Reflexionen“. Aber er selbst und seine Schwestern erlitten im Lager weder Demütigungen, noch hungerten sie.
Für die Bürger Dänemarks ist diese Vergangenheit allerdings bis heute belastend, denn immerhin forderte der dänische Ärzteverband im März 1945, der großen Zahl von 240.000 Flüchtlingen keine medizinische Behandlung mehr zukommen zu lassen. Auch dank der Umsicht seiner Schwestern empfindet sich Oskar Negt nicht als Opfer unmenschlicher Härte, sondern als „Davongekommener“, dessen „Denken und Empfinden“ durch diese Erfahrung lebenslang geprägt wurden. Dank der Bemühungen des Roten Kreuzes konnten Oskar Negt und seine mittlerweile fast erwachsenen Schwestern nach Deutschland zu ihren unversehrten Eltern und Geschwistern zurückkehren. „Ich habe in meinem Leben viel Glück gehabt“ (Negt).
Die Familie lebte ab dem Sommer 1947 in der Sowjetischen Besatzungszone in der Nähe von Berlin. Aber der Vater fand sich mit der Zwangsvereinigung von SPD und KPD zur SED nicht ab und floh 1951 mit der Familie über Westberlin nach Niedersachsen. Das Bildungswesen in der SBZ bzw. DDR enttäuschte Oskar Negt: „Nichts, was hier über Marx und Lenin vermittelt wurde, ist mir haften geblieben“, stellt er heute fest. Erst mit dem 1955 bestandenen Abitur im Westen endeten für Negt zehn Jahre Flüchtlingsleben.
Damit hört die Lebensbeschreibung leider auf. Der Leser wäre der ebenso famosen wie reflektierten Lebensbeschreibung gern noch weiter gefolgt. Die Themen Flucht, Fremder, Asyl grundieren sein Denken bis heute, wie er in seinem Schlusskapitel deutlich macht.