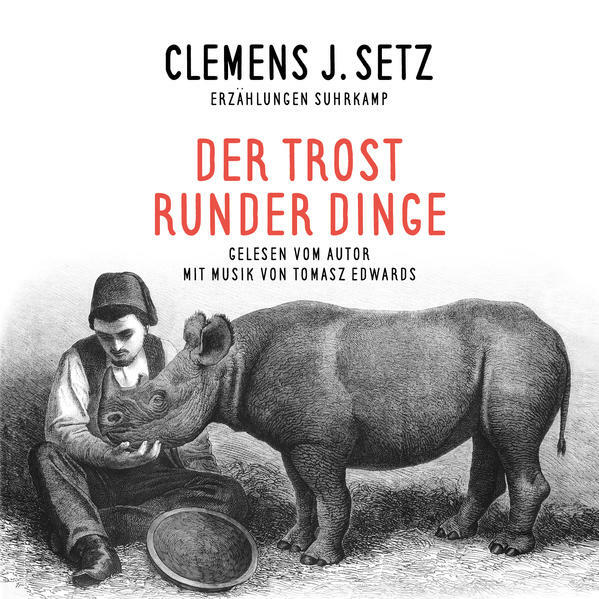Was geht mit dem?
Klaus Nüchtern in FALTER 12/2019 vom 20.03.2019 (S. 38)
Der Grazer Clemens J. Setz gilt als Österreichs schrägstes Literaturgenie. Warum eigentlich?
Seit seinem Debüt, dem noch im Residenz-Verlag erschienenen Roman „Söhne und Planeten“ (2007), steht der Grazer Clemens J. Setz unter Genieverdacht. Drei Romane (zu insgesamt 2220 Seiten) sowie einige Gedicht- und Prosabände sowie diverse Übersetzungen später hat sich dieser Ruf verfestigt. Stimmig fügen sich Werk und Autorenpersona – Setz hat neben Germanistik auch Mathematik studiert, kann zaubern, beherrscht den Obertongesang und hat sich neuerdings einen Hotzenplotzbart wachsen lassen – zum Bild eines schrägen, aber fraglos hochbegabten Vogels in der Voliere der heimischen Literatur.
Auch in seiner jüngsten Veröffentlichung, dem Erzählband „Der Trost runder Dinge“, beweist Setz ein Händchen für unheimliche und ungute Begegnungen, die – auch das längst Teil der Trademark – nicht unknapp garniert sind mit apokryphem Wissen aus allen möglichen Winkeln des Weltraums.
Insgesamt 20 „Erzählungen“ finden sich zwischen den Buchdeckeln, die längsten davon sind zwischen 30 und 40 Seiten, die kürzeste gerade einmal ein Hundertstel so lang. Selbst wenn man attestiert, dass bei einer solchen Menge nicht alle Texte gleich gut sein können, hätte es sich ein sorgsames Lektorat angelegen sein lassen können, die Standardabweichung zu minimieren und Ausreißer (nach unten) zu eliminieren. Im Falle einiger Kürzesttexte, von denen man sich fragt, was sie überhaupt in dem Buch zu suchen haben, wäre das ganz leicht zu bewerkstelligen gewesen. Aber auch einige Geschichten mittleren Umfangs hätten sich angeboten.
Zum Beispiel „Kvaløya“, eine Erzählung, die den Leserinnen und Lesern den mysteriösen McGuffin des Textes gleich im ersten Satz als Selbstverständlichkeit unterjubelt: „Wie man weiß, ist es nicht einfach mit einem Or zu verreisen.“ Viel klüger ist man auch 16 Seiten später nicht. Das Wesen, das man sich seines rundlichen Vokals und der Beschreibung („simple runde Form“) wegen eher knuffig vorstellt, verfügt offenbar über telekinetische Fähigkeiten, vermag zu weinen und zu lachen, ist gschamig beim Pinkeln und mag es nicht, wenn man ihm heißen Tee auf die Brust schüttet.
Vielleicht hatte der Autor beim Schreiben an die bizarren Kreaturen aus „The Utter Zoo“ des genialen amerikanischen Autors und Illustrators Edward Gorey gedacht, dessen Verse er selbst mit leichter Hand und elegant ins Deutsche übertragen hat („Der Kwongzu hat sehr große Klauen / Und mangelhaftes Weltvertrauen“). Wo aber bei Gorey Zeichnungen und Zweizeiler für zündenden Witz sorgen, verebben Setz’ Storys sehr oft im Pointenlosen.
Das gilt auch für „Ein See weiß mehr von der Erdkrümmung als wir“. Der Titel ist auch schon mit Abstand das Beste an der Geschichte, deren Icherzähler sich an einen Junggesellenabschiedsausflug nach Apulien erinnert, bei dem er und seine zwei Freunde einen aufdringlichen, als „Albaner“ bezeichneten Mann zusammenschlagen, der – wie sie später erfahren – Frauen „verwaltet“ haben soll, „Rumäninnen, vor allem. Fürchterliches Getier.“
Exemplarisch werden hier die Ingredienzien der Setz’schen Schauergeschichten vorgeführt: In einer Atmosphäre der latenten oder manifesten Gewalttätigkeit stehen Menschen, die sich aus nicht einsehbaren Gründen seltsam verhalten in undurchsichtigen Beziehungen zueinander. Garniert wird dieser ostentative Obskurantismus mit preziös-prätentiösen Metaphern und Vergleichen: „Hoch über uns hing, als Texturprobe einer ganz anders gemusterten Welt, der Mond“; das Portal einer Kirche sieht genau so aus wie „der Mund des Lehrers Lämpel aus ,Max und Moritz‘“; und das Getröpfel des Regens am Fensterbrett gilt dem Erzähler als „mein leises privates Geigerzählergeräusch der vergehenden Nachtstunden“.
Kann man bei solchen poetisierenden Passagen immerhin noch nachvollziehen, wie sie zustande gekommen sind, weiß man an anderen Stellen, die vorgeblich Alltägliches verhandeln, nicht mehr so recht, was überhaupt vor sich geht. Nachdem die Frau vergeblich versucht hat, ihrem Mann aufzuhelfen, heißt es: „Sie gab auf und zerrte ihm zumindest das schmutzige, graue Sakko vom Oberkörper. Dann griff sie in die Einkaufstasche und nahm einen anderen, zusammengefalteten Anzug heraus. Den zog sie ihm an.“
Clemens Setz ist fraglos ein origineller Kopf. Das Problem ist nur, dass aus einer Aneinanderreihung von skurrilen Einfällen und schrägen Beobachtungen noch keine Erzählung wird. „Südliches Lazarettfeld“ zerfällt in zwei vollkommen unverbundene Hälften. In der ersten Nacht bricht der Icherzähler zu einer Reise nach Kanada auf. Beim Frühstück zu Hause und auf dem Flughafen läuft das bekannte Setz’sche assoziative Kopfkino ab – launige SMS („Ich könnt schrein wie Norber Gstrein“), Flugkatastrophenfantasien, Günter-Eich-Paraphrasen („Hier mein Ticket. / Hier mein Pass. / Und dies ist mein Zwirn“.).
Als der Flug aus nicht näher benannten, aber offenbar bereits gewohnten Gründen („Das ist jetzt schon das neunte Mal“) nicht stattfindet, kehrt der Protagonist unverrichteter Dinge zurück, um die eigene, mit seiner Freundin geteilte Wohnung voller verwahrloster, grausig verunstalteter, siecher und stinkender Männer zu finden. End of Story.
Die längsten Erzählungen sind insgesamt auch die besten. In „Die Katze wohnt im Lalande’schen Himmel“ hat der Autor einigen Aufwand – inklusive der in die Geschichte eingebauten Fotos und Bilder – betrieben, um die Biografie des Art-brut-Künstlers Bernard Henri Conradi und seines ebenso fiktiven Arztes Dr. Jérôme Gehweyer aufzurollen; in „Otter Otter Otter“ entdeckt der Icherzähler, dass die Wohnung seiner blinden Geliebten über und über mit obszönen Graffiti beschmiert ist; und in „Geteiltes Leid“ beobachtet ein alleinerziehender Vater seine beiden Söhne in der Hoffnung, Symptome der eigenen Angststörung an diesen zu entdecken, und ist bitter enttäuscht, als sich die vermeintlich aufkeimende Panikattacke mit ein bisschen Internet-Recherche und zwei Rennie-Tabletten ansatzlos kurieren lässt.
Das sind starke Ideen, die aber so verarbeitet werden, als wollte jemand ausgesuchte Stoffe und ein Fass voller Strasssteinchen mit Uhu und einem Tacker aus dem Baumarkt in Haute Couture verwandeln. Das geht einfach besser. Wie’s gemacht wird, hat etwa George Saunders in seinem Erzählband „Zehnter Dezember“ (2014) gezeigt, dessen Szenarien um nichts weniger unheimlich und dessen Protagonisten um nichts weniger outspaced sind als jene von Clemens Setz, nur dass beim us-amerikanischen Kollegen wirklich große Literatur daraus wird.