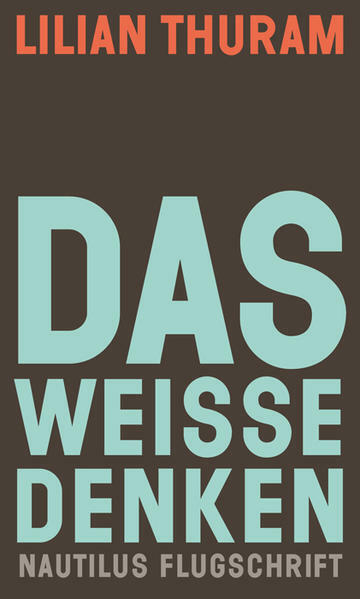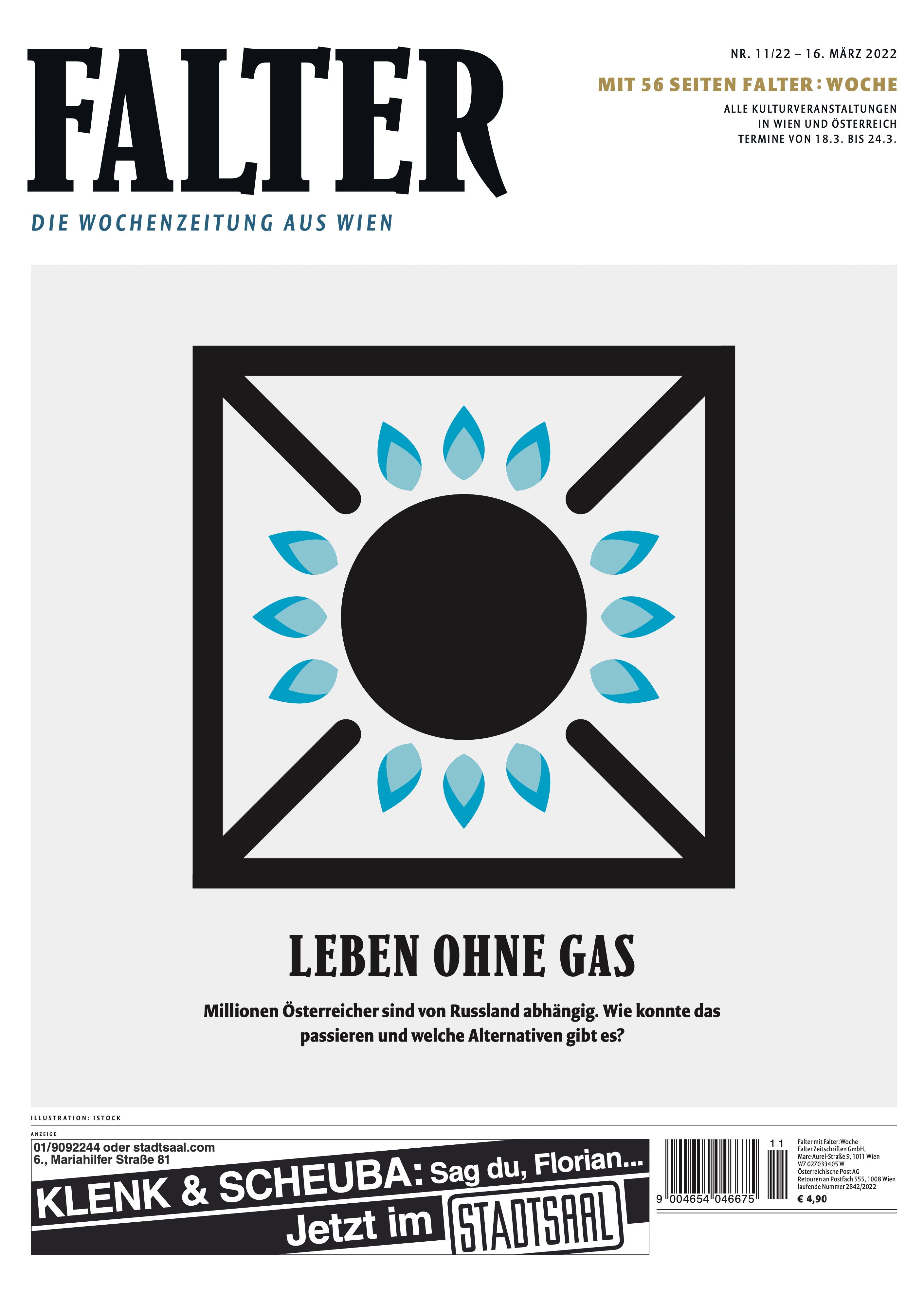
„Wer Geld hat, heiratet eine weiße Frau!“
Donja Noormofidi in FALTER 11/2022 vom 16.03.2022 (S. 43)
Am Beginn von Lilian Thurams Buch steht die Welt Kopf: Der Autor hat die Weltkarte umgedreht und ein, im Vergleich zu herkömmlichen Weltkarten, riesig erscheinendes Afrika in die Mitte gestellt. Für viele Nordamerikaner und Europäer bestehe kein Zweifel, dass ihr Land im Mittelpunkt der Welt stehe, so Thuram.
Lilian Thuram, geboren 1972 in Guadeloupe, war Fußball-Weltmeister, französischer Rekordnationalspieler und Star-Verteidiger bei AC Parma und Juventus Turin. Seit seinem Karriereende im Jahr 2008 widmet er sich ganz dem Kampf gegen Rassismus. Bereits 2005 kritisierte er den damaligen französischen Innenminister Nicolas Sarkozy, als dieser gemeint hatte, man müsse die Vororte von Paris mit dem Kärcher säubern. Auch Thuram ist in einem dieser Vororte aufgewachsen.
In seinem neuen Buch „Das weiße Denken“, soeben auf Deutsch erschienen, fokussiert er nun vor allem auf jene, die vom Rassismus profitieren – vielleicht ohne es zu wissen oder zu wollen. An konkreten Beispielen zeigt er, dass „die Überlieferung der Geschichte durch den Westen und das Christentum die Weißen ins Zentrum der Welt stellt“ – von der Antike über die Kolonialzeit und Sklaverei bis zum heutigen Tag. Andere Dinge würden ausgeblendet, zum Beispiel wenn es um die vermeintliche Entdeckung Amerikas geht: „Gibt es irgendeine Schule, an der Schüler*innen diese unfassbare Zahl gelehrt wird, dass nämlich 10 % der Weltbevölkerung, also über 50 Millionen Menschen, von den Kolonisatoren ausgelöscht wurden, und zwar ungefähr zu Beginn jener Epoche, die die weiße Welt als Renaissance bezeichnet?“
Durch die konsequente „Weißwaschung der Geschichte“ halte sich das „weiße Denken“ für die Norm. Thuram fragte etwa einen Freund: „Wenn ich Schwarz bin, was bist du dann?“ Er sei normal, antwortete der Freund spontan. Das „weiße Denken“ habe auch „die Gedankenwelt vieler nicht-weißer Menschen gekapert“. Auch schwarze Kinder würden sich Gott als weißen Mann mit langem Bart vorstellen.
Teamkollegen verspotteten Thuram sogar, weil er mit einer schwarzen Frau liiert war. „Man fragte mich sogar: ‚Magst du keine weißen Frauen? Bist du etwa Rassist?‘, als müsste ich mich in irgendeiner Form schuldig fühlen.“ Dies habe eine erstaunliche Geringschätzung „Schwarzer Frauen“ offenbart: „Denn woher kam die amüsierte Überraschung meiner Teamkollegen? Von der Tatsache, dass ich mit meinem Einkommen eine weiße Frau für mich hätte einnehmen können und das also auch hätte tun sollen. Wer Geld hat, hat ein großes Haus, ein dickes Auto, eine goldene Uhr, und heiratet eine weiße Frau!“
Struktureller Rassismus, so zeigt Thuram, gehört auch heute zum Alltag, obwohl etwa die französischen Gesetze Gleichheit versprechen. So würden „nicht-weiße Menschen“ öfter von der Polizei kontrolliert, steigen seltener beruflich auf und ernten täglich misstrauische Blicke.
Thuram fordert einen „Suizid der Race“, denn: „Die Erfindung der menschlichen ‚Rassen‘ dient nur dazu, die Solidarität zwischen den Menschen zu zerstören, ein Feindbild zu konstruieren, das die Ausbeutung der großen Mehrheit durch die Herrschaft der Wenigen ermöglicht.“ So wie Männer seit Jahrhunderten von der männlichen Vorherrschaft profitieren, profitierten auch die Weißen bis heute von der „systematischen Herabsetzung nicht-weißer Menschen“.
In Frankreich, wo das Buch schon 2020 erschien, erntete es viel Lob, aber auch Kritik von rechter und konservativer Seite, die darin zuweilen „antiweißen Rassismus“ vermutete. Tatsächlich spricht Thuram bloß unangenehme Wahrheiten an. Mit vielen Beispielen zeigt er Wurzeln, Mechanismen und Übel der „weißen Vorherrschaft“ auf. Die Kategorisierung in „Schwarz“ und „weiß“ – so die Schreibweise in dem Buch – meint dabei vor allem „eine politisch-soziale Kategorie innerhalb einer rassistisch strukturierten Gesellschaft“, wie die Übersetzerin der deutschen Ausgabe erklärt.
Es gehe ihm nicht um Schuldzuweisungen, betont Thuram. Es stehe jedoch auch in der Verantwortung jener, die von den Privilegien profitieren, für deren Abschaffung einzutreten. Es ist Zeit für einen Perspektivenwechsel, denn die Weltkarte am Anfang des Buchs ist nicht verkehrt und Afrika darin auch nicht übergroß. Die Darstellung nennt sich „Peters-Projektion“ und bildet bloß die realen Verhältnisse der Landmassen ab. Und da die Welt rund wie ein Fußball sei, so Thuram, könne man sie eben aus jeder beliebigen Richtung betrachten.