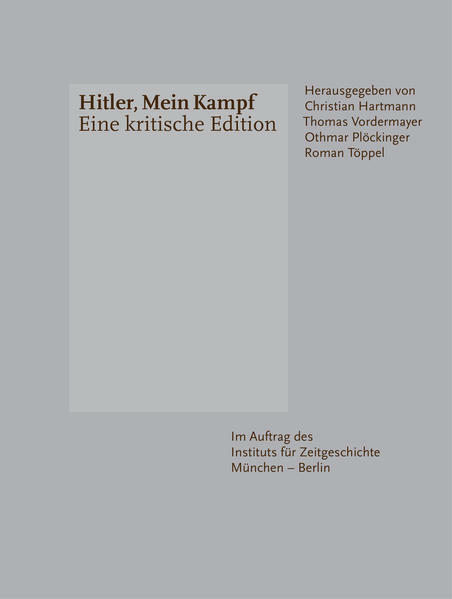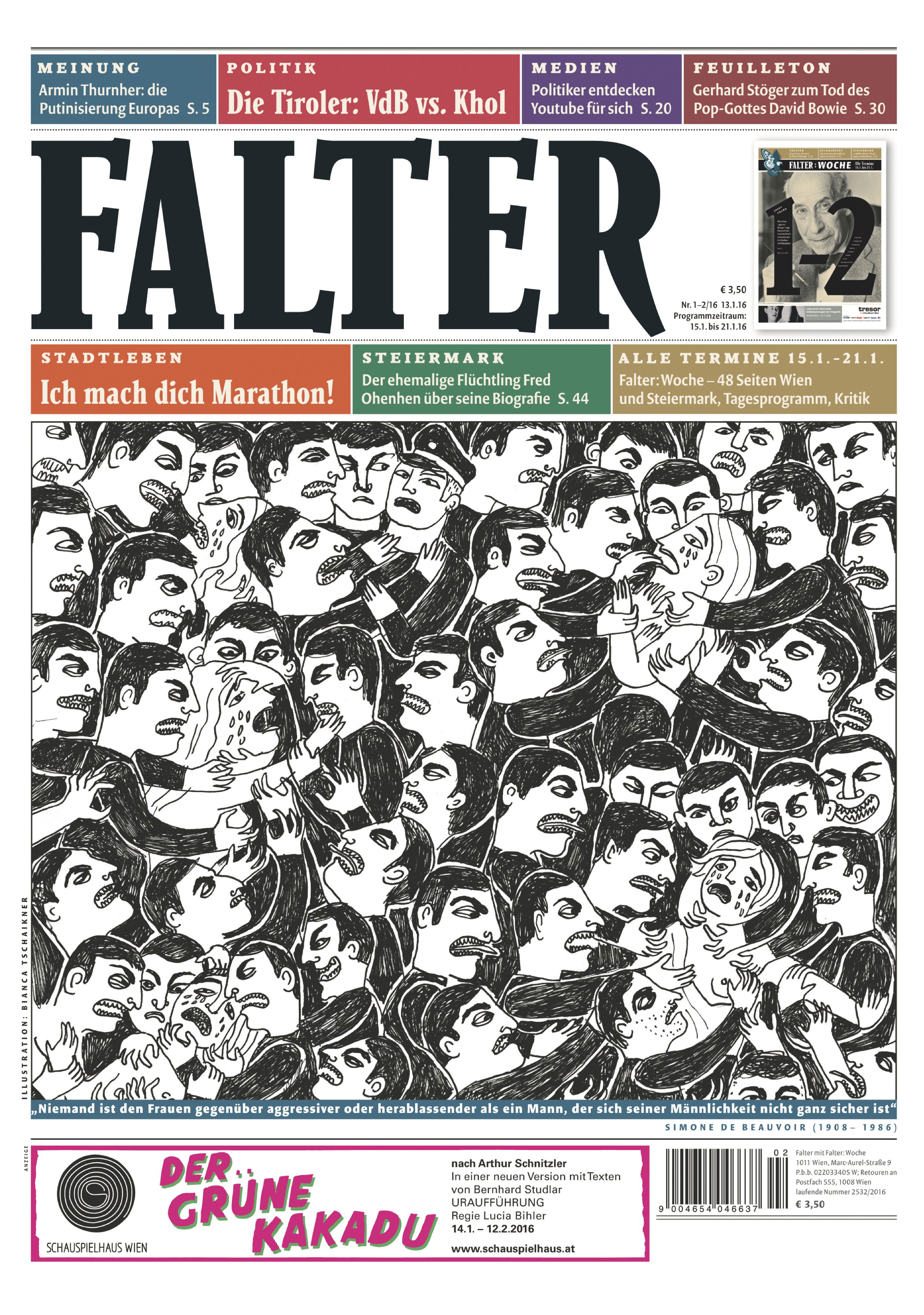
Eine Edition mit Standpunkt: Neuauflage von „Mein Kampf“
Rudolf Walther in FALTER 1-2/2016 vom 13.01.2016 (S. 17)
Warum es Sinn hat, dass ein Historikerteam des Münchner Instituts für Zeitgeschichte Adolf Hitlers Buch neu herausgibt
Seit ein paar Wochen herrscht Alarmstimmung im medialen Betrieb, genaugenommen seit dem Tag, als die Bild-Zeitung titelte: „Er ist wieder da“. Nicht Hitler zwar, aber sein Buch „Mein Kampf“. Am 1. Jänner 1916 lief die Schutzfrist für das Machwerk ab, als dessen Urheberrechtserbe sich der Freistaat Bayern während 70 Jahren darum bemühte, dass es keine Nachdrucke dafür gab.
Das war gar nicht nötig, denn von den bis 1944 in rund 1050 Auflagen gedruckten zwölf Millionen Exemplaren überlebten viele im Antiquariatshandel, wo das Buch immer erhältlich war – zu überhöhten Preisen, weil der Mythos, das Buch sei verboten, das Geschäft belebte. Das Buch war nicht verboten, sondern nur der unkommentierte Nachdruck zu kommerziellen und propagandistischen Zwecken.
Wer das Buch oder Teile davon nachdrucken wollte, musste dem bayerischen Finanzministerium gegenüber nur sein wissenschaftliches Interesse nachweisen. Es gibt momentan mindestens ein Dutzend Kommentare, Analysen und Teildrucke von wissenschaftlich ausgewiesenen Autoren, u.a. von Christian Zentner, Barbara Zehnpfennig, Othmar Plöckinger oder Sven Felix Kellerhoff.
Nachdem der unlängst verstorbene Historiker Hans Mommsen 2006 angeregt hatte, das Buch in einer wissenschaftlich kommentierten Edition zugänglich zu machen, entschied sich das Münchner Institut für Zeitgeschichte (IfZ) für eine solche Ausgabe. Der Freistaat Bayern versprach einen Forschungszuschuss von 500.000 Euro.
Dieses Versprechen brach Ministerpräsident Seehofer mit der Begründung, man könne nicht einen Verbotsantrag gegen die neonazistische NPD stellen und gleichzeitig die Edition von Hitlers „Mein Kampf“ mitfinanzieren. Doch man kann, denn Wissenschaft ist mehr als bauernschlauer Wahlkampf.
Seehofer fiel seine Ausrede erst nach einem Israel-Besuch ein, im bayerischen Wahlkampf. Auch andere Quelleneditionen wurden staatlich gefördert, so die 30 Bände der Goebbels-Tagebücher und die zwölf Bände mit Hitlers „Reden und Schriften“.
Im Selbstverlag
Vor rund drei Jahren begann ein Team von Wissenschaftlern des IfZ (Christian Hartmann, Othmar Plöckinger, Roman Töppel und Thomas Vondermayer) mit der Erarbeitung einer wissenschaftlich kommentierten Ausgabe von „Mein Kampf“.
Sie erscheint – zeitgleich mit dieser Falter-Ausgabe – am 12. Jänner in zwei Bänden mit 1948 Seiten und 3700 Fußnoten nicht in einem kommerziell engagierten Verlag, sondern im Selbstverlag des Forschungsinstituts. Damit steht die Edition über jedem Verdacht, politische oder geschäftliche Ziele zu verfolgen.
Was die Herausgeber vom IfZ beabsichtigen, ist einigermaßen einmalig. Es geht ihnen nicht um eine textkritische Edition, die die Entstehung eines Werkes von den Entwürfen über die Handschriften bis zu den Druckvarianten minutiös dokumentiert, sondern um die Korrektur und Kritik am Autor Hitler, um die Präsentation seiner verschwiegenen und verfälschten Quellen sowie um die autobiografischen Legenden und Lügen, die Hitler vor allem im ersten Band präsentierte. Der Herausgeber Christian Hartmann nennt dieses einmalige Konzept „Edition mit Standpunkt“ und vergleicht die Arbeit seines Teams mit der Arbeit eines „Kampfmittelräumdienstes, der Relikte aus der Nazi-Zeit unschädlich macht“.
Stilblüten und Schimpfwörter
In der Geschichtswissenschaft schwankt die Einschätzung von „Mein Kampf“ stark. Einige sehen darin nur eine autobiografisch geprägte „Abrechnung“ – der ursprüngliche Titel lautete „Viereinhalb Jahre Kampf gegen Lügen und Dummheit. Eine Abrechnung von Adolf Hitler“ – mit seinen militärischen und politischen Erfahrungen im Krieg und in der jungen Weimarer Republik. Der erste Band erschien im Juli 1925 und enthielt „wenig Neues“ – so die neue Hitler-Biografie Volker Ullrichs von 2013.
Neu war allenfalls, dass Hitler aus eigenen skurrilen und vielen fremden, nicht minder abstrusen Ideen eine „Weltanschauung“ destillierte: „die Ideologie des Nationalsozialismus“. Deren Hauptmerkmale sind Stilblüten und rund 600 antisemitische Schimpfwörter zur Herabsetzung von Juden.
Andere Autoren, wie die Historikerin Barbara Zehnpfennig, wollen in „Mein Kampf“ eine vom „Glauben an eine historische Mission“ inspirierte „Anleitung zur Welteroberung“ (NZZ 21.12.2015) sehen, also ein Programm für die Umsetzung der „Weltanschauung in die Tat“, das heißt der später verwirklichten nationalsozialistischen Eroberungs- und Vernichtungspolitik.
Zehnpfennig begibt sich allerdings nicht nur auf dünnes Eis, sondern vollends ins Reich völlig haltloser Improvisation mit ihrer Antwort auf die Frage „Warum kämpfte Hitler gegen die Juden nicht wie gegen die anderen Völker?“: „Hitler glaubte, es sei den Juden wesenseigen, so zu denken wie in den von ihm gehassten Ideologien vorgeführt. Sie müssten den Kampf ächten, den Kampfwilligen demoralisieren, weil sie herrschen, aber nicht kämpfen wollten. Er wollte vor allem ihr Denken ausrotten, weil er es als verderblich für die Menschheit ansah.“
Der rabiate Kampf gegen das Denken anderer war aber keine nationalsozialistische Spezialität, sondern hatte nach 1918 starke Wurzeln auch in den Ressentiments des radikal-konservativen und bürgerlich-nationalen Lagers gegen die Linke: „Der Andersdenkende, Andersempfindende und Andersgeartete“ musste „wie das Andersgeartete als solches“, das als „Dialektik der Andersheit das völkische Empfinden“ gestört hat, ausgerottet oder wenigstens mundtot gemacht werden, wie der Staatsrechtslehrer Carl Schmitt 1934 erklärte.