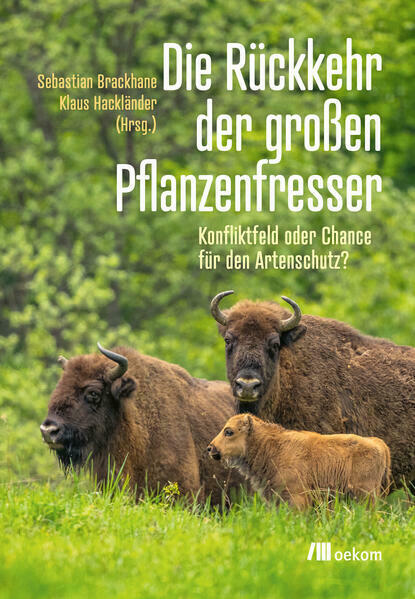Raum für Riesen
Katharina Kropshofer in FALTER 11/2025 vom 14.03.2025 (S. 43)
Die meisten Menschen würden diese graue Dusche meiden. Doch Harald Grabenhofer grinst an diesem Märztag breit. "Der hat uns gerade noch gefehlt!", sagt er und meint es auch. Das ganze Jahr lang hat es kaum geregnet. Nun fällt die Abhilfe für die Wiesen des Nationalparks Neusiedler See - Seewinkel endlich in zarten Tropfen vom Himmel.
Grabenhofer, der von allen nur "Harry" gerufen wird, trägt graumelierten Bart und einen lockigen Man Bun. Er koordiniert die Forschung hier im burgenländischen Schutzgebiet und ist damit so etwas wie der Herr der Wiesen: Hunderte seltene Pflanzen, aber vor allem rund 350 Vogelarten gilt es auf knapp 10.000 Hektar zu bewahren. Die Vögel suchen an den charakteristischen Salzlacken nach Nahrung, machen halt auf ihrem Weg in den Süden oder retour und brüten in der weiten, offenen Landschaft - der westlichste Ausläufer der eurasischen Steppe, die auf der anderen Seite in China endet. Damit diese Steppe Steppe bleiben kann, braucht es Grabenhofer - und vor allem seine "Mitarbeiter": 300 Graurinder und Wasserbüffel, außerdem circa 20 Weiße Esel und zwölf "wilde" Przewalski-Pferde grasen auf dem Areal des Nationalparks. Für einen bestimmten Zweck.
Grabenhofer hebt seinen Arm und zeigt auf eine Wiese mit weißen Flecken, Reste von Salzlacken. "Genau da könnte er brüten", sagt er und meint den Seeregenpfeifer, eine stark bedrohte Art. Nur noch sechs Brutpaare gibt es hier im Nationalpark. Wie gerufen erspäht er einen weiteren Profiteur: den Kiebitz, eine seltene Vogelart. "Für sie müssen wir die Flächen offen halten."
Wenn Pflanzenfresser wie Rinder oder Pferde grasen, drücken sie mit ihren Hufen Pflanzen klein. So wachsen keine Büsche oder Bäume mehr. Die würden nämlich seltene, an spezielle Standorte angepasste Pflanzen verdrängen. Dazu kommt, dass Vögel wie der Kiebitz oder der Seeregenpfeifer am Boden brüten. Sie brauchen dafür eine gute Aussicht, also eine weite Fläche ohne Büsche oder Bäume. Sieht der Kiebitz etwa einen Fuchs, spielt er verletzt und lockt den Räuber so von seinem Nest weg. Nur um im entscheidenden Moment doch noch wegzufliegen. Grabenhofer ist sich deshalb sicher: Wer Artenvielfalt erhalten will, braucht große Pflanzenfresser -wie die Rinder und Pferde, die hier grasen. Sie gehören teilweise dem Nationalpark, teilweise privaten Landwirten, die ihre Tiere auf den Nationalparkflächen grasen lassen dürfen.
Grabenhofer ist nicht der Einzige, der das erkannt hat. "Rewilding"-Projekte, wilde Weiden, Megafauna - in ganz Europa poppen diverse Projekte mit ähnlichem Ziel auf: Wisente, eine europäische Büffelart, grasten mehrere Jahre lang im deutschen Rothaargebirge; wilde Weiden zogen sich durch das französisch-deutsche Naturschutzgebiet Taubergießen; oder das niederländische Naturentwicklungsgebiet Oostvaardersplassen, das als Vorzeigebeispiel für ein artenreiches Feuchtgebiet mit Koniks (eine ausgewilderte Ponyart), Rothirschen und Heckrindern gilt. Überall dort wollen Naturschützer Pflanzenfresser wieder in die Landschaft bringen, indem sie wilde Tiere aussiedeln oder die Nachfahren ausgestorbener Arten gezielt grasen lassen. Und so nicht nur die Artenvielfalt beflügeln, sondern auch das Klima schützen.
Das klingt erst einmal paradox. Denn vor allem Rinder haben einen schlechten Ruf. Ihre gasförmigen Ausdünstungen, sowohl am hinteren als auch am vorderen Ende, bringen reichlich Methan in die Atmosphäre. Ein Treibhausgas, das 80-mal so stark ist wie die gleiche Menge CO2. Es trägt dazu bei, dass die Landwirtschaft für elf Prozent der Emissionen in Österreich verantwortlich ist. Und so stellt sich die Frage: Wer hat hier recht?
Am besten weiß wohl die Vergangenheit über die Gegenwart Bescheid: Über dem Eingang des Gregor-Mendel-Hauses, dem Hauptgebäude der Universität für Bodenkultur (Boku) in Wien, stehen vier Männer. Die Statuen stehen für die ursprünglichen Disziplinen der Uni, der Repräsentant der "Forstwirtschaft" hält einen toten Auerhahn in der Hand. "Es muss damals wirklich gewuselt haben vor Auerhühnern", sagt Klaus Hackländer, Professor für Wildtierbiologie und Jagdwirtschaft an der Boku - und liefert auch gleich die Erklärung dazu: Im 19. Jahrhundert trieben Landwirte in Österreich ihre Rinder noch in die Wälder. Die "Waldweide" hielt die Wälder offen, der Auerhahn fühlte sich im Tundraähnlichen Wald pudelwohl und vermehrte sich kräftig.
Später trennte man die Lebensräume strikter: Tiere mussten auf die Weide, der Wald blieb für die Holzproduktion. Die Folge: Für viele Pflanzen und Tiere wie den Auerhahn schwand der Lebensraum. Hackländer ist nicht nur Professor in Wien, sondern auch Vorstand der Deutschen Wildtier Stiftung mit Sitz in Hamburg. Diese betreut einige Beweidungsprojekte in Deutschland: etwa im Naturschutzgebiet Taubergießen am Oberrhein. Dort schicken Naturschützer Salers-Rinder und Konik-Ponys in die Aulandschaft. Sie dürfen selbstständig und ganzjährig Wald und Grünland beweiden und lichten so den Wald. Kleinere Strukturen bilden sich - und schaffen so Platz für Insekten, Pflanzen, Amphibien und Fledermäuse.
Heute leben in den wilden Weiden etwa doppelt so viele Zikadenarten und fünfmal so viele Heuschrecken wie auf den umliegenden Mähwiesen. "Wir wissen, dass wir so zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen können: Biodiversität erhöhen und etwas gegen den Klimawandel tun", sagt Hackländer. "Extensiv genutzte Weiden sind oft ein besserer Kohlenstoffspeicher als Wälder." Sind Kühe und andere Pflanzenfresser also eigentlich verkannte Klimahelden? Der Autor und Journalist Florian Schwinn nennt diese Sicht auf Kühe "Kuhwende" und regt sogar etwas an, das kontrovers geworden ist: Fleisch zu essen. Nicht die Billigware vom Discounter, sondern den bewährten Sonntagsbraten.
"Was wir dazu brauchen: den Mut, diese Landwirtschaft neu zu denken und neu aufzustellen, sie aus der Sackgasse der Industrialisierung herauszuholen und regional angepasst auch mal kleinräumiger zu gestalten. Außerdem brauchen wir robuste Kühe, die ganzjährig draußen leben können, die ohne Kraftfutter auskommen und dennoch Milch geben und Fleisch ansetzen", schreibt er in seinem Buch "Die Klima-Kuh". Die gute Nachricht: Es gibt sie. Ein paar hundert von ihnen heben kurz den Kopf, als das Auto von Harry Grabenhofer vorbeifährt. Auch wenn die Wasserbüffel an diesem regnerischen Donnerstag genauso gut im Stall bleiben könnten. Aneinandergereiht stehen sie auf der Wiese, recken die Köpfe, malmen mit den Kiefern, als würden sie einen gar zähen Kaugummi kauen.
Prinzipiell kann Grünland -abhängig von Bodenbedingungen und Feuchtigkeit - sogar mehr und länger Kohlenstoff speichern als Wälder. Vorausgesetzt, das Gras wird von Tieren konstant abgefressen und Insekten wie der Dungkäfer arbeiten Nährstoffe aus den Kuhfladen in den Boden ein. 34 Prozent des terrestrischen Kohlenstoffs soll in Grünoder Grasland gespeichert sein, das meiste als Wurzelbiomasse und Bodenkohlenstoff. Noch besser schneiden nur Moore ab.
Doch Grasland ist nicht gleich Grasland. Und hier wird es komplex. Den Durchblick bewahren Menschen wie Werner Zollitsch, der Leiter des Instituts für Nutztierwissenschaften an der Boku. Die Herstellung von Futtermitteln, Treibstoffe für Traktoren, Methan aus den Verdauungssystemen der Wiederkäuer -all das findet sich in Zollitschs Bewertungen wieder. Und auch wenn hier sehr viele Emissionen anfallen, weiß er: Die Kuh kann sehr wertvoll sein, wenn sie das tut, was sie am besten kann -Gras in Proteine umwandeln. "Nur Wiederkäuer können für Menschen nichtverzehrbare Biomasse in hochwertige Lebensmittel umwandeln", sagt Zollitsch.
Die Hochleistungskuh im Stall kann dieses Potenzial nicht ausleben. Aber gerade in Berggebieten mit viel Grasland, auf dem Landwirte kaum pflanzliche Lebensmittel anbauen können, wäre der Einsatz der Tiere sinnvoll. Auch auf Flächen, die schon degradiert sind, also wenig Humus enthalten, könnte sich eine Beweidung positiv auswirken. Gute Ackerflächen zu Weiden zu machen, wäre hingegen nicht schlau. Oder dort Kraftfutter für Tiere anzubauen, statt pflanzliche Lebensmittel für Menschen, so Zollitsch.
Neu ist diese Idee jedenfalls nicht. Wer heute an große Herden von Pflanzenfressern denkt, hat die Steppen Afrikas im Kopf, Büffel und Elefanten, Nilpferde und Nashörner. Doch noch bevor der Mensch die Landschaft nutzte, zogen solche Herden auch durch Europa. Das Steppen-und Wollhaarmammut, Auerochsen und Wildpferde grasten auf dem eurasischen Kontinent. Heute sind sich viele Wissenschaftler einig: Durch Siedlungen und immer intensivere Landwirtschaft hat der Mensch Wildpferde und Auerochsen spätestens im 10. Jahrhundert ausgerottet, Wollnashörner vielleicht schon in der Steinzeit -zumindest indirekt, durch Brandrodungen.
Doch selbst als keine wilden Herden mehr durchs Land zogen, setzten Menschen auf nomadische Weidehaltung. Auch im Burgenland hat diese eine lange Tradition. Sie machte die Landschaft erst zu der, die sie ist. 400 Jahre lang, etwa von 1350 bis 1750, trieben Händler bis zu 200.000 Grauochsen pro Jahr von ungarischen Zuchtgebieten durch Österreich bis nach Süddeutschland -eine gewaltige Menge auf einer gewaltigen Strecke, die so offen blieb.
Der "Europäische Oxenweg" war nicht nur Fleischlieferant für das wachsende Bürgertum, sondern auch ein großer Wirtschaftsfaktor -mit dem Wiener Ochsenmarkt (der heutige Heumarkt) als einem der größten Umschlagplätze. Auch für das Burgenland war die Viehzucht die naheliegendste Bewirtschaftung. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es allein im Bezirk Neusiedl noch rund 26.000 Rinder - heute sind es im ganzen Burgenland knapp 21.000.
Rund um den Neusiedler See stoppte die Beweidung in den 60er-Jahren. Botaniker, die schon damals um die wertvolle Landschaft Bescheid wussten, freuten sich. Sie dachten, die Rinder würden die besondere Salzvegetation, seltene Orchideen, zertrampeln. Heute weiß man: Für diese Salzlebensräume ist die Offenhaltung sogar notwendig. Die Befürworter setzten sich durch und nahmen die Beweidung wieder auf. Ihre Aufzeichnungen sind heute ein nützlicher Referenzrahmen für Forschende wie Harry Grabenhofer. Dieser hält das Nationalparkauto wieder an, sein Blick streift routinemäßig über die in Sepiafarben getauchte Graslandschaft. Bis er abrupt an einer für Außenstehende unsichtbaren Kante endet. "Da sieht man es gut: Hier ist die Fläche eigentlich schön abgefressen, da drüben wurde gemäht. Sinnvollerweise müssten wir das auch beweiden." Ginge es nach ihm, würden sich die Wasserbüffel und Graurinder, die Pferde und Esel noch vervielfachen.
Doch die Welt ist heute eine andere, fernab von Viehmärkten und Ochsenwegen. Landwirte zu finden, die Lust und vor allem genügend finanzielle Anreize haben, ihre Tiere auf die Weide zu schicken, überhaupt Viehwirtschaft zu betreiben, werden rar. Man könne auch nicht einfach jedes Tier auf jede Fläche stellen: Wasserbüffel eignen sich für Salzlacken, Ziegen fressen wiederum Büsche wie den Weißdorn, den andere verschmähen, Pferde können Schilf gut zurückdrängen.
Wo aber endet die Landwirtschaft, wo beginnt der Naturschutz - mit dem Einsatz von wilden oder Nutztieren? Der Wildtierbiologe Klaus Hackländer illustriert das am Beispiel Hirsch: Der ist eigentlich ein Grasfresser, hat sich aber längst in den Wald zurückgezogen und nagt dort an jungen Bäumen -zum Leidwesen der Forstwirte.
Wie also bringt man Hirsche oder gar größere Tiere zurück in halboffene, parkähnliche Landschaften? Und könnten sogar größere Pflanzenfresser, Elche oder Wisente, Platz finden? Immerhin wandern diese vermehrt aus Osteuropa gen Westen. Platz gäbe es in Europa durchaus, das zeigt eine Studie im Fachjournal Diversity and Distributions. Doch momentan ist der Mensch dort zu präsent, die Angst vor den Tieren zu groß, die potenziellen Flächen sind zu zersiedelt, von Autobahnen getrennt.
Hackländer ist sich deshalb sicher: Wenn es wieder mehr große Pflanzenfresser in Europa geben wird, dann primär hinter Zäunen, als gezielt eingesetzte Werkzeuge im Naturschutz - wie in den Projekten in Deutschland, den Niederlanden oder eben am Neusiedler See. Die extensive Beweidung sei irgendetwas "zwischen Liebhaberei und wirtschaftlichem Schwachsinn", sagt er, nur durch Agrarförderungen rentabel. Und so gerade in der Landwirtschaft eine Gratwanderung.
Wer seine Wiese intensiv bewirtschaftet, Kunstdünger einsetzt, mehr Ertrag produziert, kann immerhin mehr Geld machen - aber schadet Klima und Biodiversität. Wie also stärkt man Beweidungsprojekte? Verknüpft Naturschutzanliegen mit landwirtschaftlichen Interessen?
"Landwirte brauchen ein neues Selbstbild: Sie müssen zu Landschaftspflegern werden", sagt Harry Grabenhofer. "Und wir müssen das entsprechend entschädigen." Schon heute sind viele Agrarförderungen an Flächen, nicht nur an Produkte gebunden. Geht es nach ihm, dann würden Landwirte stärker von Naturschutzleistungen profitieren - und dazu zählt auch die Beweidung.
Eines ist klar: Schon jetzt kommen auch viele Besucher in den Nationalpark, weil sie die Przewalski-Pferde oder die Wasserbüffel sehen wollen. Sie sind nun Teil der Landschaft. "Viele denken, Naturschutz heißt Glassturz drüber und fertig. Wir müssen mit diesem Klischee aufräumen", sagt Grabenhofer. Denn selbst die geschützten, wertvollen Steppenflächen des Nationalparks sind Teil einer jahrhundertealten Kulturlandschaft, die von Menschen geprägt wurde - und eben auch von großen Pflanzenfressern.