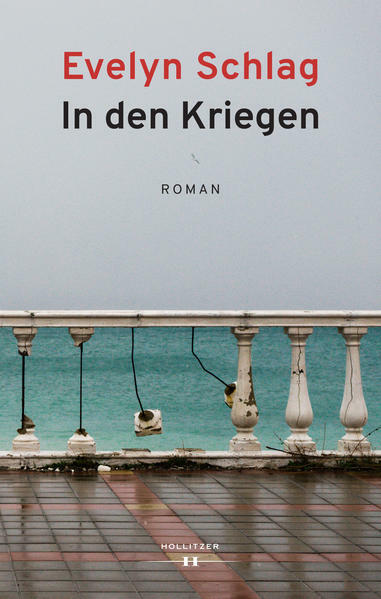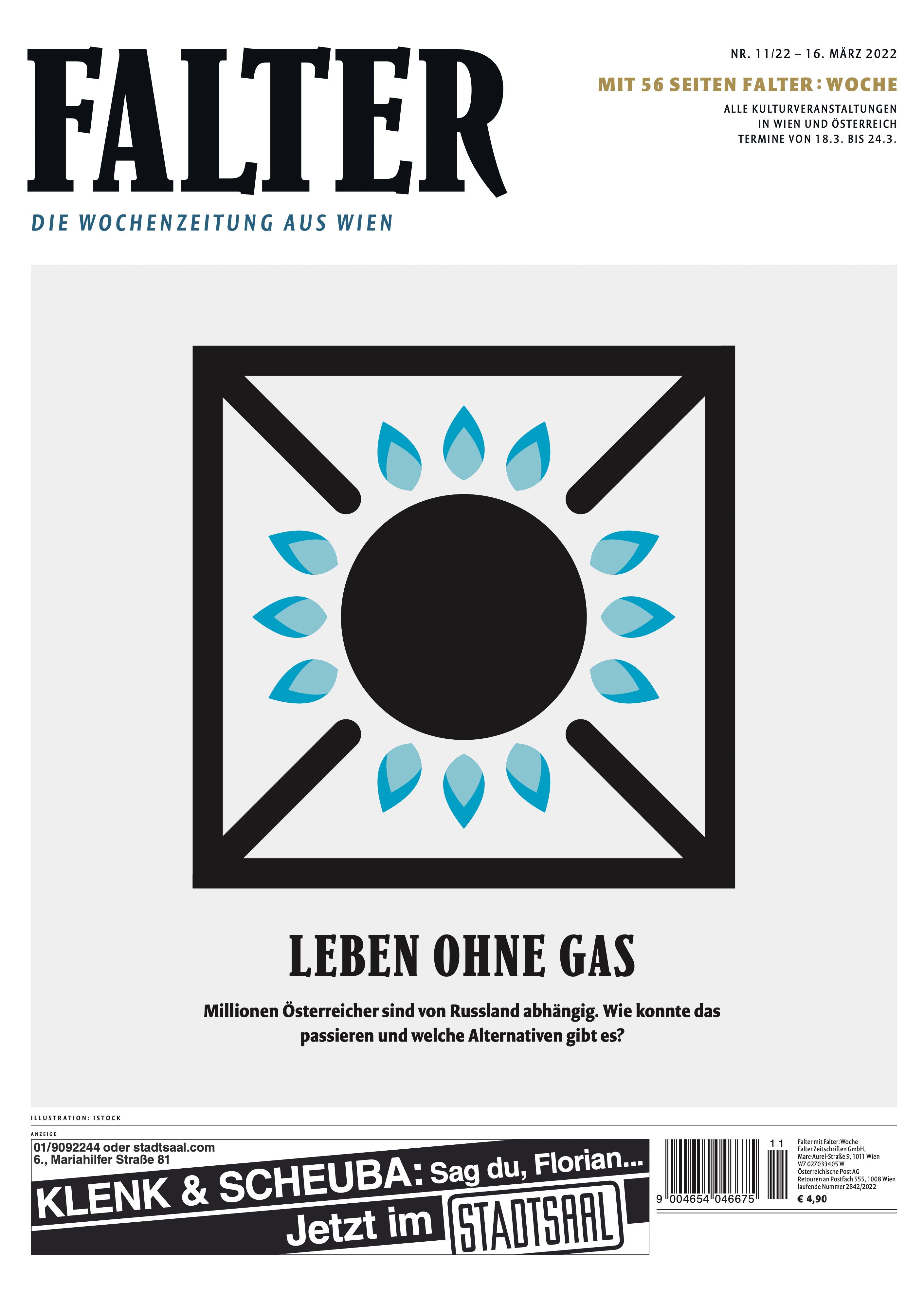
Eine Wallfahrt gegen den Krieg
Stefanie Panzenböck in FALTER 11/2022 vom 16.03.2022 (S. 12)
Zwei Männer sprechen über den Krieg. Die beiden Deutschen Jens und Iwo sitzen irgendwo in der Ukraine und erinnern sich an die Kämpfe im „Osten“, an denen sie als Freiwillige teilgenommen haben, aufseiten der Ukraine gegen die Separatisten. Zwar denkt man dabei sofort an den bewaffneten Konflikt im Donbass, der nach der russischen Invasion auf der Halbinsel Krim im März 2014 ausgebrochen ist, doch es könnte auch ein fiktiver Krieg sein.
Die aus Niederösterreich stammende Schriftstellerin Evelyn Schlag nennt keine Orte. Sie zeichnet Umrisse, wirft ein paar Skizzen hin. Die Handlung bleibt den ganzen Roman hindurch wenig konkret. Offenbar geht es der Autorin darum, den Krieg als Phänomen zu erfassen. Für Leid, Elend und Zerstörung findet sie Bilder, die bisweilen eindrücklich sind, manchmal aber auch unverständlich bleiben. Der Krieg, der gerade zu Ende gegangen ist, verschwimmt im Laufe der Zeit immer mehr mit dem Zweiten Weltkrieg, als die deutsche Wehrmacht 1941 die Ukraine überfiel. Jens fragt sich, ob sein Urgroßvater, „der olle Krüger“, an Kriegsverbrechen beteiligt war.
Der Großteil des Romans handelt von einer „Wallfahrt“, wie es die Protagonisten nennen. Tanja, die Partnerin von Andrij, einem Freund, der mit Iwo und Jens gekämpft hat und gestorben ist, bringt sie auf die Idee. „Sie sagte, sie müsse ihre Trauer so weit weg wie möglich tragen, durch dieses unglückliche Land. Wie sollte sie sonst begreifen, dass Andrij für immer aus der Welt war.“
Zu viert – Vitalij, ein Dichter und Abenteurer, ist ebenfalls mit dabei – machen sie sich auf den Weg zur „Halbinsel“, die ebenfalls nicht näher lokalisiert oder beschrieben wird. Es soll „eine Wallfahrt für Andrij und gegen die Kriege“ sein.
Was nun folgt, gleicht dem Gang durch eine Gemäldegalerie. Von Station zu Station folgen die Leserinnen und Leser den vieren auf deren Weg, den sie im Übrigen zu Fuß zurücklegen. Für jede Situation, in die Tanja, Jens, Iwo und Vitalij geraten, findet die Autorin ein anderes Bild. Selten wird ein klarer Handlungsablauf ersichtlich, vielmehr überlagern sich Wortspiele, die wie abstrakte Malerei anmuten.
Die Ereignisse, mit denen das Quartett konfrontiert wird, lassen viel Deutungsspielraum zu – etwa als die vier bei minus 50 Grad an einem Teich stehen und für Sekunden in einem Eiszapfen eine Berehynia, eine weibliche Figur aus der slawischen Mythologie, erkennen, die auch das Symbol der unabhängigen Ukraine ist – oder sind so überzeichnet, dass sie einfach nur skurril wirken. Etwa wenn Vitalij und Jens in einem Hinterzimmer aus einem Stapel von Decken eine rote hervorziehen und sich fragen, ob es Infrarot sein könnte. „Ich habe keinen Schimmer, wie das funktioniert. Kann man das Ende des Sommers einwecken? Mit einer dünnen Scheibe Rum darüber?“
Vom Infrarot zur Scheibe Rum geht es weiter zu Tanja, die wie eine Wölfin heult und dann meint, dass das ganze Dorf dazu gezwungen werde, unter einer Decke zu schlafen, um das Individuum auszulöschen. Hinweise auf die Geschichte der Sowjetunion und die Zwangskollektivierung aller Lebensbereiche? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Das Bild der roten Decke ist jedenfalls nicht stark genug, um abseits symbolischer Bedeutsamkeit bestehen zu können.
Die Welt, durch die die vier Wallfahrer ziehen, ist nahezu menschenleer. Wenn doch einmal jemand auftaucht, ist es nicht selten eine Stimme aus der Vergangenheit. Jens fühlt sich immer mehr von seinem Urgroßvater verfolgt. Und er hört Jüdinnen und Juden schreien, die in einem Viehwaggon eingesperrt sind und deportiert werden sollen. Tote des Holodomor, der von Stalin gesteuerten Hungersnot Anfang der 1930er-Jahre, melden sich zu Wort. Dann sagt Tanja einen der Schlüsselsätze des Romans: „Wir müssen hier weg. Hier vergeht die Vergangenheit nicht.“ Doch leider driftet der Roman immer mehr ins Diffuse ab. „In den Kriegen“ ist ambitioniert, sprachlich wie thematisch, am Ende bleibt aber vor allem Ratlosigkeit.