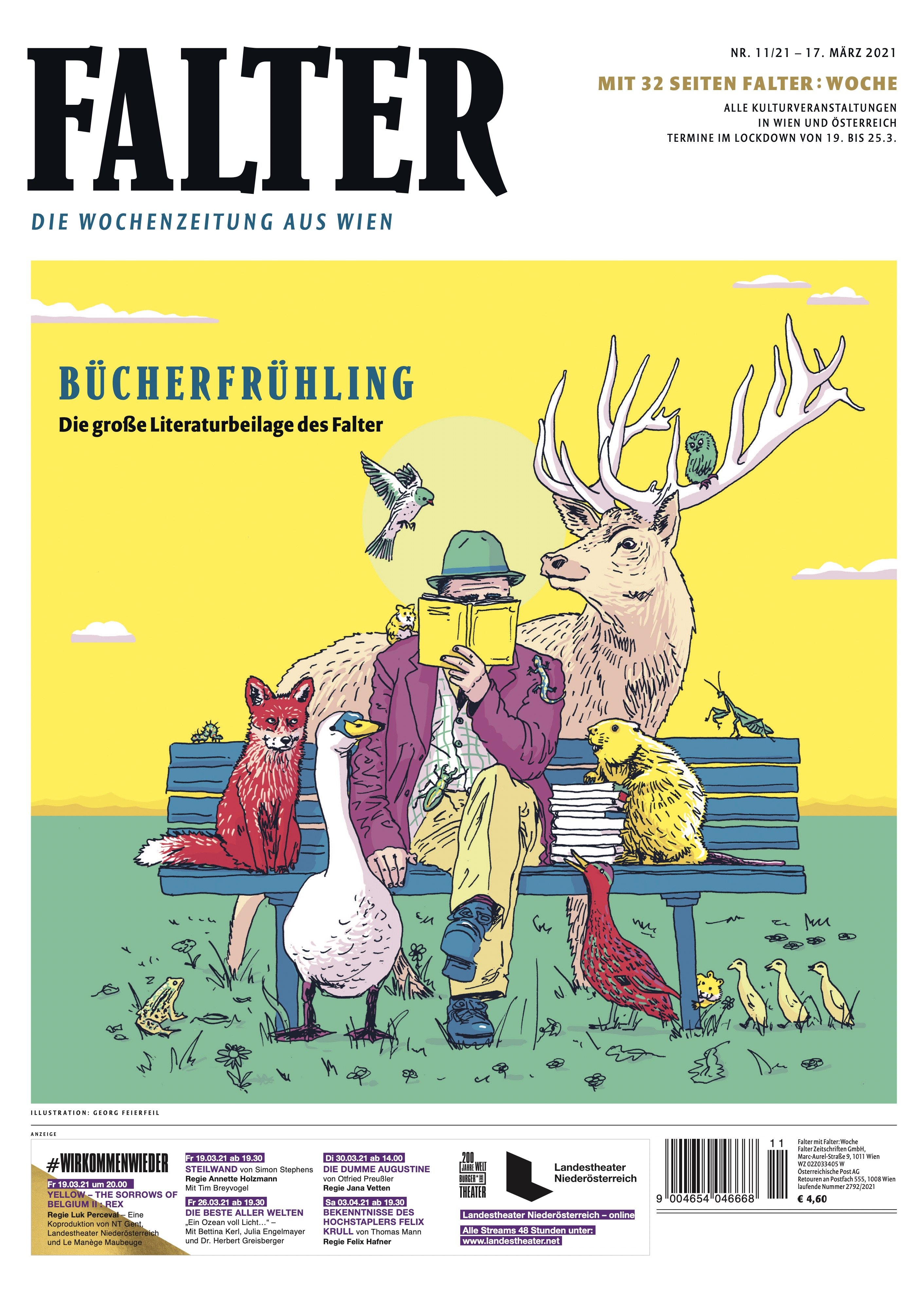
Der Kopf von Rosa Luxemburg
Florian Barany in FALTER 11/2021 vom 17.03.2021 (S. 10)
Hermann Troll, Hilfsgärtner in einem Berliner Museum, das sich auf die Ausstellung einer dubiosen Sammlung von Schädeln, Büsten und sonstigen kopfförmigen Artefakte spezialisiert hat, ist ein seltsam vergeistigte Außenseiter. Troll, der in
einer nicht begründeten Antipathie gegenüber den wenigen anderen
Mitarbeitern des „Kopfmuseums“ verharrt, fristet seine Arbeitstage damit, in einem Holzverschlag auf dem Museumsgelände, einen riesigen Gesteinsbrocken – den titelgebenden „Irrblock“ – von Flechten zu befreien.
Die Flechten wachsen auf unerklärliche Weise so schnell, dass diese Arbeit Troll zu einem Sisyphus jenseits antiker Tragik macht. Das Zurechtschneiden der Flechte scheint bei diesem geradezu libidinös besetzt zu sein, ein Umstand, der auch dessen Lebensgefährtin Unbehagen bereitet: „Seiner Lebensgefährtin Ariana sei die Flechte unerträglich, nach der er so penetrant rieche und schmecke, dass für sie eine Nähe in irgendeiner Form schließlich ausgeschlossen sei, sie habe keine Lust mehr, mit so einem Flechtenuntier über Umwege geschlechtlich zu verkehren, denn er gleiche einem stinkenden Ableger dieser Pilzbraut, an der er sich aufgeile.“
Ob die Arbeit an der Flechte eine allegorische Übersetzung der Libido in mäandernde Satzkonstruktionen ist, über diese und ähnliche Fragen kann man sich bei der Lektüre von „Irrblock“ über hunderte Seiten den Kopf zerbrechen. Denn insgesamt ist der aus München gebürtige und in Berlin lebende Autor an einer Verrätselung und Anreicherung mit
literarischen Bezügen der langen Satzperioden mehr interessiert als an einem wie auch immer gearteten
Erzählen. Seine Inspiration bezieht er dabei aus aktuellen Diskursen über die Kolonialgeschichte musealer Objekte, er verarbeitet offenbar aufwendig recherchiertes historisches Material und allerlei botanisches Wissen.
In weiterer Folge treten in „Irrblock“ die Mutter des Hilfsgärtners und dessen Großvater auf, der schon früh der NSDAP beitrat und diesem Umstand seine Karriere als Professor für Veterinärmedizin verdankte. Anhand dieser Figur und dem entsprechenden Handlungsstrang, der immer wieder mit Büchners „Woyzeck“ verschnitten wird, legt Ruoff eine Geschichte von Täterschaft, Kriegsgefangenschaft und Bombentraumata aus dem Luftkrieg frei, die auf Hermann Troll und seiner an Mundfäule leidenden und mittlerweile im Altersheim lebenden Mutter Irene lasten.
Das „Kopfmuseum“, so erfährt man spät im Text, der zu Beginn eher unfreiwillig als reflektiert an Thomas Bernhards „Alte Meister“ erinnert und in späteren Teilen Franz Kafkas „Der Jäger Gracchus“ als Schablone benutzt, befindet sich im Gebäude des ehemaligen Frauengefängnisses in der Berliner Barnimstraße. Rosa Luxemburg, die 1907 und 1915 dort inhaftiert war, betritt als untote „Jägerin Gracchus“ das „Kopfmuseum“ und wird zur späten Hauptfigur von „Irrblock“. Der Gesteinsbrocken ist nämlich selbst ein irgendwann aus der Erde aufgetauchter, vergrößerter Kopf einer Rosa-Luxemburg-Gedenkbüste, die 1950 im Frauengefängnis ausgestellt wurde und in die Gegenwart Hermann Trolls als Objekt seltsam anmutender Verehrung eindringt. Ruoffs Versuch, mit „Irrblock“ eine allegorische Dekonstruktion des Albdrucks der Geschichte zu leisten, betreibt großen Aufwand, ist aber steril und langatmig geraten.




