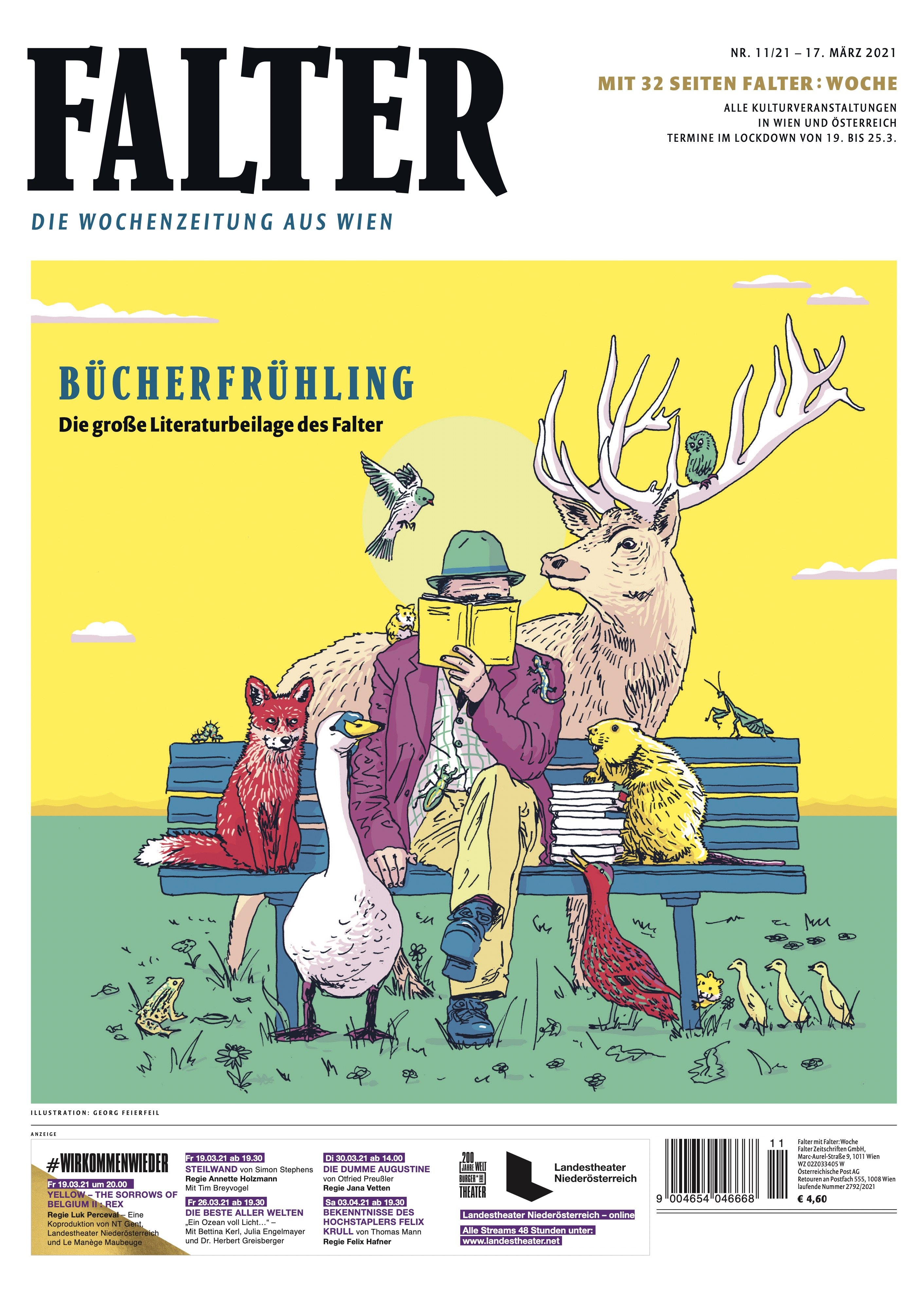
Das Öffnen einer Holzmatrjoschka
Sebastian Gilli in FALTER 11/2021 vom 17.03.2021 (S. 22)
Aus ihr hätte eine „echte, aufrichtige und ergebene Kommunistin“ werden können, weiß Volha Hapeyeva, die Ich-Erzählerin des Romans „Camel Travel“, der von einer Autorin aus Belarus geschrieben wurde, die ebenfalls Volha Hapeyeva heißt. Sie wuchs in Minsk in den letzten Jahren sowjetischer Herrschaft auf, wo wir sie als „Oktoberkind“ kennenlernen. Oktoberkinder war der Name einer Jugendorganisation, in der alle Schulanfänger ideologisch geimpft wurden. Dass aus Volha dennoch keine stramme Kommunistin wurde, liegt am nahen Ende der UdSSR und daran, dass die Mutter Lenin nicht leiden konnte.
Durch die Augen ihres Kindheits-Ichs betreibt die 1982 in Minsk geborene Hapeyeva spielerisch Autofiktion, angetrieben durch die Neugier für das Verhalten des Kindes, das sie damals war. Sie fragt sich: Warum ist meine Generation so, wie sie heute ist?
Die unmittelbare Gegenwart aber wird in diesem im Original bereits 2019, also vor den Protesten gegen die Wahlmanipulation erschienenen Roman nicht berührt. Dennoch passt so mancher Satz zu den Bildern, die man in letzter Zeit aus Belarus zu sehen bekommt. Vor allem die Bilder von den Frauen, die für die Freilassung politischer Gefangener auf die Straße gehen: „Wir glaubten, dass Worte die Realität verändern, uns schützen oder unsere Peiniger strafen konnten.“
Das Politische wird bei der Hapeyeva, die Teil eines unabhängigen Schriftstellerverbandes in Belarus ist und als Lyrikerin Bekanntheit erlangt hat, im Subtext verhandelt. Frauenpower aber gerät bei der promovierten Linguistin, die auch Gender Studies studiert hat, zur konkreten Ansage. Mit Judith Butler und Co erkennt die Erwachsene in den kindlich-subversiven Handlungen von damals („Silberstaub des Feminismus“) ihren heutigen Einsatz gegen „gewaltsame Geschlechtszuschreibungen“.
Das eigenwillige Mädchen, das als Einzelkind bei der zum Lob unfähigen Mutter „mit spartanischer Härte“ aufwuchs, lernt recht schnell, sich gegen Ungerechtigkeiten zu wehren. Einmal wird der kleinen Volha zugerufen, sie solle ans Heiraten denken und nicht Ball spielen. „Nach so etwas willst du mit einem glühenden Eisen alles in dir ausbrennen, was die anderen daran erinnert, dass du ein Mädchen bist. Weil du nicht heiraten willst, sondern Ball spielen.“
Auch in der Schule passieren die spannenden Dinge wie der Tausch von Comicstrips gleichsam im Untergrund. Ein Hang zur Schönheit kann in der schulischen Bastelstunde nicht anerkannt werden: „Origami à la UdSSR: maximale Funktion bei minimaler Ästhetik“.
„Camel Travel“ beginnt mit einer Reise an den See Issyk-Kul in Kirgisien, auf der ein Foto der kleinen Volha auf einem Kamel entstand. Der Titel steht für das Leben als Reise und sinnbildlich für das gegenwärtige nomadische Leben der Autorin, die sich zurzeit in Österreich aufhält. Vor einem Jahr war sie Stadtschreiberin in Graz. In Belarus zu leben wäre für die „Außenseiterin und Randständige“ aufgrund der derzeitigen politischen Lage zu gefährlich.
Das „brave Oktoberkind“ Volha wächst zwischen gutbürgerlicher Herkunft und sowjetischer Mangelwirtschaft („Auswahl verdirbt“) auf, stets begleitet von der „Identifikationsfrage“, die sie verwirrt: dass es zwei Länder, zwei Hauptstädte, dann zwei Hymnen und schließlich auch zwei Sprachen gibt. „Als lebten wir parallel in zwei Dimensionen oder im Bauch einer russischen Holzmatrjoschka.“
Hapeyeva, die in ihrer Muttersprache Belarusisch schreibt, öffnet diese Matrjoschka. Heraus kommt in 20 Kapitel auf lediglich 120 Seiten ein kluges, provokantes und humorvolles Stück Literatur, das mit alltäglichen Motiven eine gar nicht so weit entfernte Zeit in einem hierzulande weitgehend unbekannten Land lebendig macht.



