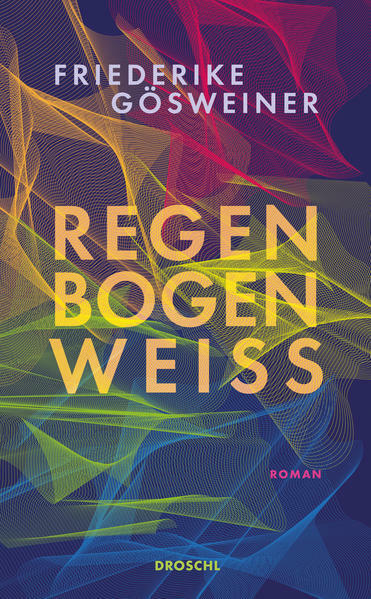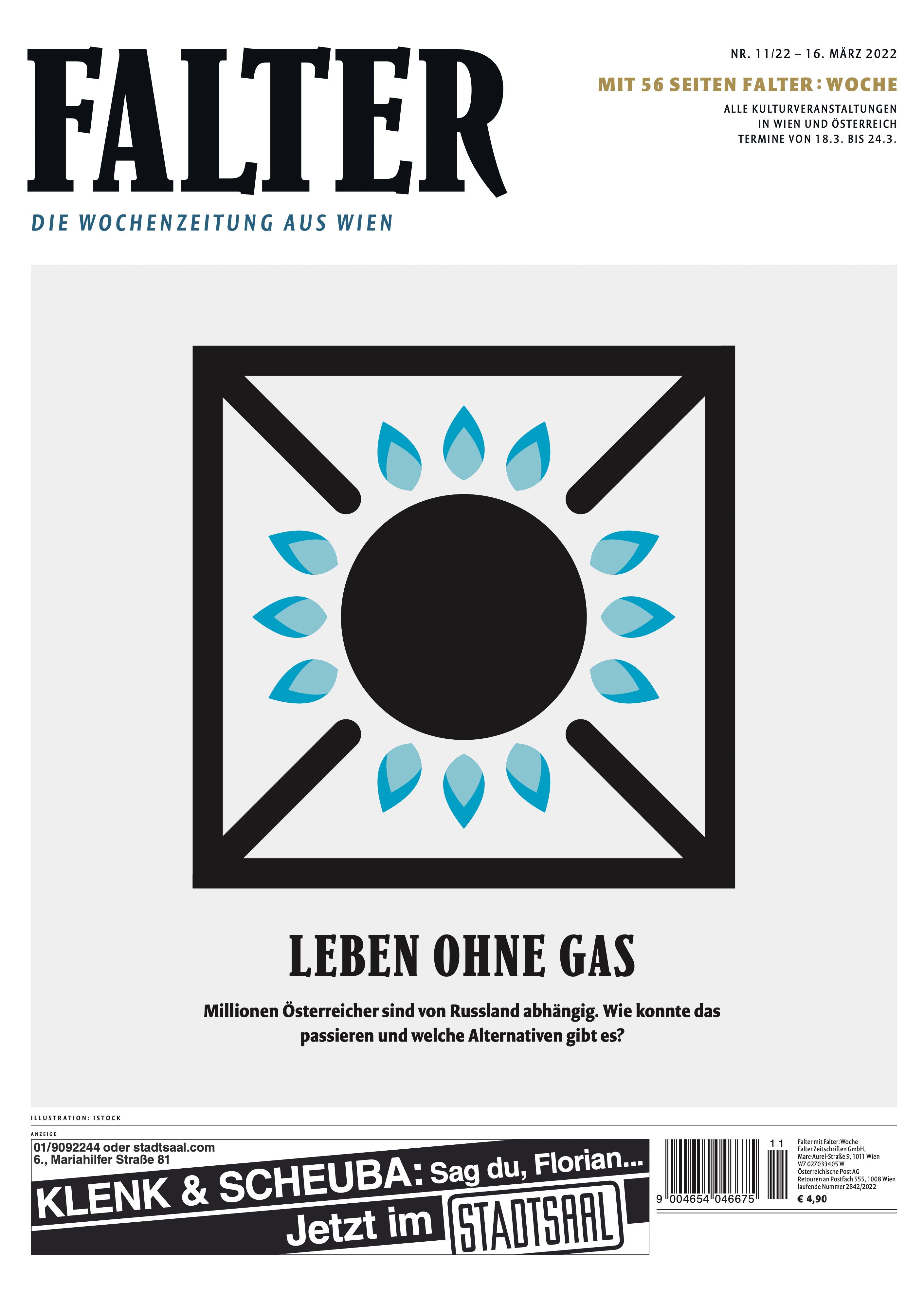
Fast wie im richtigen Leben
Sebastian Fasthuber in FALTER 11/2022 vom 16.03.2022 (S. 12)
Sie sah das Auto noch in der Einfahrt stehen, die Heckklappe geöffnet, sah ihren Mann eine Bierkiste in den Kofferraum des Wagens heben. Gut, dachte sie, dann kann ich ihn an die Milch noch erinnern. Und sie war dabei, das Fenster zu öffnen, als sie ihn zu Boden gehen sah, dann hinter dem Auto liegen sah, auf dem Asphalt. Sie erschrak. So sah kein Sturz aus.“
Es beginnt mit einem Alltagsmoment, nach dem plötzlich alles anders ist. Marlene, Anfang 60 und frisch pensionierte Deutschlehrerin, kann ihrem Hermann nach seinem Herzinfarkt nicht mehr helfen. Auch die Versuche der Rettung, ihn zu reanimieren, scheitern. Wenige Stunden später steht die Frau am Totenbett des Mannes, mit dem sie den Großteil ihres Lebens verbracht hat.
Die Kinder eilen herbei. Tochter Filippa aus Paris, wo sie versucht, sich als Germanistin zu habilitieren; Sohn Bob von irgendwo, vielleicht aus Holland, wo er seinen Doktor in Physik gemacht hat, oder von einer der Touren als Reiseleiter, mit denen er sein Leben finanziert. Am Abend des Begräbnistages stehen die Geschwister und Marlene draußen beisammen, schnaufen einmal kurz durch: „Und alle sahen in dieselbe Richtung, sahen zu dem Fluss, standen zusammen, jeder für sich.“ Gemeinsam und doch getrennt: In diesem Bild ist das Wesen dieser Familie, ja vielleicht von Familie überhaupt, auf den Punkt gebracht.
Friederike Gösweiner verfügt über eine sehr gute Beobachtungsgabe und ein feines Sprachgefühl. Die große Geste liegt ihr fern. Hinter vorgehaltener Hand bejammern Verlagsmenschen ja oft, dass Autorinnen und Autoren heute schiefe Bilder am laufenden Band produzierten. Insofern stellt die Tirolerin, die für „Traurige Freiheit“ (2016) den Österreichischen Buchpreis in der Kategorie Debüt gewann, wohl eine Ausnahme dar. Ihrem zweiten Roman „Regenbogenweiß“ ist anzumerken, dass sie jahrelang daran gearbeitet hat. Von der Figurenzeichnung über die Dialoge bis zum Handlungsbogen ist hier alles präzise gearbeitet, ohne ins Klinisch-Sterile zu verfallen.
Der Roman folgt den Wegen der Familienmitglieder vom 18. November 2014, Hermanns Todestag, über genau eineinhalb Jahre. Die Mutter trauert allein im viel zu großen Haus um die Liebe ihres Lebens, weiß wenig mit sich anzufangen. Das ändert sich, als 2015 der große Flüchtlingsstrom kommt. Marlene wird gebraucht, sie gibt Deutschkurse und bringt die Burschen zum Fußballtraining.
Bob ist mit seinem Vater oft im Clinch gelegen, auch die letzte Begegnung der beiden endete im Streit. Sie waren sich sehr ähnlich, beide Physiker, allerdings mit unterschiedlichen Fachrichtungen. Der Vater hätte Bob gern in seiner Forschungsgruppe gehabt. Doch der Sohn erwies sich als ebenso stur wie er selbst. Das Trauern fällt ihm nun schwer. Er zieht sich zum Nachdenken in ein Dorf auf Kreta zurück.
Filippa wiederum will es immer allen recht machen und bleibt dabei selber auf der Strecke. Beruflich weit von einer Festanstellung entfernt, privat in einer Fernbeziehung und obendrein der Puffer zwischen Mutter und Bruder, verspürt sie darüber hinaus mit 35 auch bereits „Fortpflanzungsdruck“. Sie weiß zwar, dass das alles Luxusprobleme sind, aber es zu wissen, macht sie nicht weniger traurig.
Apropos First World Problems: Gösweiner gelingt es immer wieder geschickt, das Politische im Privaten aufzuzeigen. Als Bob auf Kreta die Frage nach seiner Herkunft lässig mit dem Hinweis beantwortet, dass das doch keine Rolle spielte, repliziert ein Grieche: “Let me tell you, my friend! You are wrong. Your are not citizen of planet earth. You have a passport. This passport decides your fate.”
Auch die Geschlechterverhältnisse sind ein Thema. Gösweiner stößt einen zwar nicht mit der Nase darauf, aber es ist irgendwann nicht mehr zu übersehen, dass die Rollenverteilung in der sich als progressiv begreifenden Familie absolut traditionell ist. Die Männer leisten als naturwissenschaftliche Genies die total wichtige Arbeit, bei der man sie auf keinen Fall stören darf. Und die Frauen dürfen, solange sie den Laden am Laufen halten, sich in den weichen Geisteswissenschaften verwirklichen. Die Figuren, allen voran Bob, buhlen nicht um Sympathie. Weil sie mit Stärken und Schwächen glaubwürdig gezeichnet sind, gehen sie einem trotzdem nahe.
„Regenbogenweiß“ eröffnet thematisch gewiss keine neuen Welten, grast bekanntes Territorium ab. Und doch bringt dieser Roman etwas zum Klingen. Er kommt dem echten Leben, Erleben und Fühlen verdammt nah.