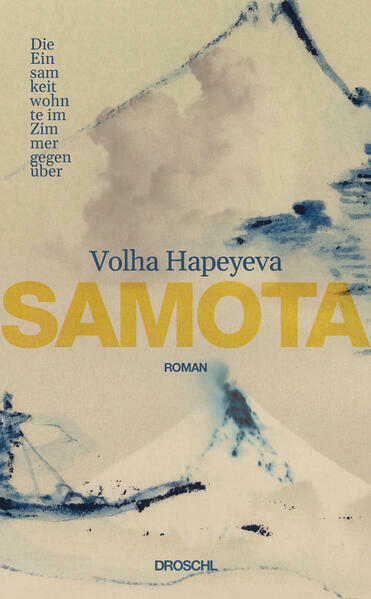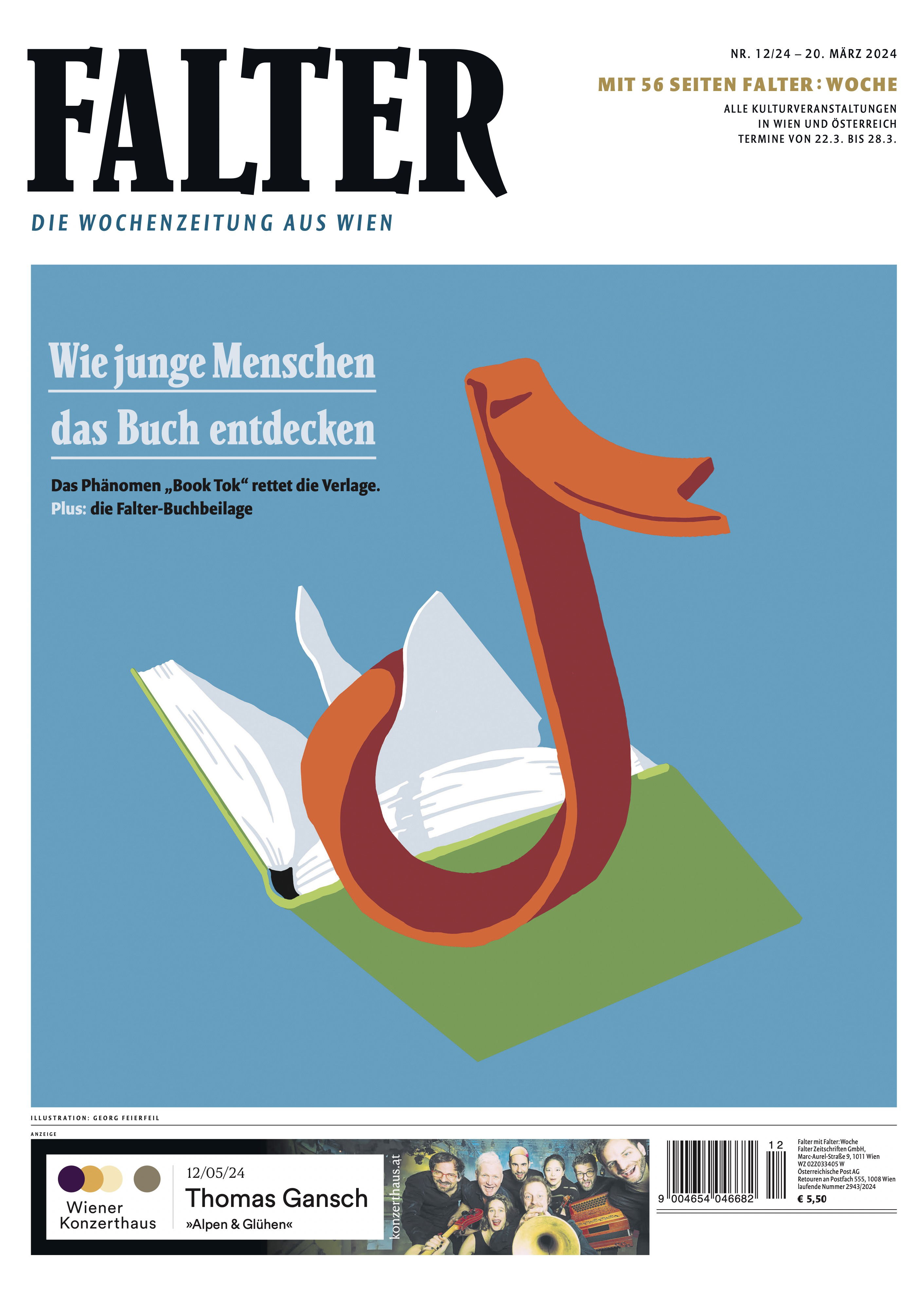
Sanftes Plädoyer für harten Umweltschutz
Christoph Bartmann in FALTER 12/2024 vom 20.03.2024 (S. 21)
Gleich zu Anfang spricht die Erzählerin, von der wir bald erfahren werden, dass sie den Ausbruch eines japanischen Vulkans vor 50 Jahren erforscht, von ihrer Erschöpfung. Diese sei noch nicht zu Müdigkeit geworden. Das sei etwas anderes, „der Endpunkt, die unumkehrbare Tatsache, dass Freude selbst als Wort zu existieren aufgehört hat“.
Auch für müde gewordene Menschen gebe es zwar noch hin und wieder Grund und Anlässe zur Freude. Aber das Wort selbst habe seinen Sinn verloren, es sei „zu einfach, zu banal und zu langweilig“.
Volha Hapeyevas Roman „Samota“ fängt mit einer Erschöpfung an, die sich im weiteren Fortgang zur Müdigkeit auswächst. Es ist ein Roman ohne Freude, aber deshalb kein freudloser. Statt Trübsal findet man in ihm eine Menge komischer, surrealer und sonst wie erfrischender Momente.
Das Müde, das Hapeyevas Erzählerin einleitend ins Gespräch bringt, ist nicht etwa lebensmüde, eher ist es menschenmüde. Aber vielleicht kann ja aus dieser Menschenmüdigkeit etwas Gutes entstehen.
Die Lyrikerin und Linguistin Hapayeva weiß auch als Prosaschreiberin genau, was sie von der Sprache will. „Das Hotel gähnte mit dem offenen Mund der Eingangshalle“, solche frischen Bild-Einfälle finden sich bei ihr fast auf jeder Seite. Man kann ihren Roman mit poetischem Gewinn lesen, auch wenn die Handlung weithin undurchsichtig bleibt.
Die Handlung? Ist das auch so ein langweilig gewordenes Wort wie „Freude“? Man wird ihr jedenfalls nicht gerecht, wenn man sie nachzuerzählen versucht. Es geht hauptsächlich um Vulkane und Tiere, vor allem um Tierpopulationen und deren systematische Dezimierung durch den Menschen.
Die Vulkanologin im Roman beschäftigt sich auch mit den Auswirkungen von Vulkanausbrüchen auf Katzen und Hunde. Gelegentlich kreuzt dabei eine befreundete Tierethikerin namens Helga-Maria ihre Wege. Man darf sie sich als eine Aktivistin vorstellen, die in ihren Vorträgen etwa für die „Entwicklung eines Empathieserums“ für Menschen plädiert.
Das Thema Tiere und Empathie wird dann in einem parallelen Handlungsstrang aufgenommen, worin sich, unklar, wann und wo, ein möblierter Herr namens Sebastian dem sinistren Wolfsjäger Mészáros gegenübersieht, und zwar im Haus des Herrn Zikade, den einst eine zarte, aber unglückliche Liebesgeschichte mit der besagten Helga-Maria verband.
Nacherzählt mag die Kombination aus ernsten ethischen Anliegen und einer willentlich konfusen Handlung verstörend wirken. Aber das heißt wohl nur, dass der Roman gedanklich und sprachlich zu dicht gewoben ist, als dass er sich unschädlich in Einzelteile zerlegen ließe. Das Disparate der Stimmen und Figuren fügt sich unter Hapeyevas lyrisch-linguistischer Inspiration zu einem stimmigen Ganzen. Man muss nur die Bereitschaft aufbringen, sich ihrem eigensinnigen Sprachspiel anzuvertrauen.
Es offenbart auch eindeutige politische Botschaften. Auf experimentelle Kunst um der Kunst willen läuft der Roman der belarussischen Autorin nicht hinaus. Auf eine sanfte, träumerische Art ist „Samota“ ein Plädoyer für radikalen Umweltschutz. Die Tierpopulationsdezimierer, die ihren Kongress zeitgleich im Vulkanologenhotel abhalten, werden als Superfaschisten vorgeführt, sie sind Anwälte der „urewigen Ordnung“ und der „Subordination“ alles Lebendigen unter die Herrschaft des Menschen.
Was würde nun helfen in einer Lage, in der vom Menschen die Lösung seiner selbst verursachten Probleme kaum noch zu erwarten ist? Das Empathieserum, das die Tierethikerin Helga-Maria als bestes „Mittel gegen Konflikte und Kriege“ empfiehlt?
Man weiß nicht, ob allein der pharmakologische Weg noch offen ist. Aber vielleicht ist poetische Empathie, wie Hapeyeva sie praktiziert und fordert, ein erster Schritt.