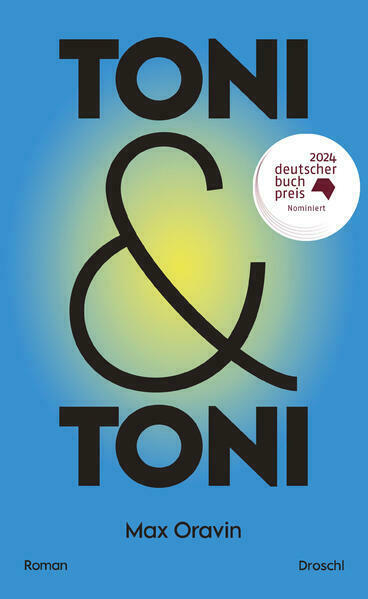Körper, Zen und fremde Zeichen
Björn Hayer in FALTER 42/2024 vom 16.10.2024 (S. 14)
Nichts sollte ihre Einheit auflösen, nichts diese unglaubliche Ekstase zweier Liebender beenden, bis sich in einer wilden Partynacht das Unglück ereignet: Tonis Partnerin, die passend zur Nähe der beiden denselben Namen wie der Icherzähler trägt, bricht zusammen und gerät in eine depressive Abwärtsspirale. Während sie sich in der schützenden Wohnung verbarrikadiert, zwischen Netflix-Serien und Selbstverletzungsepisoden dahinvegetiert, sucht ihr Gefährte Trost im Erlernen der japanischen Sprache. Dabei hatte das Paar vor der unerwarteten Zäsur noch Großes vor, nämlich eine gemeinsame Tanzpremiere.
Für diese rasante Choreografie aus Liebe und Verzweiflung hat Max Oravin mit seinem Debütroman, der es auf die Longlist zum Deutschen Buchpreis Debütroman geschafft hat, eine anspruchsvolle Form gefunden.
Der auch als Musiker tätige Schriftsteller legt nicht bloß einen Roman, sondern eine Sprachpartitur vor, wobei selbst dieser Begriff unscharf anmutet, suggeriert er doch eine im Notentext fixierte Ordnung. Eine solche etabliert der Autor zwar schon, allerdings um sie sogleich auch wieder aufzulösen.
Immer wieder fragt sich der zwischen Gegenwart und Erinnerungsbildern schwankende Icherzähler, wie er „den Wortstrom verlassen, einen Ausgang schlagen kann“. Und „müsste nicht, hinter den Worten, das reine Land sprachlos sein?“
Toni strebt nach der weißen statt der beschriebenen Seite, benutzt häufig Verben des Entfernens wie „radieren“ und „löschen“. Auf strukturierende Elemente wird weitestgehend verzichtet.
Ohne Absatz fließt der Text über hundert Seiten hinweg wie ein ungehalten mäandernder Fluss mit unvorhersehbaren Stromschnellen und Katarakten. Beim Lesen gerät man permanent ins Stocken, einerseits weil ständig asiatische Schriftzeichen aufpoppen, andererseits weil jeder Satz mit Einschüben durchsetzt ist.
Es geht also darum, sich freizuschreiben, bestenfalls hinein in ein neues Leben. Nur wie soll es aussehen, gerade angesichts der Gegensätzlichkeit der beiden Protagonisten?
Toni träumt von der Ruhe, wie sie Zen und Shentong versprechen, derweil seine Partnerin das völlige Chaos im Kopf zu erleiden scheint. Neigt sie zum Pessimismus, steht er für den bejahenden Part; setzt er auf die Ratio, gibt sie sich ganz der Emotion hin. Offensichtlich verhalten sich beide komplementär zueinander, stehen dadurch aber ebenso für ein Weltbild, das diese Kontraste vereint beziehungsweise in Bewegung hält, das Absolute durch das Durchlässige ersetzt.
Dies trifft insbesondere auf den menschlichen Körper zu, der in „Toni & Toni“ immer wieder thematisiert wird. Gerade im Tanz scheint er seine Grenzen zu überwinden, das Wagnis der Verschmelzung einzugehen. Dynamisch ist auch seine Inszenierung im Text: Mal wird er lesbar wie ein Buch, in dem die Narben etwa einer schwierigen Kindheit wie Buchstaben anmuten, mal tritt er als Zeichen reiner Vitalität in Erscheinung. So oder so dient er der Selbstvergewisserung. Toni betrachtet ihn oft von außen, notiert und deutet die Resultate der Selbstverletzungen seiner Gefährtin mit geradezu forscherischer Akribie.
Allerdings beschränken sich die Beobachtungen nicht auf die äußere Physis. Immer wieder zeigt sich der 1984 in Graz geborene und heute in Wien lebende Autor in seinem Erstling offen für spirituelle Einflüsse – etwa wenn Toni immer tiefer in den fernöstlichen Buddhismus eintaucht. Dadurch bekommt der Text etwas Schwebendes. Die Gegensätze von Enge und Weite, Luft und Erde, Kontemplation und Aktion lassen sich letztlich nur schwer fassen, die ausdrucksstarken Sprachbilder und der elanvolle Flow der Worte ist dazu angetan, eine klar konturierte Wahrnehmung zu verwischen. Oravin geht aufs Ganze, will die Leser mit seiner Überwältigungsästhetik mitreißen, was ihm auch gelingt, denn tatsächlich gerät man bei der Lektüre immer wieder in einen zügellosen Rausch.