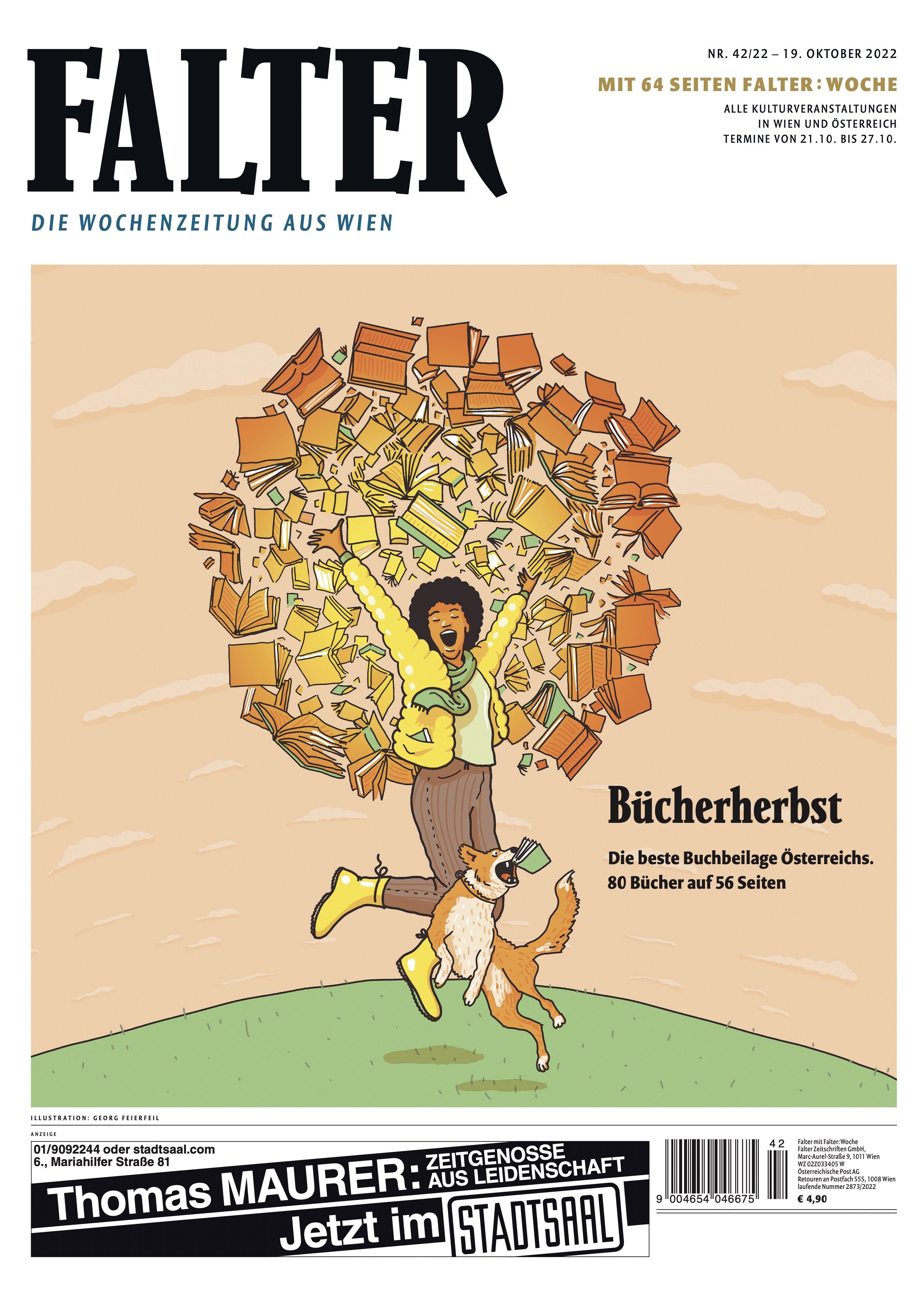
Der Schrottgott
Matthias Dusini in FALTER 42/2022 vom 19.10.2022 (S. 41)
Er fühle erst vor, wie stark die Trauer in der Familie noch sei. Wenn die Angehörigen sagen, dass sie nichts bräuchten, rät Christof Stein: "Lassen Sie sich Zeit, vielleicht wollen Sie doch eine Erinnerung." Der Antiquitätenhändler steht in einer Wohnung im siebten Bezirk und durchsucht die Überreste eines Lebens.
Die Klassiker-Ausgaben im Bücherregal lassen auf einen bürgerlichen Lebensstil schließen. Die kleine Küche diente gleichzeitig als Bad, die Abwasch dürfte aus der Zwischenkriegszeit stammen. "Früher hat man darauf keinen großen Wert gelegt", sagt Stein und zieht eine Schale aus dem Schrank: "Altwiener Porzellan, wunderbar."
Christof Stein, geboren 1964, ist einer der bekanntesten Altwarenhändler Wiens. Anfang der 90er-Jahre erkannte er den Wert von modernem Design. Während die meisten Kollegen nach einem Barockmeister oder Loos-Sesseln Ausschau hielten, blieb Steins Blick an Nierentischen hängen.
Als begabter Erzähler machte er aus Staub Glitzer und vermittelte einem breiten Publikum akademisches Wissen. Dass das Erbe moderner Gestalter wie Oswald Haerdtl (Architekt des Café Prückel) inzwischen geschätzt wird, hat die Stadt auch der Wühlarbeit Steins zu verdanken. Die Höhepunkte seines Lebens fasst Stein in dem vor kurzem erschienenen Buch "Möbel, Objekte, Geschichte" zusammen.
Nachdem er vor wenigen Jahren die meisten Geschäftsbeteiligungen aufgegeben hat, kehrt er gerade zu den Ursprüngen zurück. Am Samstag betreut er den Stand am Naschmarkt, unter der Woche kümmert er sich um Hinterlassenschaften. Gestorben wird immer, und der Name Stein hat sich herumgesprochen.
Steins persönliches Markenzeichen sind Rollkragenpullover. Weil er keine Krawatten möge und oft in kalten Wohnungen warte. Die Geschichten sprudeln nur so aus ihm heraus, etwa jene vom gestohlenen, mit Design vollgepackten Lkw in Frankreich. Das Fahrzeug tauchte schwer beschädigt wieder auf -mit der gesamten Ladung. "Die Diebe haben sich gedacht, was machen wir mit diesem Schrott?"
Nachlass-Hopping
"Es macht mir immer noch Spaß", sagt der Händler beim Gang durch die Altbauwohnung, eines von 40 Objekten, die er jährlich besenrein übergibt. Er wählt also nicht nur Verwertbares aus, sondern sorgt dafür, dass die gesamte Einrichtung abgebaut wird. Der Kaufmann besichtigt, macht ein Angebot und zieht die Kosten für die Räumung ab.
Dabei bleiben oft Dinge übrig, die jeder braucht und im Supermarkt teuer kauft: Putzmittel, Sessel oder Geschirr. So kam Stein vor zehn Jahren auf den Gedanken, ein "Nachlass-Hopping" zu organisieren. Interessierte gehen mit dem Händler in Wohnungen und erwerben gegen ein kleines Entgelt, was sie für den Haushalt brauchen. Eine Geschäftsidee ergibt die nächste.
Das Abbiegen war Stein gewissermaßen in die Wiege gelegt. Er wuchs bei seinem Stiefvater Manfred Stein auf, einem Architekten und Stadtplaner, zu dessen bekanntesten Projekten die Fußgängerzone Favoriten gehört. Mitte der 80er-Jahre zog sich der Baukünstler ins Waldviertel zurück und entwickelte hier eine Leidenschaft für Ufos.
Stiefvater Stein hatte im Wald des Ortes Kautzen eine Formation von Granitblöcken entdeckt, die aus der Vogelperspektive die Gestalt eines Skorpions hatte, und sie scherzhaft einen Landeplatz für Außerirdische genannt. Die Zeitschrift News machte aus der b'soffenen G'schicht eine Reportage, Esoteriker suchten fortan in Kautzen nach magischer Strahlung: "Am Ende hat mein Stiefvater tatsächlich an Ufos geglaubt."
Der Aussteiger kam auf dem Land mit Müh und Not über die Runden. Die Bauern zahlten für Planskizzen mit Dopplern und Eiern. Christof blieb in Wien und verdiente mit 16 auf dem Flohmarkt sein erstes Geld. Irgendwie habe ihn das bereits als Kind angezogen. "Ich habe auf Mistplätzen nach Verwertbarem Ausschau gehalten und fand es unfassbar, was die Leute alles wegschmeißen."
Leidenschaft für Läusekot
Dem Jungen mit der Liebe zum Alten ging es nicht nur um den Gewinn, sondern auch um eine Recyclingidee -"aus Müll wieder etwas Brauchbares zu machen". Er folgte dem Geist des 1976 am Naschmarkt angesiedelten Wiener Flohmarkts. Die aus dem alternativen Milieu kommenden Initiatoren verstanden das Projekt auch als Protest gegen die Konsum-und Wegwerfgesellschaft.
1988 eröffnete Stein in der Predigergasse im ersten Bezirk gemeinsam mit Guido Eisner ein Geschäft. 1990 folgte die Galerie Lichterloh, die der Händler bis 2019 gemeinsam mit Philipp-Markus Pernhaupt und Dagmar Moser betrieb. "Wir haben alles selbst gemacht", erinnert sich Moser beim Rundgang durch die Designgalerie, einer ehemaligen Drogerie.
Stein, Pernhaupt und Moser waren Anfang 20, als sie den alten Laden herrichteten, die Wände abspachtelten und die Farbe von den Holzschränken kratzten. Als HTL-Absolventin mit Schwerpunkt Tischlerei wusste Moser, wie man Möbel politiert.
Beim Politieren kommt eine Flüssigkeit zum Einsatz, die aus in Spiritus aufgelöstem Kot von Schelllackläusen besteht. Mit einem Schwamm wird die Essenz langsam in das Holz gerieben, ein altes Verfahren, das Oberflächen auffrischt.
Die drei grasten Flohmärkte ab und stöberten in Hinterlassenschaften. "Uns hat die Leidenschaft zusammengebracht und -gehalten", meint Moser, "die Hingabe, Altes zu finden und wieder in Umlauf zu bringen." Der Anfang war nicht einfach, wenn Menschen die Lampen oder Stoffbezüge sahen, sagten sie oft: "Das kenne ich von meiner Oma."
Heute kennt jeder, der sich für Design des 20. Jahrhunderts interessiert, den erweiterten Shop an der Gumpendorfer Straße.
Mid-Century-Fieber
Der internationale Austausch half, geschmackliche Vorurteile zu überwinden. Die Lichterlohs fuhren zu Messen nach Frankreich und Italien, um Stücke zu kaufen, die aus derselben Epoche stammen, aber auf Wiener exotisch wirkten. Umgekehrt erschien den Käufern in Paris oder Mailand die Ware aus Österreich ungewöhnlich. So stand jahrelang ein Fauteuil herum, den partout keiner haben wollte.
Bis eines Tages der US-Schauspieler Willem Dafoe in der Gumpendorfer Straße vorbeikam. Und zuschlug. Was dem lokalen Publikum banal vorkam, fand der New Yorker aufregend. Das Fremde wertete das Eigene auf, und aus dem alten Kram wurden Kunstwerke, deren Gestaltungsideen auch lokale Skeptiker allmählich überzeugten. Heute fördern Onlineplattformen wie 1stdibs.com die globale Vintage-Wanderung.
Das Geschäft mit seinen an eine Kunstgalerie erinnernden Ausstellungsräumen wurde zum Katalysator eines Trends, der in den 1990er-Jahren aus den USA nach Europa kam - die Faszination für Mid-Century, den Lounge Chair von Ray und Charles Eames oder den Stuhl "Ameise" des Dänen Arne Jacobsen. Wie gering das Bewusstsein für die moderne Ästhetik hierzulande war, beweist eine Anekdote, die in der Retroszene selbst eine Art Klassiker ist.
Der Zufall schlägt mitunter wie ein Blitz in die Routine. Im Oktober 2001 feierte Lichterloh sein Zehnjähriges. Zwischen Tür und Angel teilte eine Architektin den Betreibern mit, dass am folgenden Montag in der Wiener Stadthalle eine Räumung stattfinden würde.
Die Mehrzweckhalle war Mitte der 1950er-Jahre vom Architekten Roland Rainer (1910-2004) geplant worden. Die Stadt gab die Renovierung des denkmalgeschützten Gebäudes in Auftrag, die ebenfalls von Rainer entworfenen Garderoben hingegen wurden ausgesondert.
Am Montag um sechs Uhr morgens standen Stein und Moser also mit vier Lkws vor der Stadthalle und luden 60 Kleiderständer auf, die übrigen 180 Stück wurden von einem Eisenhändler verschrottet. "Rainer war schockiert, als er das gehört hat", erinnert sich Moser, die den berühmten Architekten damals kontaktierte.
Sogar die New York Times berichtete über die Panne, die die Sorglosigkeit der Rathausbeamten und die Missachtung der Nachkriegsmoderne offenbarte. Während Biedermeier-Kästen und Jugendstilbauten wie die Secession zur Identität Wiens gehören, bekam der Funktionalismus erst allmählich das Prädikat "wertvoll".
Die Innenarchitekten von Boutiquen oder Hotels, etwa dem renovierten Kummer an der Mariahilfer Straße, zitieren heute gerne die Martini-Moderne, also die Ära geschwungener Möbel und eleganter Cocktailbars. Als Lichterloh das Business entwickelte, wurden die als grau und freudlos geltenden Fifties gerade abgeräumt.
Warum fehlte in Wien die Wertschätzung? Die Vertreibung der Protagonisten während der Nazizeit hatte eine Wüste hinterlassen, ein oft einfallsloser Wohnbau ließ die Bauhaus-Ideen zum Klischee erstarren.
Ruinen der Moderne
1999 fiel das letzte von dem Architekten Oswald Haerdtl gestaltete Espresso am Stephansplatz der Spitzhacke zum Opfer, noch 2010 verschwand der Südbahnhof, eine Kathedrale moderner Raumauffassung. Anerkennung für ihre Tätigkeit bekamen die Lichterlohs zunächst eher von außerhalb.
Stein hatte pro Garderobe den Eisenpreis von 200 Schilling (heute circa 14 Euro) bezahlt. Einige Monate darauf versteigerte das Auktionshaus Sotheby's in London ein Exemplar um 4500 Pfund. Das Lichterloh-Team profitierte von einem Trend, der über die Moderne hinausgeht.
Mittlerweile bekommt das Trödlerfieber durch Fernsehsendungen neue Popularität. Sendungen wie "Kunst + Krempel" (ab 2023 auch auf ORF 2) oder "Bares für Rares"(Servus TV) leben von der Faszination, die Expertenwissen auf Laien ausübt. Kunsthistoriker analysieren Zigarettenetuis aus der Belle Époque oder skandinavische Vasen.
Unterhaltungswert bekommen die Objekte durch die Provenienzen. Die Verkäufer bringen etwa Schmuckstücke mit, die von einer dem Kaiser dienenden Urgroßtante stammen. So tut sich ein kleines Fenster in menschliche Schicksale und vergangene Epochen auf.
Stein, ein Meister der Vermittlung, tritt selbst als Experte für "Altes &Schönes" in der ORF-Livesendung "Studio 2" auf. Er kennt den Wert von Geschichten, die kalte Dinge mit Nähe aufladen. Mitunter macht sich der "Unstudierte"(Selbstbezeichnung) sogar über den großen Respekt lustig, der Expertenwissen entgegengebracht wird.
Zum Beispiel 2001, als Lichterloh die neu erworbenen Stadthallen-Garderoben präsentierte. Zur Eröffnung lud Stein einen koreanischen Spezialisten ein, der den Einfluss Roland Rainers auf die asiatische Moderne ausführte. Es handelte sich tatsächlich um den Kellner eines koreanischen Lokals, der den Auftrag bekam, die Speisekarte vorzulesen und den Namen "Roland Rainer" einzustreuen. Das Publikum applaudierte höflich.
Steins Fabulierkunst hat allerdings auch einen Haken. Die Lichterloh-Gemeinschaft scheiterte daran, dass die Idee des Kollektiven etwas zu kurz kam. "Das gemeinschaftliche Wir machte immer mehr dem Ich Platz", meint Moser.
Der extrovertierte Kollege habe ein Talent für gute Geschichten, in denen der Name Lichterloh zu selten vorgekommen sei. Moser stand im Geschäft, Stein vor der Kamera. "Sie hat recht, aber es war auch mein Job, das Lichterloh nach außen zu tragen", sagt Stein.
Für die Shopbetreiber war die Rainer-Episode eine Art Erweckungserlebnis. Den Schatzsuchern wurde bewusst, wie groß die Lücken in der Überlieferung sind. Selbst die Architektur und die Möbel der 20er-und 30er-Jahre fanden bei den Wienern kaum Beachtung. In Manhattan oder dem Londoner Bezirk Kensington gehörten Vintage-Möbel in den 90er-Jahren bereits in jeden gehobenen Bobo-Haushalt.
Das Schweizer Designunternehmen Vitra begann damit, klassische Sitz-und Liegemöbel etwa des Ehepaars Eames nachzubauen. Ein eigenes Vitra-Museum arbeitete das Werk wichtiger Gestalter auf und schickte Ausstellungen auf Wanderschaft. Nach und nach stiegen auch in Österreich Konsumbürger in Werbe-und Architekturbüros von Biedermeier auf Bauhaus um.
Bedrohte Designarten
Durch die Berichte über die Stadthalle alarmiert, riefen Behörden bei Lichterloh an und baten um eine Einschätzung. Lange Zeit hatte die Bürokratie die Second-Hand-Verwertung verhindert. Wer einen Bürosessel in einem Ministerium ausmustern wollte, musste unzählige Anträge ausfüllen. So war die Mülltonne meist die einfachere Lösung. Nun war Christof Stein die Wiener Anlaufstelle für bedrohte Designarten.
Nicht alles an seinem Job funkelt wie Haerdtl-Luster. Der Alltag des Altwarenhändlers besteht aus dem Stierln in muffigen Wohnungen, dem Blättern in fremden Fotoalben und dem Verräumen von Sperrmüll. Ein Marktstand bedeutet, in der Nacht aufzustehen und im Winter bei Eiseskälte auf Kunden zu warten. Im Rückblick versöhnen die spektakulären Momente, die die Augen des Moderneschnüfflers zum Glänzen bringen. So wie jener sonnige Sonntag 2003, an dem Stein mit der Familie zu einem Frühstück in die Innenstadt aufbrach.
Auf der Straße bemerkte der Händler einen Pkw, auf dessen Dach eine rot tapezierte Sitzbank geschnallt war. Sofort checkte Stein, was los war -das legendäre Café Museum wird geräumt.
Das Kaffeehaus Ecke Operngasse, Karlsplatz, symbolisiert die Geschichte modernen Designs in Wien. Der Architekt Adolf Loos verwirklichte in dem 1899 eröffneten Lokal seine Philosophie. Statt historischem Pomp wollte er eine schnörkellose, funktionale Gestaltung.
S.O. S. Café Museum
1930 bekam der Südtiroler Architekt Josef Zotti (1882-1952), ein Schüler des wichtigen Universalgestalters Josef Hoffmann (1870-1956), den Auftrag für einen Umbau. Zotti schuf halbrunde Sitzlogen und überzog die Bänke mit rotem Kunstleder, eine überzeugende Lösung für ein Lokal, das öffentlicher Treffpunkt und intimer Rückzugsort zugleich sein sollte. Nach einer Neuübernahme sollte Zotti raus.
An jenem Sonntag schaute Stein seine damalige Frau fragend an: "Es ist okay. Mach deinen Job." Als der Designdetektiv auf die Baustelle kam, sah er ein Bild der Verwüstung - zerbrochene Marmorplatten, aufgeschlitzte Polster. In der Staubwolke versuchte der Gast, den Vorarbeiter ausfindig zu machen und brüllte, um die Presslufthammer zu übertönen: "Ich kaufe alles!"
Bilanz der Intervention: fünf halbrunde Bänke, vier Garderobenständer, ein Sessel und 30 Tische -und die Rettung eines Denkmals. Ein Ensemble kam gleich ins Möbelmuseum Wien, das die Wiener Designtradition dokumentiert. Die vor einem Jahr verstorbene Schriftstellerin Friederike Mayröcker schrieb Lichterloh einen Brief, in dem sie sich für die Bewahrung der von ihr geliebten Umgebung bedankte.
"Er hat mit seiner Begeisterungsfähigkeit viele Menschen mitgezogen", sagt Lothar Trierenberg, der Stein seit der gemeinsamen Zeit in der Rudolf-Steiner-Schule in Mauer kennt. Auf Anregung von Stein hin eröffnete Trierenberg 1998 Das Möbel, eine Mischung aus Kaffeehaus und Möbelgalerie. Durch den Schulfreund lernte er auch das Werk des Architekten und Designers Josef Frank kennen, eines maßgeblichen Vertreters der Wiener Moderne.
Franks Hauptwerk, die Villa Beer in Hietzing, stand 2020 zum Verkauf. Seit Jahrzehnten bemühen sich Architekturhistoriker, das Gebäude vor dem Verfall zu retten. Trierenberg, vermögender Spross einer Industriellenfamilie, zögerte nicht und erwarb das Monument.
Er will die Villa Beer nach allen Regeln der Kunst renovieren und der Öffentlichkeit zugänglich machen. Seinen nichtsahnenden Freund Christof führte er nach Vertragsunterzeichnung zur Eingangstür und zog eine Flasche Sekt aus der Tasche: "Das gehört jetzt mir."



