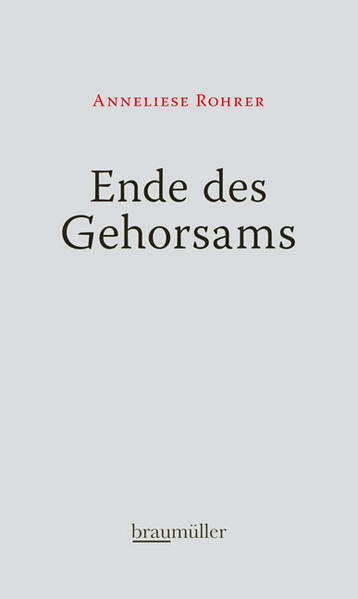Aufmunterungslektüre für zukünftige Wutbürger
Barbaba Tóth in FALTER 37/2011 vom 14.09.2011 (S. 20)
Diesen Sachbuchherbst dominieren schmale Büchlein für frustrierte Politikkonsumenten. Nicht alle liest man mit Erkenntnisgewinn
Wutbürger war der deutsche Begriff des Jahres 2010. Ursprünglich als Beschreibung für die rechtspopulistische Vereinigung "Bürger in Wut" verwendet, übernahmen die deutschen Feuilletons dann jene Definition, die der deutsche Spiegel-Journalist Dirk Kurbjuweit prägte. Er beschrieb den Wutbürger beziehungsweise die Wutbürgerin als jemanden, der "mit der bürgerlichen Tradition" gebrochen und "der Politik die Gefolgschaft aufgekündigt" habe. Grund dafür seien die als Willkür empfundenen politischen Entscheidungen, Schlüsselerlebnis des "Wutbürgertums" war Stuttgart 21, also die Proteste gegen das gleichnamige Bahnhofsprojekt.Auch durch Österreich weht ein Hauch von Wutbürgertum, mangels eines Protestmekkas, das mit Stuttgart 21 vergleichbar wäre, bleibt es aber eher theoretisch und entlädt sich vor allem in Form einiger Bücher, die in diesem Herbst auf den Markt kommen. Die langjährige Presse-Journalistin Anneliese Rohrer hat für ihr bereits fürs Frühjahr angekündigte Buch "Ende des Gehorsams" letztlich doch einen Verlag gefunden, der bereit war, ihre mit deftiger Politikerschelte garnierte Österreich-Rundumschwächenanalyse zu drucken. Rohrers Kernaufforderung an ihre Leserinnen und Leser, sich nicht als politische Objekte oder gar Opfer, sondern als kritische Subjekte zu begreifen, kommt der ehemalige Salzburger SPÖ-Politiker Wolfgang Radlegger nach. Sein schmaler Band "Vom Stillstand zum Widerstand" soll der publizistische Auftakt für ein von ihm und anderen Altpolitikern wie Friedhelm Frischenschlager (einst FPÖ, dann Liberales Form), Johannes Voggenhuber (Grüne) und Erhard Busek (ÖVP) angedachtes Demokratievolksbegehren sein. Sozusagen die extra-honorige Version österreichischen Wutbürgertums.Zumindest von der Titelgebung her am nächsten dran am Empörungsbuchtrend sind Eugen Maria Schulak und Rahim Taghizadegan mit ihrem Buch "Vom Systemtrottel zum Wutbürgertum". Ihr Werk gehört aber eher in die Kategorie esoterisch unterfütterter Lebenshilferatgeber denn politisches Sachbuch (siehe Rezension Spalte rechts).
Stuttgart 21 auf Österreichisch
Woran kann sich österreichisches Wutbürgertum also reiben? Wo zeigt sich, dass Willkür und Willfährigkeit Österreichs Politik dominieren? Rohrer wie Radlegger identifizieren die gleichen Schlüsselereignisse. Im Frühjahr 2010 informierten Bundeskanzler Werner Faymann und der damalige Vize Josef Pröll das Parlament, dass die Vorlage des Budgets 2011 nicht, wie die Verfassung es vorsieht, spätestens Ende Oktober erfolgen würde. Sie argumentierten damit, die Wirtschaftsprognosen abwarten zu wollen, in Wahrheit wollten sie die anstehenden Landtagswahlen in Wien und der Steiermark nicht mit Spardebatten stören. Der große Aufschrei angesichts dieses kalkulierten Verfassungsbruchs blieb aus. Ebenso ohne Empörung passierte die Verlängerung der Legislaturperiode im Jahr 2006 das Parlament. Dabei, argumentiert Rohrer, reduziert sie die "zeitlichen Entscheidungsmöglichkeiten der Bürger um 25 Prozent". Als dritten großen Sündenfall und Gipfel der Unterwürfigkeit nennen Rohrer wie Radlegger jenen Leserbrief Faymanns und Alfred Gusenbauers aus dem Jahr 2008 an die Kronen Zeitung, in dem sie ankündigten, das Volk über eine EU-Verfassungsänderung abstimmen zu lassen – ganz so, wie Hans Dichand es gefordert hatte.
Untertanenmentalität
Das Verdienst beider Bücher ist es zweifellos, Ereignisse wie diese wieder in Erinnerung zu rufen und in jenen Kontext zu stellen, in den sie gehören: als Beispiele für die "gängige politische Schluderei" in unserer Republik. Der erfahrenen Journalistin Rohrer gelingt dies wenig überraschend ungleich präziser und pointierter als dem ehemaligen Politiker und Manager Radlegger, dessen Buch im Grunde nicht viel mehr als eine passabel aufbereitete, mit vielen Zitaten aus Medien und Büchern versehene Aneinanderreihung der politischen Unzulänglichkeiten der letzten Jahre ist – quasi die Materialsammlung zu Rohrers Essay. Rohrers Anspruch ist hoch. Sie will nicht nur aufzählen, was alles schiefläuft, sondern auch erklären – historisch, mentalitätsgeschichtlich, psychologisch. Dass sie bei ihrer Ursachenforschung immer wieder bei bereits Bekanntem endet, stört nicht weiter – sie erweist ihren Vordenkern auch gehörig Reverenz. Robert Menasses Diagnose, der Österreich Anfang der 90er-Jahre als gefangen in der "sozialpartnerschaftlichen Ästethik" identifizierte, ergänzt sie durch die ebenfalls durch kein Verfassungsrecht legitimierte Landeshauptleutekonferenz als neuen, bedenklichen Machtpool. Auch auf dem Weg zu einer Erklärung für den Gleichmut, die Gleichgültigkeit, ja, die spezifisch österreichische "Untertanenmentalität" (Politologe Anton Pelinka) passiert sie die üblichen Stationen: fehlender Verfassungspatriotismus, veraltetes Schulsystem, aber auch eine Medienlandschaft, geprägt durch Journalisten, die die Schuld an der mangelnden Debattenkultur lieber den Politikern gibt, als sich selbst zu hinterfragen. Ihr Essay lebt von der Fülle an politischen Einblicken, die sie geben kann, sowie vom Argumentieren mit konkreten Beispielen, wo andere, nicht von journalistischer Neugierde und Recherche getriebene Autoren im Nebulosen bleiben. Etwa, wenn sie auflistet, wie teilweise überraschend wenige Bürgerunterschriften es pro Bundesland brauchen würde, um Volksbefragungen zu initiieren. Dass man gerne wutbürgerlicher wäre, als man ist, aber die Umstände einen daran hinderten, diese Ausrede lässt Rohrer nicht gelten. Völlig zu Recht.