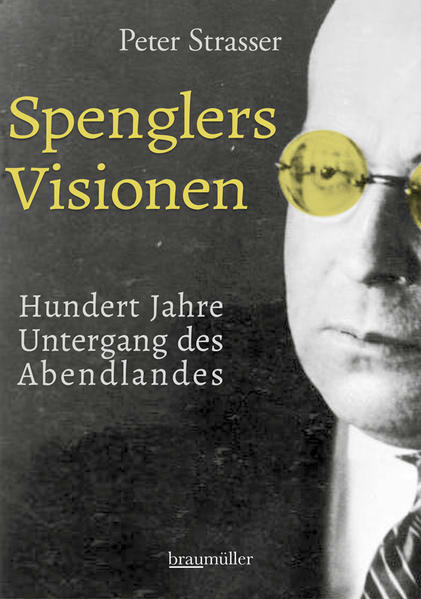Im Haifischmagen des Weltuntergangs
Erich Klein in FALTER 11/2018 vom 14.03.2018 (S. 33)
Philosophie: Peter Strasser erklärt zum 100-Jahr-Jubiläum Oswald Spenglers „Untergang des Abendlandes“
Peter Strasser ist ein selbstbewusster Europäer. Als „Spätabendländer“, wie sich der Philosophieprofessor aus Graz einmal augenzwinkernd bezeichnet, unterzieht er Oswald Spenglers „Untergang des Abendlandes“ 100 Jahre nach dessen Erscheinen einer intensiven und selektiven Lektüre. Gründe dafür gibt es genug: 1918 im Wiener Verlag Wilhelm Braumüller publiziert, erlebte das Buch innerhalb weniger Jahre 47 Auflagen. Nach dem Ersten Weltkrieg überaus wirkmächtig und von Kritikern wie Otto Neurath oder Robert Musil als Unfug abgetan, erfreuen sich die kulturpessimistischen Töne neuerdings wieder steigender Beliebtheit. Schließlich steht, wie sie meinen, Europa auf dem Spiel. Kurz und bündig werden Spenglers Biografie und der zeitliche Kontext des Tausendseiters umrissen. In der Folge macht Strasser kein Hehl aus seiner im Zuge des Close Reading immer größer werdenden Aversion gegen die hochtrabende Abendland-Beschwörung.
Im Gebrodel des Laboratoriums der Moderne stellten Spenglers antimodernistische Ausfälle keinen Einzelfall dar. Der später lupenreine Demokrat Thomas Mann betrauerte in seinen „Betrachtungen eines Unpolitischen“ (1918) ähnlich rabiat Deutschlands Niederlage im Ersten Weltkrieg als Untergang deutschen Geistes – allein Spengler deklarierte diesen zu einem des ganzen Abendlandes. Dessen konservative Revolution zielte mit „faustischer Seele“ auf „Caesarismus“ ab, auf einen starken Mann als Führer. Strasser lässt dem Preußenbewunderer Spengler dabei sogar eine Art von Gerechtigkeit widerfahren – dieser habe zwar Mussolini bewundert und partiell mit Hitler sympathisiert (der seinerseits den „Untergang des Abendlandes“ ablehnte), aber immerhin den fanatischen Antisemitismus der Nazis missbilligt.
Ohnehin war der antidekadente Décadent Spengler, für den die Nazis zu wenig „revolutionär“ waren, auf Höheres aus: die Grundgesetze der Kultur- und Weltgeschichte zu erkunden und anhand von „Ursymbolen“, eigenwilliger Typisierung kunstgeschichtlicher Epochen und aus Darwin- wie Nietzsche-Lektüre rekrutierten Einsichten der faustisch-deutschen Seele noch einmal auf die Sprünge zu helfen. Strasser bezeichnet Spenglers „Theorien“, die wie in einem Haifischmagen nebeneinander Platz finden, als stupiden „Mythos“ und spannt seinerseits kühne Gedankenbögen bis zu Martin Heidegger und Konrad Lorenz. Systematischer und übersichtlicher gerät der zweite Teil der essayistischen Untersuchung mit dem Ziel, das Abendländische „im metaphysischen Sinn“ aus den Fängen der „Abendlandbeschwörer“ zu retten.
Für Strasser reicht das „Abendland“ über alle Grenzen hinaus und „transzendiert das Bestialische“. Gegen dessen Untergang wird an die jüdisch-christlichen und antiken Grundprinzipien europäischen Denkens erinnert, beginnend bei der Gottesebenbürtigkeit des Menschen. Dazu kommen aristotelische Wahrheitstheorie, Kants kategorischer Imperativ und die Zurückweisung des nietzscheanischen Relativismus (den sich Spengler einverleibt hatte). Bei Strasser klingt das etwa so: „Es gehört nun zum entwicklungslogischen Inventar des zivilisatorischen Prozesses, dass mit der Herausbildung des Gedankens, dass allen Menschen die gleiche Würde zukomme, zwei miteinander verzahnte Fragen die Gemeinschaftsbildung fundamental bewegen: Erstens, wie sieht eine Ethik aus, deren Prinzipien sicherstellen, dass alle die gleichen Rechte und Pflichten haben, dieselben Freiheiten genießen können? Und zweitens, wie ist eine Chancengleichheit möglich, die jedem Mitglied der Gemeinschaft, bei gleicher Leistung, den gleichen Zugang zu den begehrten sozialen Gütern und Positionen gewährt, gestaffelt nach ihrem relativen Gewicht?“
Eine derartige „Kontur des Westens“ sieht Strasser wider alle Untergangspropheten in der politischen Praxis von Europas Demokratien ernstgenommen und bedroht zugleich. An dieser Stelle wird auch der eigentliche Zweck seiner Anti-Spengler-Übung klar: Gegen Globalisierung und „Drang zum nationalen Separatismus“ gelte es „unversalistische Prinzipien“ zu vertreten. Gegen das Auseinanderklaffen der Schere von Arm und Reich soziale Gerechtigkeit anzustreben. Schließlich wird die parlamentarische Demokratie an ihr „Krisenpotenzial“ erinnert. „Sie muss, will sie überdauern, eine Konflikt- und Affektdämpfungspragmatik zu ihren zentralen Bestandsaufgaben zählen.“ Angesprochen sind damit „fremdenfeindliche und nationalistische Schreihälse“ sowie jene „Radialpragmatiker“, die vermeinen, durch Populismus der Erosion der politischen Systeme Europas Einhalt bieten zu können.
Gegen Europaverächter, selbsternannte Weltvermesser und andere Kulturverdrossene, die über „zivilisatorischer Gleichmacherei und konsumistische Künstlichkeit“ jammern, hält Strasser an der schlichten Wahrheit fest, „dass sich die Menschen wohlfühlen wollen“. Sein Buch zitiert neben klassischer Philosophie Beispiele von Hölderlin bis Peter Handke und Cormac McCarthy und evoziert ein „Europa des Herzens“. Neben stilistischen Höhenflügen beherrscht deren Verfasser vor allem eine „abendländische“ Tugend meisterhaft: Dinge auf den Punkt zu bringen. „Es gibt kein französisches, britisches, deutsches, österreichisches Abendland. Das Abendländische dient unseren Neonationalisten dazu, die eigene provinzielle, weltfeindliche Sicht der Welt zu rechtfertigen, während sie sich als Beschützer eines wahrhaft Großen aufspielen. Tatsächlich handelt es sich um innere Aufrüstungen zum Krieg, sei es der Engstirnigkeit, der Ökonomie oder eines hohlen Machtanspruchs.“