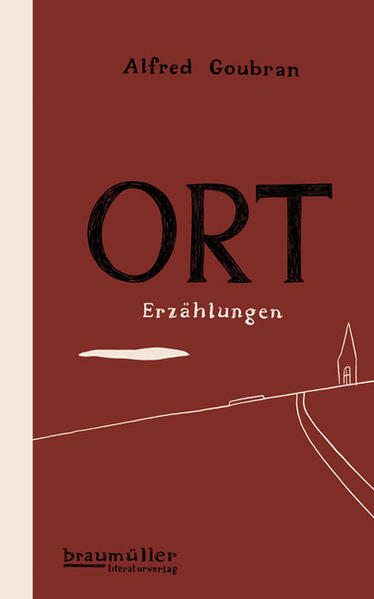Von Vielfalt und Anarchie in der Provinz
Paul Pechmann in FALTER 22/2010 vom 02.06.2010 (S. 44)
Alfred Goubran begibt sich in seinem Erzählband "Ort" auf Spurensuche in die Stadt seiner Kindheit und Jugend
Der in Graz geborene und in Klagenfurt aufgewachsene Alfred Goubran betritt in seinem Buch "Ort" den literarischen Topos der Provinz und versucht anhand von porträtartigen Geschichten kleinstädtische Lebensmöglichkeiten aus verschiedenen Winkeln " Zentrum, Stadtrand, Durchzugsstraße " her auszuleuchten. In "Terra Nullius. Meine Wälder" lässt der Ich-Erzähler in der Nacht vor dem Begräbnis seines Vaters die problematische Kindheit und Jugend Revue passieren, "An Land" erzählt von einem Unternehmer zwischen Konkurs und Scheidung, "Straßen" wiederum zieht den Leser in die Welt eines Geschäftsreisenden.
Die dargestellten Lebenswelten reichen von einer bohemehaften des jungen Poeten "aus eigenen Gnaden" und Gelegenheitsdealers bis zu jener glanzlosen des tagsüber von Lieferanten und Behörden bedrängten Buchhändlers, der die Nächte mit der Renovierung seines Hauses verbringt. Gemeinsam ist Goubrans Figuren die Erfahrung von Fremdheit und Austauschbarkeit, die sinnbildhaft im Motiv des Doppelgängers zur Sprache kommt. Der Erzähler in "Terra Nullius" erkennt den Mangel an Anonymität im kleinstädtischen Milieu als Ursache für eine grundlegende Doppelexistenz des Einzelnen als reale Person einerseits und als mit dieser verbundenes Gerücht andererseits.
Was die Erzählungen von "Ort" auszeichnet, ist das Talent des Autors, auf witzige Weise Zusammenhänge zwischen Mikro-Ökonomie, Habitus und Glücksvorstellungen sichtbar zu machen: In "Terra Nullius" huldigt der Sohn eines steifen Beamten und Berufsoffiziers einem konsequenten Nonkonformismus: "Wir hatten bei der Caritas viel zu große Anzüge, Krawatten und gebrauchte, gelbrandige Hemden gekauft und so versucht, uns ein halbwegs bohemehaftes Äußeres zuzulegen." Nach 68 wechselte der nun in Jeans und gebatikte Hemden gewandete Jungdichter wieder die Kleidung und fing desillusioniert mit dem Trinken an, als er festgestellt hatte, dass auch die von ihm verhassten Studenten den Anzug gegen Hippiemode tauschten.
Das Abtauchen in die Kunst- und Lokalszene mit den damit verbundenen körperlichen Exzessen führt ihn schließlich zum psychischen Kollaps. In der Retrospektive des nunmehr als Antiquar etablierten Erzählers wird jene Klagenfurter Welt, in der es noch "echte Originale" gegeben habe, auf schillernde Weise wieder lebendig.
Gilt gängiger Meinung nach die Provinz als Inbegriff der Rückständigkeit, so macht der Erzähler in "Terra Nullius" gerade diesen Umstand dafür verantwortlich, dass es dort einen "anarchischen Grundwasserpegel" noch dann gegeben hätte, als aus den Zentren alles Unangepasste längst eliminiert worden sei. Solche Thesen werden vom Schulabbrecher pointiert vorgetragen, und es fehlt nicht an Seitenhieben gegen jene Institutionen, welche die einstmalige Spontaneität unterdrückten: "Dass man zuerst ein Sumpfgelände trockenlegen musste, um diese Universität zu errichten, versteht sich beinahe von selbst."
Goubrans saloppe Kulturkritik fügt sich gut zur eher leichtgängigen Erzählweise. Die raren Ausflüge ins "Hochpoetische", wie etwa im Satz: "Dieses Vaterschweigen klebte an mir wie flüssiges, kaltes Glas, etwas Zähes, Durchsichtiges, das sich zwischen mich und die Welt geschoben hatte", erscheinen in einem solchen Kontext eher bemüht und redundant. Für ein Buch, das Anpassungsverweigerung thematisiert, wären auch riskantere Formentscheidungen brauchbar gewesen, wie sie Alfred Goubran in "Leuchte", dem letzten Text von "Ort" ausnahmsweise trifft oder wie er sie als Herausgeber der "edition selene" mit Nachdruck immer wieder forcierte.