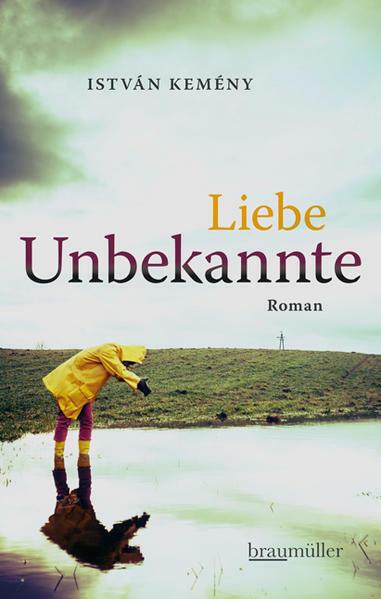Wie spät kann der Spätsozialismus noch werden?
Thomas Leitner in FALTER 3/2014 vom 15.01.2014 (S. 27)
Eine ehrwürdige Bibliothek, daran angeschlossen ein ominöses "Institut für Herausgabe von Enzyklopädien", ist der Hauptschauplatz des umfangreichen Romans von István Kemény (Jg. 1961), der bisher vor allem als Lyriker in Erscheinung trat. Der Erzähler ist wohl ein wenig jünger: 1986 hat er gerade einmal ein Studium an einer Provinzhochschule abgebrochen und einige Aufnahmeprüfungen verbockt. So hängt er eben herum und fällt nicht sonderlich auf: nicht in der Familie, die durch Vaters Teilnahme am 56er-Aufstand marginalisiert in trister Vorstadt lebt, und erst recht nicht in besagter Bibliothek.
Da wie dort ist eine mehrere Generationen umfassende Fauna aus (ehemaligen) Aristokraten, Wissenschaftlern sowie jugendlichen Möchtegern- oder doch wirklichen Künstlern hauptsächlich mit Herumhängen befasst. In mehreren Stockwerken haust man da übereinander, aus den Luftschutzkellern kriecht die Zukunft der Budapester Rockmusik hervor
Alle diese Figuren scheinen angeschwemmt vom Donaustrom, von dem wir spätestens seit Hölderlin wissen, dass er in die falsche Richtung fließt – teils unterirdisch, teils in Überflutungen alles an sich reißend. Die Personen sind eingebettet in die gemütlich-unheimliche Geselligkeit realsozialistischer Spätzeit, und die Geschichte in ihrer scheinbaren Unwandelbarkeit diffamierte jeden Zukunftshorizont als Chimäre.
Kontrastiert wird diese zugleich graue und buntscheckige Gegenwart durch Rückblicke in viele finstere Momente der faschistischen und stalinistischen Periode und Ausblicke auf das auch nicht wirklich berauschende postkommunistische Heute mit seinen europäischen Illusionen. Dass der Autor, bei allem Sarkasmus, fast allen seinen Figuren mit Sympathie begegnet, macht die Qualität des Buches aus, macht es zu einem feinen Beispiel mitteleuropäischer Ironie. Im virtuosen Umgang mit verschränkten Erzählebenen erweist sich Kemény prominenteren Zeitgenossen wie Peter Nadas als ebenbürtig, zu dessen "Parallelgeschichten" man den Roman als satirisches Nachspiel lesen kann.