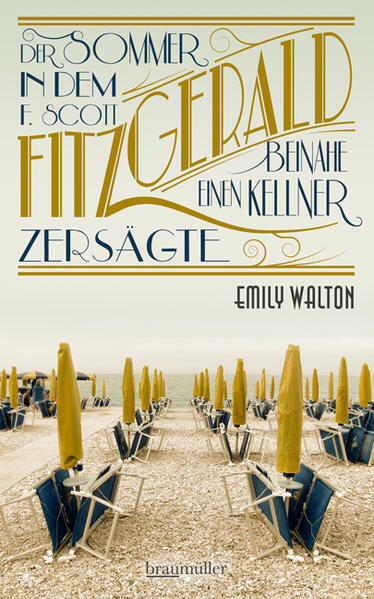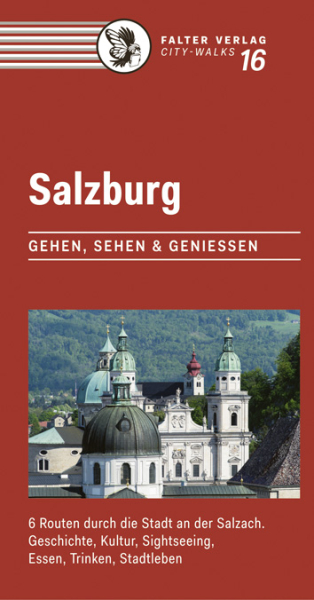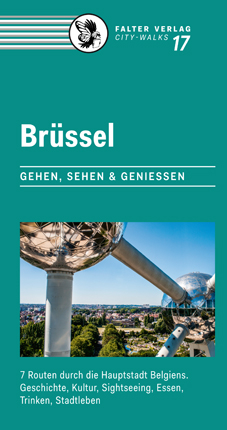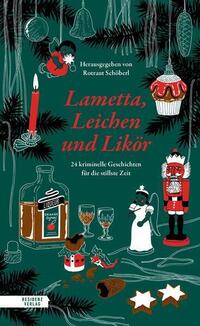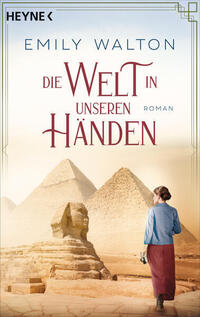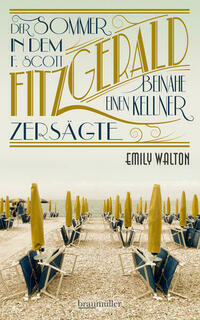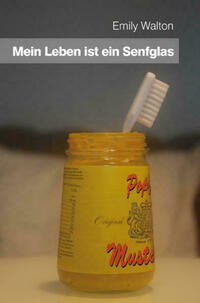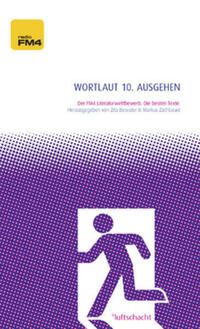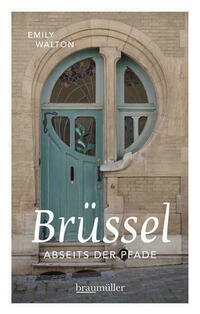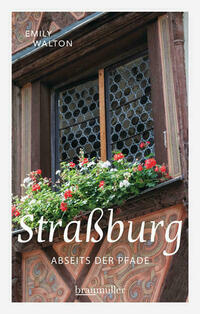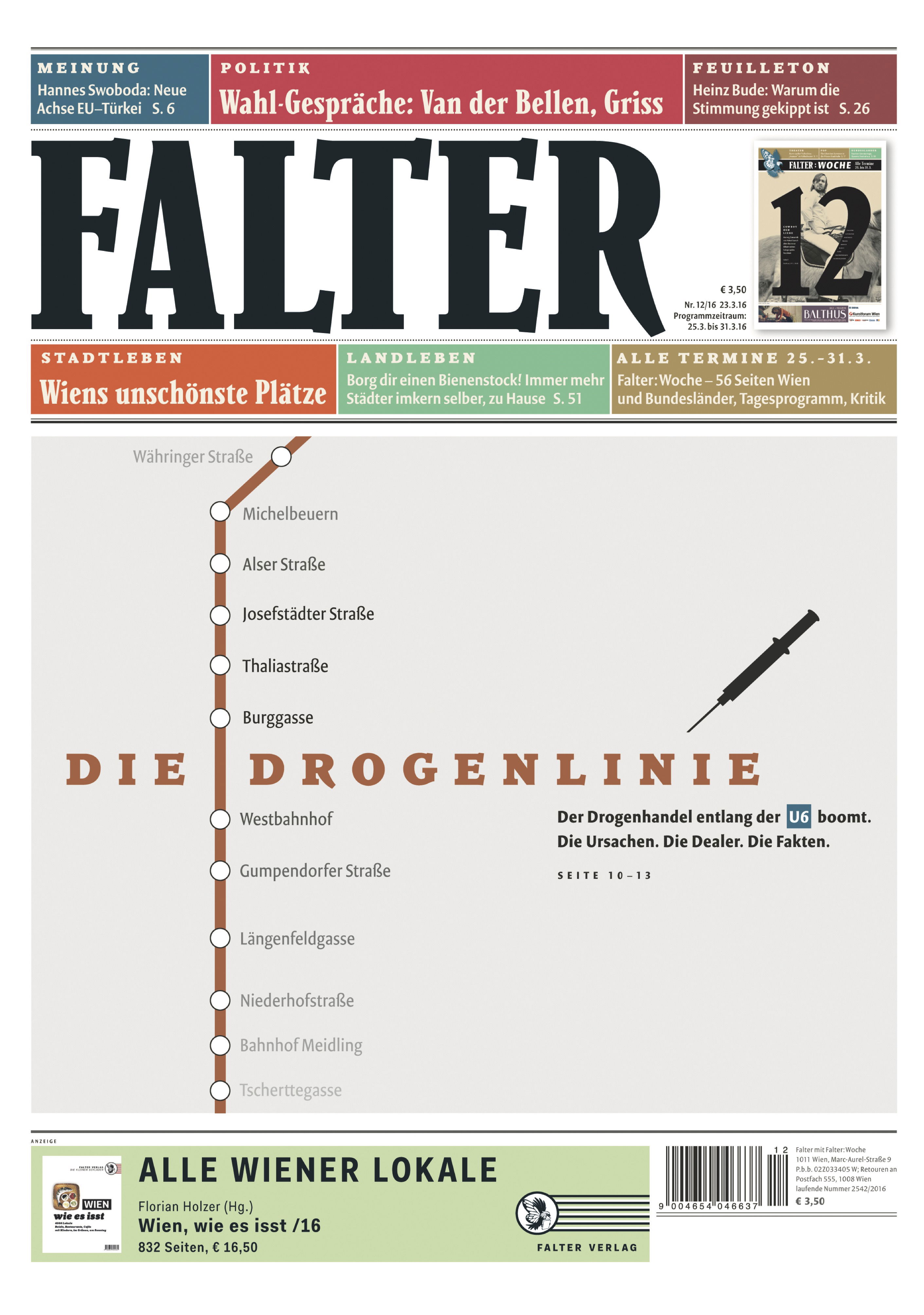
F. Scott Fitzgerald und der letzte Sommer des Jazz
Georg Renöckl in FALTER 12/2016 vom 23.03.2016 (S. 32)
Am Strand von Nizza baden nur Pferde. Wo es geht, treiben Soldaten ihre Tiere zur Abkühlung ins Wasser. Der Rest der Küste: Steine, Felsen, Dreck. In einer kleinen Bucht am Rand einer ausgedörrten Halbinsel räumt das US-amerikanische Ehepaar Murphy eine dicke Schicht Seegras auf die Seite, ohne vom Kopfschütteln der Einheimischen Notiz zu nehmen.
Sommer, Sonne und Sand, das interessiert 1922 noch niemanden, die Society reist an den kühlen Ärmelkanal. Die Murphys kaufen einstweilen ein Haus mit Grundstück oberhalb „ihres“ Strandes, bauen Gemüse an und halten Milchkühe. Und sie laden ihre Freunde ein: Picasso, Strawinsky, Cole Porter, Zelda und F. Scott Fitzgerald.
Letzterer will gleich den ganzen Sommer 1926 hier verbringen, weit weg von Paris, New York und all den Skandalen. „Ich bin glücklich wie seit Jahren nicht mehr“, notiert er. „Es ist einer dieser außergewöhnlichen, kostbaren und viel zu vergänglichen Momente, in denen alles im Leben gut zu laufen scheint.“ Hier will Fitzgerald den Roman schreiben, der ihn zum bedeutendsten Gegenwartsautor Amerikas machen soll.
Tat er aber nicht. Was stattdessen geschah, weiß Emily Walton. Die austro-britische Autorin hat jede Zeile des Autors gelesen, Pariser und New Yorker Antiquariate nach seinen Korrespondenzen durchwühlt und ist an die Schauplätze seines Lebens gereist. In „Der Sommer, in dem F. Scott Fitzgerald beinahe einen Kellner zersägte“ erzählt sie, wie der Autor des „Großen Gatsby“ den jungen Hemingway mit Kritik an dessen Manuskript von „Fiesta“ quält, den Murphys furchtbare Szenen liefert und seine nervlich zerrüttete Frau im Krankenhaus abgibt, um sich besser betrinken zu können.
Fitzgerald war kein angenehmer Zeitgenosse, aber ein faszinierender Autor, dem Walton in ihrer nur scheinbar locker geschriebenen Chronik jenes Sommers sehr nahe kommt. Als sein an der französischen Riviera begonnener Roman „Zärtlich ist die Nacht“ 1934 doch noch erschien, war das „Jazz Age“ längst in der Weltwirtschaftskrise untergegangen. Hier dürfen die Twenties noch einmal röhren.