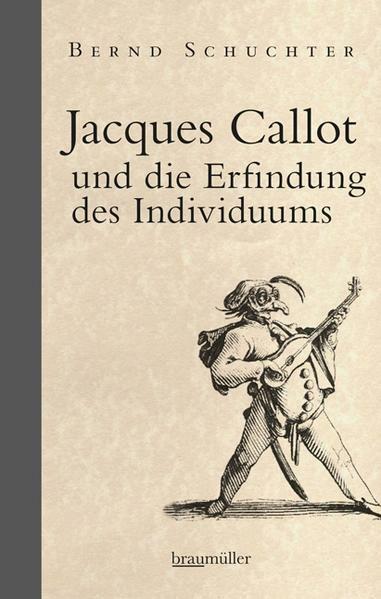Detailgetreue Bilder von Gräueltaten und Leid
Sebastian Fasthuber in FALTER 41/2016 vom 12.10.2016 (S. 50)
Kunstgeschichte: Bernd Schuchter erinnert an den Kupferstecher Jacques Callot und seine Bilder vom Dreißigjährigen Krieg
Warum kann ich mich an deinen sonderbaren fantastischen Blättern nicht satt sehen, du kecker Meister! – Warum kommen mir deine Gestalten, oft nur durch ein Paar kühne Striche angedeutet, nicht aus dem Sinn?“
Zu den großen Bewunderern des lothringischen Zeichners, Kupferstechers und Radierers Jacques Callot (1592–1635) zählte der deutsche Dichter E.T.A. Hoffmann, der ihm 1814/15 ein ganzes Buch mit „Fantasiestücken in Callots Manier“ widmete.
Zu der Zeit ließ sich auch Francisco de Goya von ihm inspirieren, seinen Zyklus „Die Schrecken des Krieges“ benannte er nach der gleichnamigen Serie von Radierungen Callots, die dieser während des Dreißigjährigen Krieges anfertigte.
Zu seiner Zeit war Jacques Callot ein Star. Der Adel deckte ihn mit Aufträgen ein, die Geschäfte liefen gut, er arbeitete Tag und Nacht. Als guter Kaufmann ließ er von seinen Werken meist größere Auflagen drucken und verkaufte von einem Bild bis zu 2000 Stück. Heute ist der Radierer, der auf kleinen Blättern unfassbar lebendig und realistisch wirkende Szenen mit einer Vielzahl an Details unterbrachte, ziemlich in Vergessenheit geraten.
Warum ihm also fast 400 Jahre nach seinem Tod ein Buch widmen? Bernd Schuchter, der kein Kunsthistoriker, sondern Verleger und Autor von Romanen ist, begründet es wie folgt: „Callot (…) ist ganz Kind seiner Zeit, des Europa der beginnenden Moderne, das durch die langen Jahre des Dreißigjährigen Krieges für eine Zeit in ein barbarisches Mittelalter zurückgeworfen wurde. (…) Dieser große Krieg hatte gezeigt, wie dünn diese Schicht an Zivilisation ist, die den Menschen im Alltag daran hindert, ein Tier zu werden, nach eigenem Gutdünken zu morden und zu stehlen.“
Rückfälle in mittelalterliche Sitten häufen sich in Europa aktuell wieder. Dass man sich bei der Lektüre Gedanken macht, was die damalige Zeit mit unserer zu tun haben könnte, ist vom Autor intendiert.
Abenteuerlich, allerdings noch unter friedlichen Umständen begann Callots Laufbahn. Er ging bereits als Kind bei Meistern in die Lehre und wollte in die Welt hinaus.
Mit zwölf riss er zum ersten Mal nach Rom aus, das Zentrum der abendländischen Kunst. Er erreichte sein Ziel sogar, wurde dort jedoch von Kaufleuten aus seiner Heimatstadt erkannt und prompt wieder zurückverfrachtet.
Beim zweiten Versuch mit 14 kam er nur bis Turin. Zwei Jahre später ließ ihn sein Vater ziehen. Einige Zeit dürfte er in Rom verbracht haben, mit 20 übersiedelte er nach Florenz und machte sich dort schnell einen Namen.
Seine Frühwerke sind technisch noch nicht so ausgefeilt wie spätere Arbeiten. Vor allem aber zeigen sie eine völlig andere Welt. Zumeist wurde Callot damals beauftragt, große Feste in Florenz und bei den Medici zu dokumentieren. Langsam entwickelte er freilich auch einen Blick für Randgestalten und begann Einzelporträts von Bettlern und Krüppeln anzufertigen.
Eines Tages war die Zeit der Feste ganz vorbei, Callots Augen erblickten immer mehr Hässliches. Er lief zu Höchstform auf. Sein Werk kulminiert in den Serien „Die kleinen Schrecken des Krieges“ und „Die großen Schrecken des Krieges“.
Bis heute herrscht Uneinigkeit, ob seine detailgetreuen Bilder von Gräueltaten und menschlichem Leid Anklagen darstellen sollen – oder ob Callot, der bis zu seinem Tod tief gläubig blieb, einfach um größtmöglichen Realismus bemüht war. Zu bedenken ist auch, dass seine Auftraggeber mächtige Personen waren, die die Bilder als Propaganda verwendeten.
Schuchters Text stellt eine ungewöhnliche Mischform aus Essay und Erzählung, aus Künstlerbiografie und dem Porträt einer historischen Epoche dar. Die Grenzen zwischen dem Nacherzählen von Fakten und dem Fabulieren verlaufen fließend.
Da einige Kapitel von Callots Leben schlecht dokumentiert sind, ist der Autor oft auf Mutmaßungen angewiesen. Man erkennt diese Stellen daran, dass die Wörter „wohl“ und „vielleicht“ geballt auftreten. Das hätte sich auch eleganter lösen lassen. Anregende Lektüre ist das Buch aber allemal.