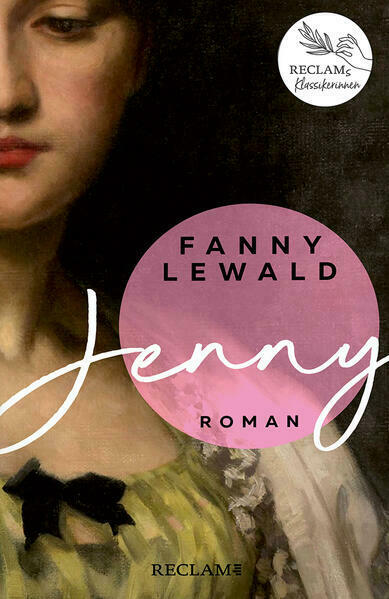Sex, Gewalt und schlechte Laune
Klaus Nüchtern in FALTER 5/2025 vom 29.01.2025 (S. 29)
Wilhelm Conrad Röntgen entdeckt die nach ihm benannten Strahlen; Oscar Wilde wird wegen "Unzucht" zu zwei Jahren Zuchthaus verurteilt; Theodor Fontane veröffentlicht "Effi Briest". Ebenfalls im Jahr 1895 erscheinen die "Studien über Hysterie" von Josef Breuer und Sigmund Freud sowie Gabriele Reuters Roman "Aus guter Familie", der nun vom Reclam Verlag unter dem Claim "Effi Briests vergessene Schwester" neu aufgelegt wurde.
Tatsächlich war das Buch der damals 36-jährigen deutschen Schriftstellerin ein früher Erfolgstitel des noch jungen S. Fischer Verlages. Ebendort erschienen sechs Jahre später "Buddenbrooks" von Thomas Mann, der seiner Verlagskollegin öffentlich bekundete Wertschätzung entgegenbrachte - ebenso wie Sigmund Freud. In seiner Schrift "Zur Dynamik der Übertragung"(1912) attestiert er Reuters Roman, "die besten Einsichten in das Wesen und die Entstehung der Neurosen" bereitzustellen.
Vorgeführt werden diese am Beispiel der Protagonistin, der jungen Agathe, eben Tochter "aus guter Familie". So wie die "Buddenbrooks" unterliegen freilich auch die Heidlings einem "Verfall": Statt der erhofften Beförderung wird der Vater, ein Regierungsrat, in die Pension geschickt, was der Familie eine empfindliche Redimensionierung ihres Lebensstils oktroyiert, wodurch sich die Tochter genötigt sieht, der psychisch und körperlich zusehends angeschlagenen Mutter die Haushaltsführung abzunehmen. Sie selbst aber strebt unerbittlich dem Status der alten Jungfer entgegen, die in der zweiten Hälfte ihrer Zwanziger noch immer nicht unter der Haube ist: "Man sagte ihr Schmeicheleien, wie sie sich konserviere", heißt es einmal maliziös; "bei Abend könne man sie gut noch für ein ganz junges Mädchen halten".
"Die Introversion der Libido", schreibt Freud in dem erwähnten Aufsatz, sei "unentbehrliche Vorbedingung" jeder neurotischen Erkrankung; die Libido wende sich von der Realität ab und regrediere. Man wird Reuters Roman nicht gerecht, wollte man diesen auf eine Vorwegnahme von Versatzstücken der Psychoanalyse reduzieren, aber die von Freud beschriebenen Symptome sind an der Protagonistin unschwer auszumachen. "Aus guter Familie" ist eine Art inverser Entwicklungsroman; seine Coming-of-Age-Story kulminiert nicht in einer gefundenen oder errungenen, sondern erzählt von einer verfehlten Identität.
Vergleicht man "Aus guter Familie" mit Fanny Lewalds (1811-1889) ein halbes Jahrhundert zuvor erschienenem Roman "Jenny", der ebenfalls in der Reclam-Reihe "Klassikerinnen" neu herausgebracht wurde, springt der Kontrast ins Auge, gerade weil die Ausgangslage der beiden autobiografisch geprägten Werke so ähnlich ist.
Beide Protagonistinnen sind Teenager, die sich gegen soziale Konventionen auflehnen, wie sie sich vor allem in geschlechterspezifischen Rollenzuschreibungen manifestieren; und diese sind nicht zuletzt religiös determiniert. Um der Ehe mit einem Kandidaten der Theologie willen plant Lewalds aus säkularer jüdischer Familie stammende Titelheldin zu konvertieren. Allerdings kann sie die christlichen Dogmen nicht mit ihrem aufklärerisch-rationalistisch geprägten Weltbild vereinbaren.
Die junge Frau, der selbst ihr Bruder "zu viel Selbstgefühl und eine fast unweibliche Energie" attestiert und die sich zum Entsetzen ihres Bräutigams in spe mehr für Mozarts "Figaro" als für die Trinitätslehre zu begeistern vermag, schlägt das ihr wenig lebensfroh erscheinende Doppelpack aus Ehe und Konversion aus.
Agathe ist keine Jüdin, aber auch als 17-jährige Konfirmandin sind ihr die Verbote und Versprechungen, welche der Pastor im Unterricht anspricht beziehungsweise in Aussicht stellt, suspekt: "Sie begriff durchaus nicht, wie sie es anzustellen habe, um zu genießen, als genösse sie nicht. [] Wenn sie sich mit den Pastorsjungen im Garten schneeballte, versuchte sie, dabei an Jesum zu denken. Aber bedrängen die Jungen sie ordentlich, und [ ] die Lust wurde so recht toll -dann vergaß sie den Heiland ganz und gar."
Im Gegensatz zu Lewalds Jenny, deren Selbstbewusstsein fest in der Tradition der jüdischen Aufklärung und des Vormärz-Liberalismus verankert ist, kann Agathe auf kein vergleichbar robustes weltanschauliches Fundament bauen. Angebote zur Aufsässigkeit gegen ihre wohlbehütete und biedersinnige Existenz erreichen sie in Gestalt ihrer Freundin Eugenie und ihres Cousins Martin.
Erstere ist selber eine höhere Tochter aus wohlhabender Kaufmannsfamilie, klärt Agathe zu deren Entsetzen über die basalen Vorgänge der menschlichen Prokreation auf und entfacht mit pubertärem Pathos - "Agathe, ich habe geliebt!" - auch in dieser den Funken einer juvenilen Passion, die sich zunächst allerdings nur an den toten Lord Byron heftet. Reeller ist da schon die Nähe zu "Mani", besagtem Cousin, der offen mit dem Sozialismus sympathisiert und Agathe einen Gedichtband des revolutionären Georg Herwegh schenkt -der vom Vater prompt konfisziert wird. Lediglich Onkel Gustav, als argloser Lebemann das schwarze Schaf der Familie, beweist Mitgefühl mit seiner Nichte, indem er sie freundlich für deren Dummheit schilt, das Geschenk vor versammelter Tischgesellschaft auszupacken. Es sind nicht zuletzt solche Details, die Reuters hellwaches Sensorium für die Geschlechterverhältnisse und Erziehungsregime des deutschen Kaiserreiches belegen.
Wie in einem Roman Jane Austens ist die Mama ein bisschen doof und verbissen darum bemüht, der Tochter eine gute Partie zu sichern; und wie bei Austen steht Agathe dem Papa näher. Dessen Zuwendung wird hier freilich als paternalistische Strategie erkennbar, die Tochter an sich zu binden. Als der vor politischer Verfolgung in die Schweiz geflohene Martin, mittlerweile ein angesehener Autor progressiver Schriften, dort nach zwei Jahrzehnten seiner Cousine zufällig wiederbegegnet und sie drängt, sich dem väterlichen Einfluss endlich zu entwinden, antwortet sie: "Das ist ganz unmöglich. [ ] Er braucht mich. Wer soll ihn erheitern und pflegen?"
Im Unterschied zu ihrer ungleich bekannteren "Schwester" Effi Briest und Madame Bovary begeht Agathe Heidling keinen Ehebruch; sie ist, wie Tobias Schwartz in seinem aufschlussreichen Nachwort schreibt, keine Femme fatale, sondern eine Femme fragile, nach zeitgenössischem Urteil eine Hysterikerin, nach heutiger Diagnose wohl schlicht depressiv.
Im Untertitel weist Reuter ihren Roman als "Leidensgeschichte eines Mädchens" aus. Diese hat freilich nichts vom tragischen Pathos, mit dem noch Goethe seine "Leiden des jungen Werthers" ausgestattet hatte, sondern wird als Geschichte weiblicher Selbstentmächtigung erzählt. Letztendlich schlägt Agathe alle Emanzipationsangebote aus, vermag sich nie zu offener Opposition gegen ihre bourgeoise Herkunftsfamilie aufzuraffen. Als das junge Dienstmädchen der Heidlings verzweifelt gesteht, vom Sohn des Hauses sexuell missbraucht zu werden, lässt Agathe ein Schloss an deren Schlafkammer anbringen -und hält den Mund.
In dieser Rezension ebenfalls besprochen:
Aufsässigkeit und Selbstentmächtigung
Klaus Nüchtern in FALTER 51-52/2023 vom 20.12.2023 (S. 45)
Im Jahre 1843 veröffentlicht Karl Marx seine Schrift "Zur Judenfrage", in der er das Verhältnis von Staat und Religion reflektiert und darüber nachdenkt, inwiefern politische Emanzipation die Überwindung religiöser Befangenheit zur Voraussetzung hat. Im selben Jahr erscheint auch Fanny Lewalds "Jenny", ein Roman, der die Emanzipation der Juden und der Frauen zum Thema hat. Wobei sich Lewald als Autorin kein Blatt vor den Mund nimmt und die Ressentiments und Klischees, die in deutschen Landen an der Tagesordnung waren, ganz unverblümt zur Sprache bringt.
Schon die Eingangsszene hält fest, wie in einer Runde junger Herren auf Frauen geblickt und über diese geredet wird. Als sich einer von ihnen, ganz entflammt von den Feueraugen und dem Götternacken einer berühmten Sängerin, schier in Rage redet, kontert sein Gegenüber, Sohn und Erbe eines reichen Kaufmanns, kalt: "Wenn sie nur nicht so verdammt jüdisch aussähe"; und ein Dritter kommt auf eine junge Frau zu sprechen, die er in einer Loge erblickt hat: "Sie ist offenbar eine Jüdin, aber es ist ein sehr interessantes Gesicht."
Es ist das Gesicht der Titelheldin, die mit der Autorin, die sie ersonnen, mehr gemein hat als den Gleichklang der Vornamen. Jenny Meier und Fanny Lewald entstammen beide einer jüdischen, säkularen Kaufmannsfamilie; beide werden konvertieren, aber die Ehe mit dem angehenden protestantischen Pfarrer, der um sie wirbt, schlussendlich doch nicht eingehen.
1811 geboren, gehört Fanny Lewald der Alterskohorte der Schwestern Brontë an, ihren um einiges berühmteren englischen Kolleginnen. Im Hinblick auf die Figurenkonstellation aber erinnert "Jenny" eher an die Romane der um eine Generation älteren Jane Austen: Heiratsoptionen, Besitzverhältnisse, Standesunterschiede, freche Töchter und depperte Pfarrer spielen bei beiden eine entscheidende Rolle.
Die Ironikerin Austen ist eleganter und witziger, die einem gewissen Pathos zugeneigte Lewald dafür weltanschaulich hellsichtiger und rigoroser - eine Qualität, die in einer Zeit, in der Antisemitismus unterm anti-imperialistischen Deckmäntelchen auch in der Linken wieder salonfähig geworden zu sein scheint, traurig aktuell wirkt.
Überhaupt ist es verblüffend, wie frisch und visionär sich "Jenny" aus der Distanz von nicht weniger als 180 Jahren heute ausnimmt. Es ist durchaus nicht übertrieben zu behaupten, dass Fanny Lewald den "Intersektionalismus" vorweggenommen hat, also die Auseinandersetzung damit, wie verschiedene Formen von Diskriminierung entlang der Kategorien von Race, Class und Gender einander überlagern und verstärken.
Identitätspolitische Fragen von Repräsentanz, kultureller Aneignung oder sexualisierter und rassifizierter Wahrnehmung spielen in "Jenny" eine zentrale Rolle. Als im Meier'schen Salon Eduard Bendemanns Historiengemälde "Die trauernden Juden im Exil" in Form eines Tableau vivant nachgestellt wird -es wurde 1832 ausgestellt, das Jahr, in dem die Romanhandlung einsetzt -, zeigt sich einer der Besucher verwundert, dass die Pantomime bei ihm einen wesentlich tieferen Eindruck hinterlässt als das Original. Ein anwesender Maler liefert die Erklärung: Bendemann habe die Juden allesamt durch Landsleute gecastet, "und nun sitzen die deutschen Männer und Weibsen und sehen, so hübsch sie sind, doch nur aus wie Düsseldorfer Gärtner, denen die Raupen den Kohl aufgefressen haben".
Nicht unähnlich einer von Austens Protagonistinnen wird die gerade einmal 17-jährige Jenny als eine energische und eloquente junge Frau beschrieben, deren Autarkie als aufsässig, anmaßend und unpassend wahrgenommen wird. Selbst der geliebte ältere Bruder Eduard beklagt sich bei den Eltern, "dass sich in Jenny zu viel Selbstgefühl und eine fast unweibliche Energie zeigten".
Während Eduard sich weigert, der Karriere oder einer Liebesheirat wegen zu konvertieren, entschließt sich Jenny gegen ihre Überzeugung zu diesem Schritt. Sie wird ihn bereuen und als doppelten Verrat empfinden: gegenüber ihrer aufgeklärten säkularen Überzeugung und gegenüber ihrem Verlobten, dem sie etwas vorspielt.
Die politische Agenda von "Jenny" macht den Roman heute noch lesenswert. Am stärksten ist dieser dort, wo er Macht-und Abhängigkeitsverhältnisse nicht plakativ benennt, sondern subtil aufzeigt. Grandios etwa die Szene, in der ein doppelter Paternalismus vorgeführt wird: jener des Verlobten, dem Jenny Überzeugung und Lifestyle opfern soll; und jener ihres Vaters, der dem zukünftigen Schwiegersohn herablassend und schulterklopfend einen Schwärmer heißt, weil der sich einbildet, ganz alleine für seine Frau aufkommen zu können.