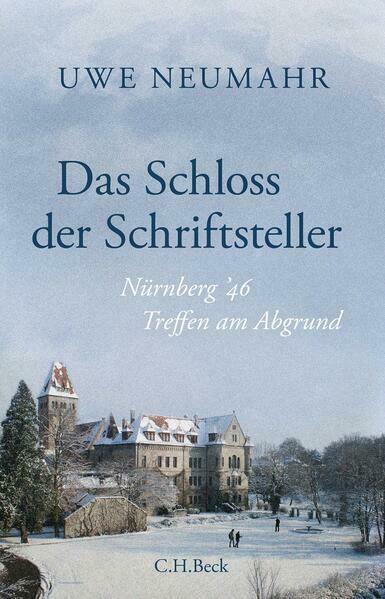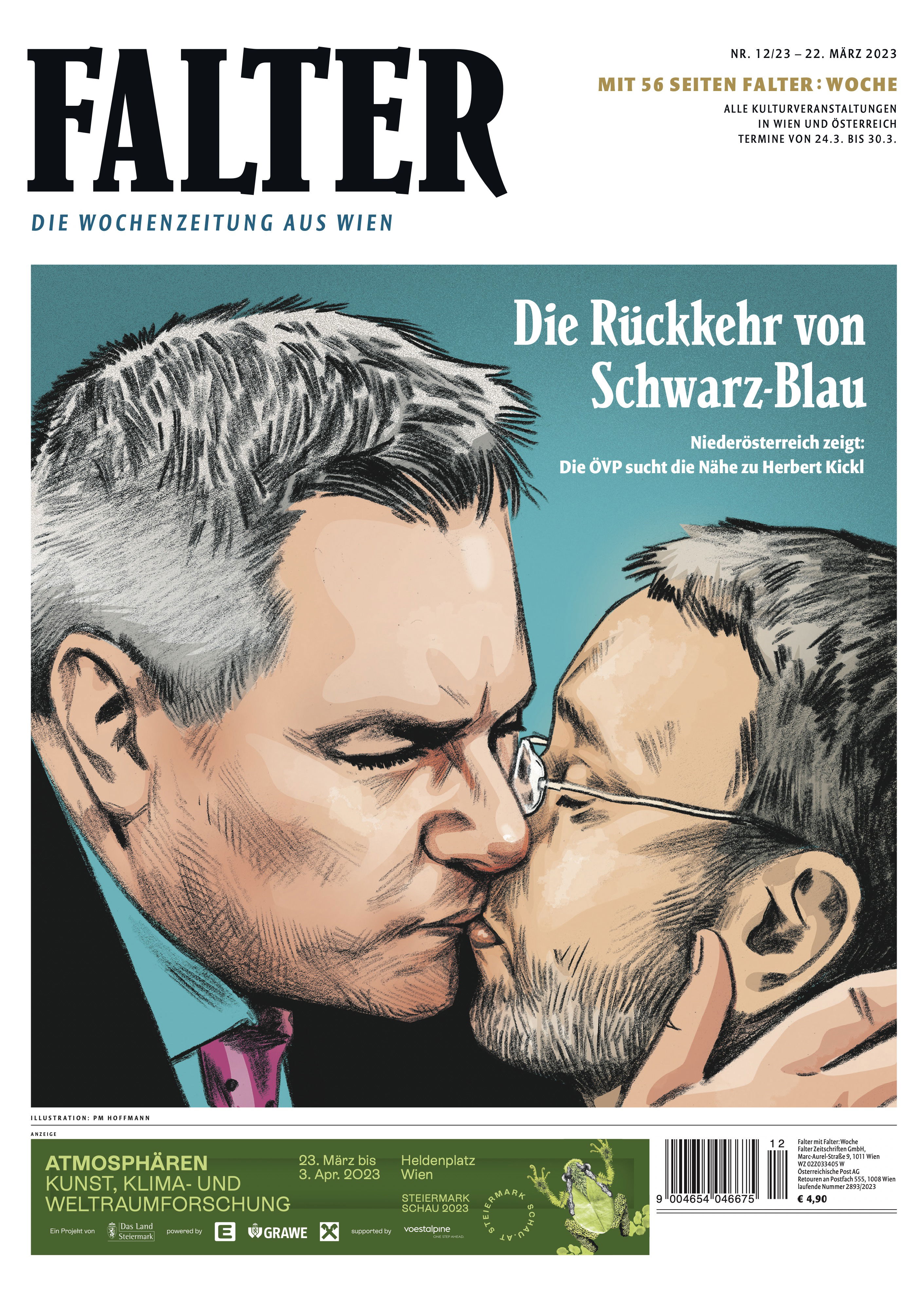
Tischtennis, Schampus und Kriegsverbrechen
Klaus Nüchtern in FALTER 12/2023 vom 22.03.2023 (S. 30)
Ich persönlich habe alles getan, was irgendwie in meiner persönlichen Kraft gestanden hat, die nationalsozialistische Bewegung zu stärken, zu vergrößern und [...] unter allen Umständen in die Macht und zwar die alleinige Macht zu bringen."
Als Robert H. Jackson, Chefankläger im Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher, Hermann Göring am 20. März 1946 verhört, zeigt der einstige "Reichsmarschall" keinen Anflug von Reue. Im Gefängnis war dem schwer Paracodin-Abhängigen nicht nur ein Entzug, sondern auch eine Diät verordnet worden. Deutlich weniger übergewichtig tritt er herrisch und arrogant auf, will keine Schwäche zeigen.
Dem Gericht, das ihm und den anderen 23 Hauptangeklagten Verschwörung gegen den Frieden, Entfesselung eines Angriffskrieges, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Last legt, spricht Göring, der im Juli 1941 persönlich den Auftrag zur "Endlösung der Judenfrage" unterzeichnet hatte, schlicht die Legitimität ab; die Anklagebank betrachtet er sichtlich als Bühne.
Göring ist der "Star" unter den NS-Größen, denen der Tod durch den Strang droht. Er steht im Fokus nicht nur der Ankläger, sondern auch von hunderten Journalistinnen und Journalisten, die nach Nürnberg gekommen sind, um alle Welt von den Verbrechen des NS-Regimes in Kenntnis zu setzen.
Der Germanist und Romanist Uwe Neumahr erzählt in seinem neuen Buch "Das Schloss der Schriftsteller" den Prozess, der vom 20. November 1945 bis zum 1. Oktober 1946 währte, als ein Stück Mediengeschichte. Sein Kniff, eine eigenständige Perspektive zu gewinnen, besteht darin, das Pressequartier selbst und einige der prominentesten unter den dort untergebrachten Korrespondenten zu den Protagonisten seiner Erzählung zu machen. Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft sind nicht zugelassen, sie müssen draußen bleiben.
Das titelgebende Schloss -es fungierte als Press Camp- befindet sich im Besitz der Familie Faber-Castell, die in Stein bei Nürnberg bereits Mitte des 18. Jahrhunderts mit der Bleistiftproduktion begann und heute Weltmarktführer auf diesem Sektor ist.
Das "Faberschloss" besteht aus zwei Gebäudekomplexen, die Mitte des 19. beziehungsweise Anfang des 20. Jahrhunderts als steingewordener Pastiche diverser Baukunstepochen zwischen Renaissance und Jugendstil in die Landschaft geklotzt wurden. Schmuckkästchen der Architekturgeschichte sehen anders aus.
Die Turmfenster des Schlosses seien "ziemlich nutzlos", ätzt die Grande Dame des britischen Journalismus, Rebecca West, "es sei denn, Rapunzel plante, ihr Haar aus ihnen herunterzulassen". Die Räume im Obergeschoss wiederum "konnten eigentlich nur von einer Märchengroßmutter mit einem Spinnrad bewohnt werden".
West, die neben Reportagen auch Romane und Kurzgeschichten veröffentlichte, kultiviert ein antideutsches Ressentiment, welches "das informelle Mitleidsverbot" (Neumahr) noch weit überbietet und selbst vor rassistischen Stereotypen nicht zurückschreckt -etwa, wenn sie befindet, Hitlers Architekt und Rüstungsreichsminister Albert Speer habe "schwarz wie ein Affe" ausgesehen.
Darüber hinaus darf West auch als Siegerin im inoffiziellen Wettbewerb der Hermann-Göring-Vergleiche betrachtet werden, an dem sich die im Faberschloss Residierenden beteiligten. Für den deutsch-jüdischen Schriftsteller Peter de Mendelssohn, der als britischer Besatzer in seine alte Heimat zurückgekehrt war, sieht der reuelose Reichsmarschall aus wie ein "Platzanweiser im Kino"; die flamboyante US-Journalistin Janet Flanner erinnert er an eine "korpulente Altistin" - und Rebecca West schlichtweg "an eine Puffmutter".
An der "konsequenten Sexualisierung des Nürnberger Prozesses" hatte West, wie eine Historikerin konstatierte, entscheidenden Anteil. Den deutschen Feind zu schmähen, indem man ihm eine defizitäre Männlichkeit unterstellte oder diese gleich ganz absprach, war gute britische Tradition, wie sie sich etwa auch in der neuen Textfassung des berühmten "Colonel Bogey March" aus dem Jahr 1914 manifestierte: "Hitler has only got one ball; Goebbel's got two, but very small; those of Goering are very boring, and poor old Himmler has no balls at all."
Dass West, die den Nürnberger Prozess einerseits zum Gähnen findet und zugleich eine "Atmosphäre müßiger Lüsternheit" konstatiert, selbst als bester Beleg für diesen Befund taugt, ist eines jener pikanten Details, an denen Autor Neumahr seine mitunter etwas überschießende Freude hat: Sie hat eine Affäre mit dem US-amerikanischen Hauptrichter Francis Biddle.
Elend und Entertainment wohnen während des Nürnberger Prozesses gleichsam Tür an Tür. Die Stadt wird 1945 durch Luftangriffe fast vollständig zerstört; die ausgebombten und demoralisierten Einwohner hungern. Eine erschütternde Anekdote stammt von einem irischen Reuters-Korrespondenten, der seiner Sekretärin, einer stets gut gekleideten und gepflegten Deutschen, eines Tages anbietet, sie im Auto zu ihrer Wohnung zu fahren. Als sie ihn bittet, vor einem Schutthaufen zu halten, weigert er sich, sie abzusetzen, und insistiert darauf, sie "nach Hause" zu bringen. Worauf die junge Frau ihren taktvollen Chef über dessen Irrtum aufklärt: ",Nein, hier ist es', entgegnete sie. Und ich sah, wohin sie ging: Sie ging in ein Loch im Boden" - ein Loch, das der Keller ihres zerbombten Hauses war und in dem sie mit ihrer Mutter lebte.
Auch die Presseunterkunft bietet keineswegs den Komfort, den man sich von einem "Schlossquartier" erwarten würde. Eine Promi-Korrespondentin wie die französische Schriftstellerin Elsa Triolet, Gattin des Dichters Louis Aragon, Stalinistin und so etwas wie die Yoko Ono der Surrealisten, residiert deswegen auch im Grand Hotel.
Trotz der nur mit Feldbetten ausgestatteten und überbelegten Zimmer und des permanenten Gerangels um Zugang zu einem der Badezimmer dürfte die Stimmung heiter bis ausgelassen gewesen sein. Man trägt Tischtennisturniere aus, bei denen sich der spätere CBS-Nachrichten-Star Walter Cronkite hervortut, und feiert Partys: Champagner und Cognac fließen in Strömen.
Der US-Romancier John Dos Passos ("Manhattan Transfer"), der angesichts der stalinistischen Verbrechen vom Sympathisanten des Sowjetsystems zum kalten Krieger geworden war und sich mit seinem Freund Ernest Hemingway überworfen hatte, ist erschüttert und einer der wenigen, die offen Mitleid mit den Besiegten zeigen.
Eine zutiefst resignative Melancholie zeichnet schon seine Beschreibung des Faberschlosses aus. Dieses sei "voll von nackten Damen aus grässlich weißem Stein, abscheulichen Treppen, [] German schrecklichkeit at its worst", schreibt er im November 1945 an seine Frau. Der Schriftsteller will nur noch weg aus Deutschland.
Mit dem Unterschied zwischen Fakten und Fiktion dürfte es Dos Passos in seinen Reportagen übrigens nicht sonderlich genau genommen haben. Uwe Neumahr hält es jedenfalls für wahrscheinlich, dass der Schriftsteller die zahllosen Zeugen, die er aufruft und zitiert, einfach erfunden habe, um seine eigene Sicht der Dinge zu beglaubigen.
Definitiv ein bloßes Gerücht ist die Anwesenheit des bald nach Kriegsende aus der Emigration in seine Heimat zurückgekehrten Schriftstellers Alfred Döblin. Unter dem erst 1968 enttarnten Pseudonym Hans Fiedeler hatte er 1946 die Broschüre "Der Nürnberger Lehrprozeß" herausgegeben, von dessen aufklärerischer Schlagkraft er selbst offenbar eine recht geringe Meinung hatte. Tatsächlich aber, so deckt Neumahr mit spürbarem Recherchestolz auf, wurde das Foto, das Döblins Präsenz in Nürnberg belegen soll, erst im Juli 1947 in Berlin aufgenommen. Döblin hat das Pressequartier im Faberschloss nie betreten, weil er gar nicht vor Ort war.
Die Frage, an der sich die Geister scheiden und alle in zwei Lager spaltet, ist jene nach einer etwaigen Kollektivschuld. In einer Broschüre aus dem Jahr 1941 hatte der britische Diplomat Robert Vansittart den Deutschen einen destruktiven, militaristischen und bis in die Antike zurückreichenden "Volkscharakter" attestiert, der nur durch die nachhaltige militärische Vernichtung gebrochen werden könne.
Die meisten der ausländischen Berichterstatter hängen einer mehr oder weniger moderaten Spielart dieser Auffassung an. Zu ihnen zählt auch Martha Gellhorn, Schriftstellerin und berühmteste Kriegsberichterstatterin ihrer Zeit. Nichtsdestotrotz wird sie herablassend als "girl correspondent" bezeichnet, darüber hinaus von ihrem Gatten Ernest Hemingway -die unschön verlaufende Ehe wurde nach fünf Jahren wieder geschieden - auch noch gnadenlos konkurrenziert. Mit ihrer Germanophobie hält Gellhorn nicht hinterm Berg: Wenn man sich um die Ausrottung der Malaria bemühe, schreibt sie einer Freundin, könne man mit den Deutschen doch ebenso verfahren, "die noch sichereren und hässlicheren Tod bringen".
Mitunter verlief die Bruchlinie mitten durch die Familie. Während der Historiker Golo Mann, der in den 1960ern die Enthaftung von Hitler-Stellvertreter Rudolf Heß befürwortet, Nachsicht mit seinen Landsleuten zeigt, erweist sich seine ältere Schwester Erika als unversöhnliche Anhängerin Vansittarts. Ganz anders der spätere Bundeskanzler Willy Brandt. Als Korrespondent mit norwegischer Staatsbürgerschaft kritisiert er den Umstand, dass in Nürnberg kein Vertreter des "anderen" Deutschland auf der Richterbank sitzt. Und es geht ihm schlicht "ein wenig auf die Nerven", dass Erika Mann so tut, als hätte sie die deutsche Sprache verlernt. Göring aber kann seine Show durchziehen. Er entzieht sich seiner Hinrichtung durch Suizid mithilfe einer Zyankalikapsel.