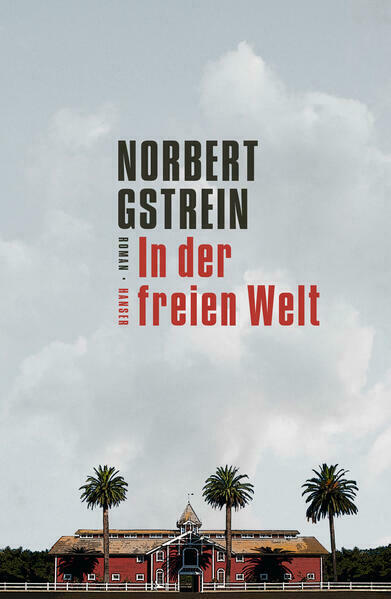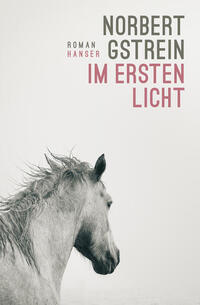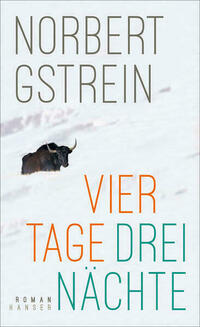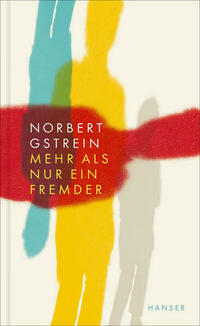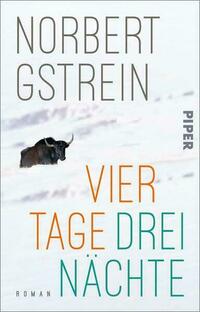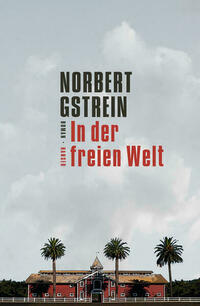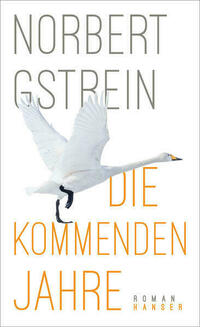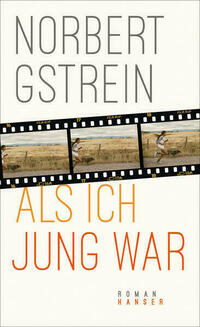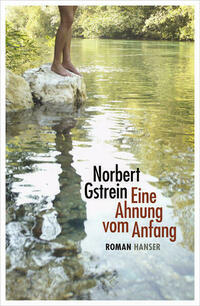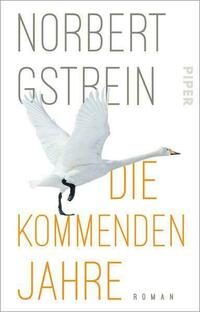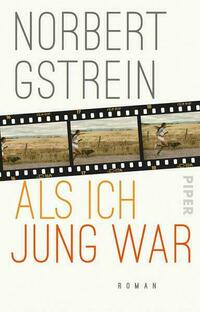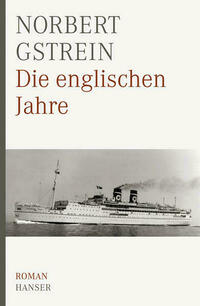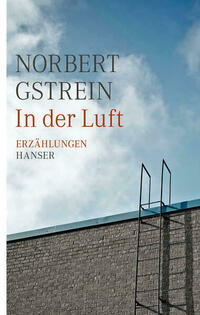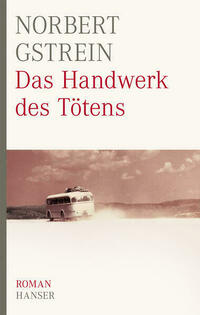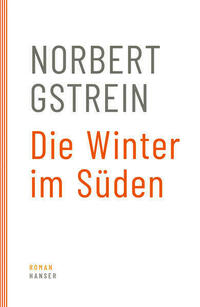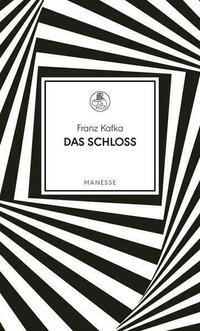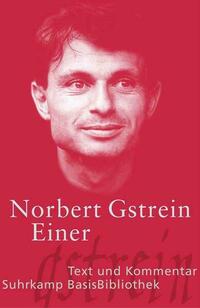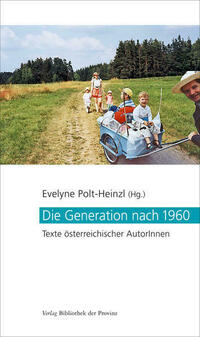Trauer um einen ängstlichen Draufgänger
Sebastian Fasthuber in FALTER 5/2016 vom 03.02.2016 (S. 27)
Der Tiroler Autor Norbert Gstrein erzählt in einem beachtlichen Roman von der Unmöglichkeit, ein gerechtes Buch über Israel zu schreiben
„Wenn Sie ein Buch über Israel lesen“ heißt der Begleitessay zu Norbert Gstreins neuem Roman in der Literaturzeitschrift Volltext, der auf die Lektüre einstimmen soll.
Der Autor stützt sich darin in weiten Teilen auf Ari Shavits Buch „Mein gelobtes Land“, in dem der israelische Journalist voll Wärme, aber auch mit kritischen Untertönen über sein Land und die zionistische Bewegung schreibt: „Besetzung und Bedrohung sind die beiden Eckpfeiler unserer Situation geworden.“
Sich ein bisschen auf „In der freien Welt“ einzustimmen, kann tatsächlich nicht schaden. Gstrein widmet einen beträchtlichen Teil seines neuen Romans dem Dauerkonflikt zwischen Israel und Palästina. Damit begibt er sich auf noch bedeutend heikleres Territorium als bei seinem umstrittenen Roman „Die ganze Wahrheit“ (2010), der als Schlüsselroman über seine ehemalige Verlegerin Ulla Berkéwicz kontrovers diskutiert wurde.
Wenn man ein Buch über Israel schreibt, zumal mit Gstreins Herkunft, muss man natürlich mit Missverständnissen rechnen. „Ich könne versuchen, in meiner Darstellung noch so wahrhaftig zu sein“, lässt der Autor seinen Ich-Erzähler Hugo gegen Ende des Romans denn auch räsonieren, „das ändere nichts an der Tatsache, dass ich Österreicher sei und in eine Welt hineinschriebe, in der die Nachkommen derer, die vor siebzig oder achtzig Jahren geschrien hatten ,Juden, raus aus Europa‘, heute ,Juden, raus aus Palästina‘ schrien. (…) Ich könne mich noch so sehr dagegen zu wappnen versuchen, ich würde Sympathien von den falschen Leuten bekommen.“ Ums Provozieren geht es dem Autor, den das Profil einmal einen „Virtuosen der Provokation“ genannt hat, diesmal nicht. Sein Hugo bemüht sich redlich, beide Seiten zu verstehen.
Er trifft sich mit israelischen Schriftstellerkollegen; er geht am nächsten Tag auch in der vor allem von Palästinensern bewohnten Westbank spazieren. Er wäre so gern unparteiisch, muss sich jedoch eingestehen: „Es war doch nicht so einfach, wie ich mir eingeredet hatte, an einem Abend in Tel Aviv bei einer jüdischen Familie zum Seder zu gehen, von ihr mit der größten Herzlichkeit aufgenommen zu werden und am Tag darauf mit unklaren Absichten nach Hebron zu fahren und sich die Sorgen und Befürchtungen der Gegenseite anzuhören. Das waren andere Koordinatensysteme.“
Wie verfahren die Situation ist, geht dem Gast schon bei einer Begegnung mit einem Palästinenser auf, der ihm erzählt, sein Großvater habe in Jaffa eine Orangenplantage besessen. Im Israelischen Unabhängigkeitskrieg 1948 sei dieser vertrieben worden. Seither habe es dort „keine richtigen Orangen mehr“ gegeben, so der Mann. „Keine palästinensischen?“, fragt Hugo nach. Die Antwort: „Orangen, die nicht schmecken.“
Der Grund für Hugos Reisen und Nachforschungen ist der Tod seines Freundes John. Als junger Schriftsteller hatte er den amerikanischen Juden bei einem USA-Aufenthalt kennengelernt. Über die Jahre verbrachten die beiden – an der Ost- oder Westküste, in Tel Aviv oder Österreich – immer wieder ein paar Tage, Wochen oder Monate miteinander. Gegen Ende regte John, der als Dichter weithin erfolglos geblieben war, an, Hugo solle doch den Roman seines Lebens niederschreiben.
John ist der wahre Held des Buchs, mit ihm ist Gstrein eine ebenso schillernde wie vielschichtige Figur geglückt: ein Baum von einem Mann, Frauenheld und Draufgänger, der mit seiner Rolle als Lebemann aber nur seine fundamentale Ängstlichkeit überspielte. Seine Mutter hatte die Naziherrschaft nur knapp überlebt; und er selbst hatte sich als junger Mann verpflichtet gefühlt, Dienst in der israelischen Armee zu tun. Die Wahnvorstellungen aus seiner Zeit als Soldat sollten ihn später nie mehr loslassen. Aus einer seiner zahlreichen Ehen hat John eine Tochter in Israel: „Sie hätte irgendwo in Amerika aufs College gehen können, sich mit Gleichaltrigen in aller Unschuld vergnügen (…). Stattdessen patrouillierte sie vielleicht durch die gleichen Dörfer, durch die John selbst schon patrouilliert war, (…) absolvierte die gleichen Schießübungen und stand im Ernstfall wieder und wieder nur den gleichen feindseligen Gesichtern gegenüber, die ihr zu verstehen gaben, dass sie nicht hierhergehörte und dass nie etwas besser würde, solange sie da war, sondern immer alles nur schlimmer.“
Es braucht in diesem Buch, in dem sich zwei tragisch miteinander verbundene Völker mit ihren Standpunkten aufreiben, ganz dringend einen Außenposten, eine positive Perspektive. Das Schöne liegt in Amerika, wie so oft bei Gstrein, zu dessen literarischen Säulenheiligen Hemingway und Faulkner gehören. Und so ist „In der freien Welt“ nicht nur ein beachtlicher Roman über Israel, über die Unmöglichkeit, ein beiden Seiten gleichermaßen gerecht werdendes Buch zu schreiben. Es lässt sich auch als Liebeserklärung an Amerika als ewigen Sehnsuchtsort lesen.
Auch hier findet sich auf ganz engem Raum Gegensätzliches, Nur kann im land of the free zumindest theoretisch jeder werden, was er will: „Das war Amerika, wie es im Buch stand, Himmel und Hölle direkt nebeneinander, als könnte man sich tatsächlich frei entscheiden und es würde nur an einem selbst liegen, ob man auf der einen oder auf der anderen Seite landete.“