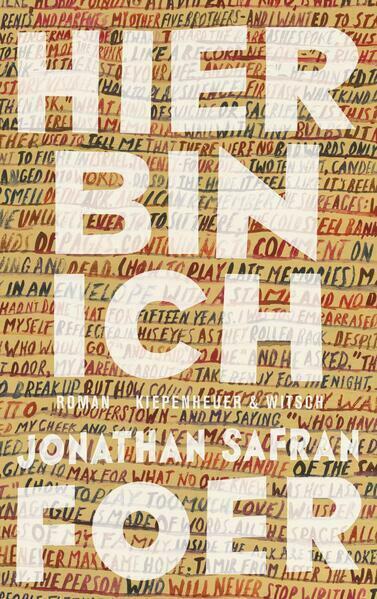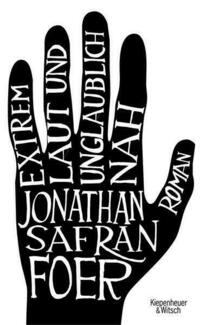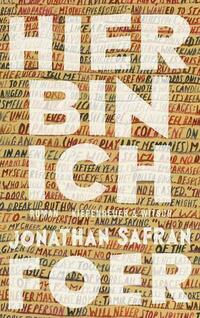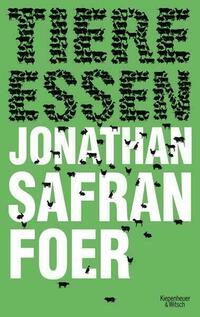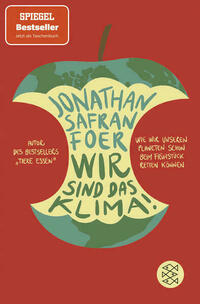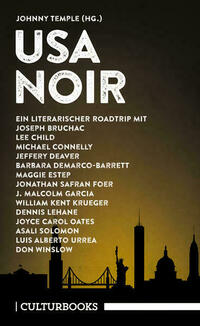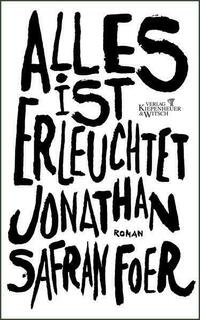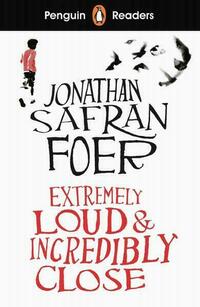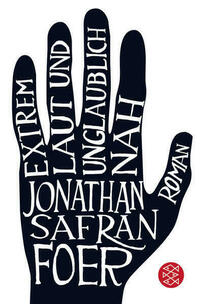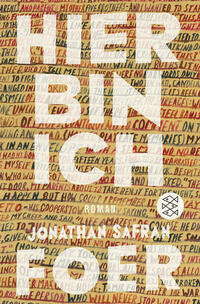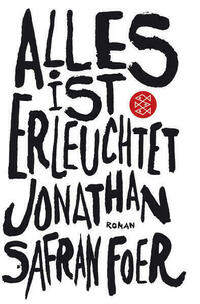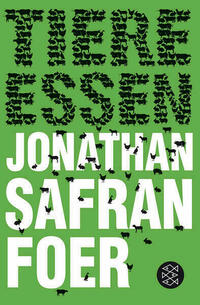Jacob und Julia vor dem Doppelwaschbecken
Klaus Nüchtern in FALTER 45/2016 vom 09.11.2016 (S. 33)
In „Hier bin ich“ spult Jonathan Safran Foer viel Zahnseide ab, um die Midlife-Melancholie eines Ehepaares zu sezieren
Aus seiner E-Mail-Korrespondenz mit der Schauspielerin Natalie Portman, die – aus welchen Gründen auch immer – im Mai dieses Jahres in der New York Times veröffentlicht wurde, wissen wir, dass Jonathan Safran Foers Leben von Autoparken und Müllentsorgung strukturiert wird und dass die härteste Herausforderung für einen Schriftsteller nicht in Einsamkeit und Schreibblockaden besteht, sondern in der Verantwortung für die Meerschweinchen.
Das klingt so, als würde der mittlerweile 40-jährige Foer, der sich mit seinem Debüt „Alles ist erleuchtet“ (2002) den Ruf des Junggenies und einen Millionen-Dollar-Vorschuss für den Nachfolgeroman „Extrem laut und unglaublich nah“ (2005) einhandelte, ein einigermaßen entspanntes und realistisches Verständnis von Alltagsleben aufbringen. Von dem um zwei Jahre älteren Jacob, Protagonist in Foers jüngstem Opus, lässt sich das nicht behaupten. Er und seine Frau Julia sind nachgerade ein Doppelgestirn der Unentspanntheit, und die allabendliche gemeinsame Dentalhygiene vor dem Doppelwaschbecken – Jacob: Billigzahnseide von CVS, Julia: Oral-B-Glide-3d-Zahnseide – hilft da auch nicht weiter: „,Schon Zähne geputzt?‘, fragte Julia. Jacob sagte: ,Direkt neben dir. Vor einer Minute.‘“
Foers erster Roman nach elf Jahren – dazwischen lag das ernährungsethische Sachbuch „Tiere essen“ – ist von hoher Auskunftsfreudigkeit in Sachen Körperpflege. Er verwendet Cetaphil Daily Facial Cleanser und hernach Eucerin Daily Protection Moisturizing Face Lotion; sie legt nach der Reinigung mit S.W. Basics Cleanser noch Skinceuticals-Retionol-I-Maximum-Strength-Refining-Nachtcreme, Laneige-Water-Bank-Feuchtigkeitscreme und Lancôme-Rénergie-Lift-Multi-Action-Nachtcreme auf.
Ganz klar: Wer so viel kosmetischen Aufwand betreibt, hat etwas zu übertünchen. Warum Jacob vor Julia zu verbergen sucht, dass er sich Hydrocortisonacetat-Zäpfchen in den Anus schiebt, ist nicht ganz nachvollziehbar; warum er sich heimlich ein zweites Handy zugelegt hat, schon. Die Nachrichten, die er einer Arbeitskollegin schickt – sie gehen stark in Richtung „ich will mein sperma aus deinem arsch lecken“ –, bleiben dennoch nicht unentdeckt. Angesichts der wirklich auffälligen Analfixiertheit des Romans, der neben den entsprechenden Masturbationsfantasien und -techniken des ältesten Sohns – nimm das, Philip Roth! – auch noch einen inkontinenten, die halbe Wohnung vollkackenden Hund aufzubieten hat, ist es wohl angemessen zu behaupten, dass die Ehe der Blochs im Arsch ist.
Aber selbst Leser, die nicht genug bekommen können von den endlosen Dialogen eines selbstmitleidigen Schluffis und einer urschelhaften Helikopter-Mom in der Erschlaffende-Brüste-und-Erektionen-Phase ihrer Ehe, werden keine rechte Freude haben mit einem Roman, der nicht bloß verschwatzt, sondern darüber hinaus auch noch umständlich, unökonomisch und vorsätzlich verwirrend erzählt ist.
Zugleich traut der Autor seiner Leserschaft offenbar nichts zu, denn als würden sich seine Figuren nicht ohnedies ständig selbst entblößen, werden sie uns auch noch in auktorialen Kommentaren ausgedeutet und mit manierierten Metaphern behängt: „Sie wussten nicht mehr, was real war, sahen sich mit zig emotionalen Minenfeldern konfrontiert; sie tapsten auf den Zehenspitzen ihres Herzens durch die Stunden und Zimmer (…).“ Wen wundert’s da noch, wenn „ein niemals ruhender mütterlicher Gehirnlappen“ Pläne schmiedet?
Der Ennui des Mittelstands gebiert Simulationen und Projektionen. In der virtuellen Welt von „Other Life“ ist Sam eine Latina (ein Avatar, der leider unbeabsichtigt von Jacob gekillt wird), und Sam schreibt die TV-Serie, die ihm wirklich etwas bedeuten würde, ausschließlich für die Schublade. Das authentische, weil tatsächlich bedrohte Leben aber aus Jacobs Sicht führt dessen israelischer Cousin: „Tamir hatte versucht, nicht getötet zu werden, während Jacob versucht hatte, nicht aus Langeweile zu sterben.“ Die Großväter der beiden waren Brüder und überlebten in Galizien die Shoah. „Benny ging mit seiner Familie nach Israel, Isaac mit der seinen nach Amerika.
Isaac hatte die Entscheidung seines Bruders nie verstanden. Benny verstand Isaac, verzieh ihm aber nie.“ Der Konflikt lebt in den Kindern und Kindeskindern fort. Jacobs Vater Irv ist von der Idee der jüdischen Wehrhaftigkeit besessen und schreibt ein rabiat antiarabisches Blog. Und Tamir ist für Jacob eine zugleich bewunderte und verachtete Version seiner selbst: tüchtiger und tapferer, viriler und vulgärer.
Weltpolitisch prekär wird das Verhältnis zwischen den ungleichen Cousins, als ein schreckliches Erdbeben den Nahen Osten verwüstet und auch die politischen Grenzen verwirft; worauf unter anderen Albanien, Bangladesch, Gambia, Kirgisistan und die Malediven Israel den Krieg erklären.
Das ist der Moment, in dem der Roman endgültig wirr wird. Die schon zu Beginn antizipierte Katastrophe fordert zehntausende Tote und hat die Schändung des Felsendoms durch israelische Extremisten und den Einsturz der Klagemauer zur Folge; ein frivol großer Aufwand, um einen weiteren Beleg für die These zu liefern, dass Israel den amerikanischen Juden auch nicht sooo wichtig ist: „Nach der Beinahe-Zerstörung waren sie immer noch dort drüben, aber sie waren nicht mehr die Seinen“, heißt es von Jacob, der sich den Bemühungen des israelischen Premiers, eine Million amerikanischer Juden im Alter zwischen 16 und 55 nach Israel zu holen, dann doch verweigert.
Das Einzige, wozu sich Jacob auf den verbleibenden 100 Seiten, die von seinem Leben nach der Trennung erzählen, dann noch durchringen kann, ist die Einschläferung seines altersschwachen Hundes. Man wünschte, er hätte es schon 300 Seiten früher übers Herz gebracht.