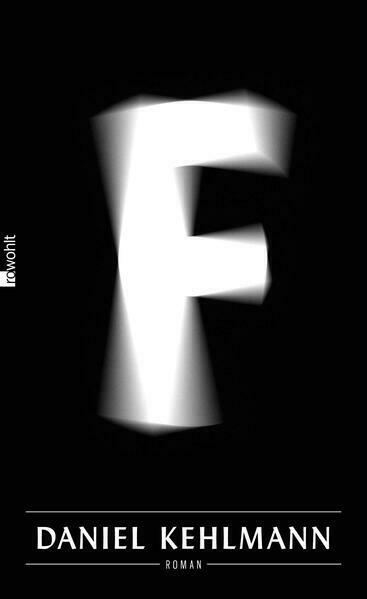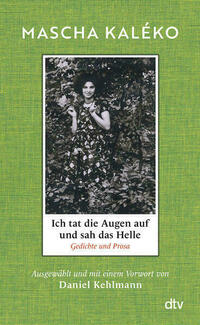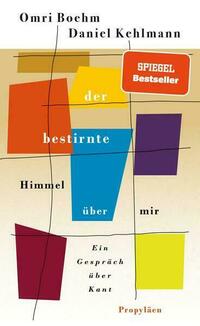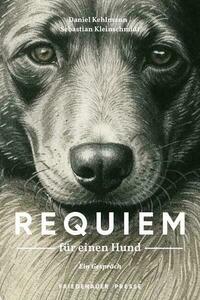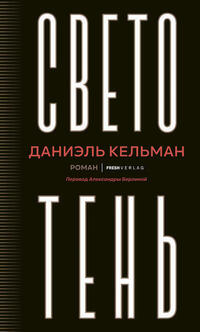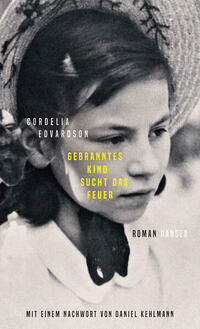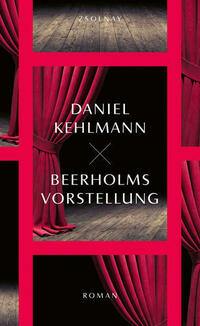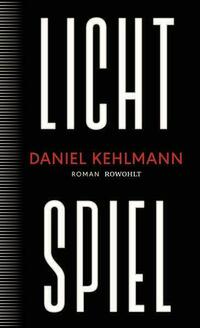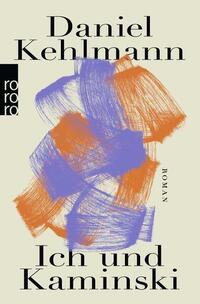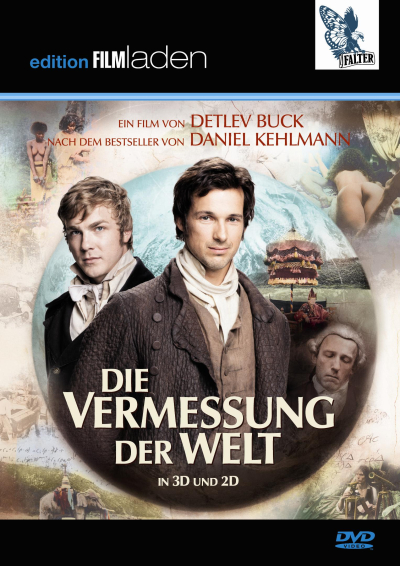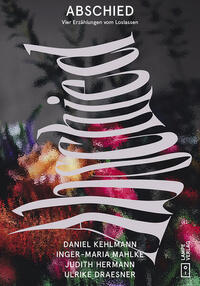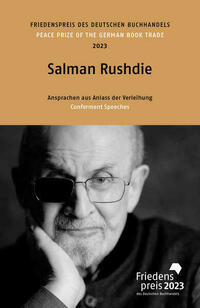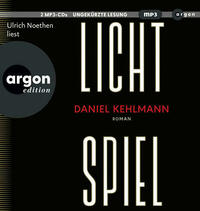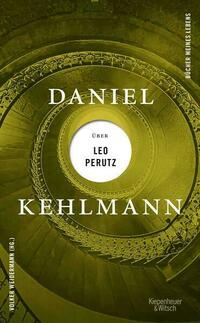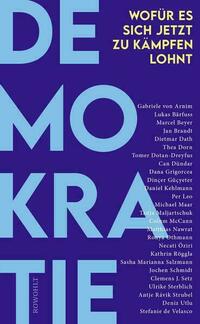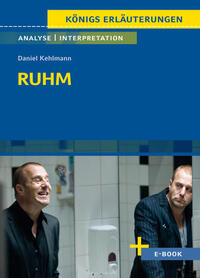Daniel mit dem Zauberhut
Klaus Nüchtern in FALTER 36/2013 vom 04.09.2013 (S. 32)
Mit "F" legt Daniel Kehlmann sein Opus magnum vor. Bloß: Was will uns der Autor damit sagen?
Ein Zauberkünstler muss Daniel Kehlmann als Buben nachhaltig beeindruckt haben. Denn schon in seinem Debüt "Beerholms Vorstellung" (1997) stellte er einen Täuschungskünstler mit der Ambition zum echten Magier in den Mittelpunkt des insgesamt eher viskos zu lesenden Romans: Was, wenn es nicht bloß ein Trick, sondern echte Zauberei wäre?
Kehlmann zählt zu jenen Autoren, die nicht einfach Bücher veröffentlichen, sondern ein Werk in die Welt setzen. Insofern ist der Zauberkünstler, der nun zu Beginn von "F" seinen Auftritt hat, auch als Referenz aufs eigene Frühwerk zu verstehen. Man sieht: Hier arbeitet sich jemand an seinen Themen ab, verknüpft Figuren und Motive über die Grenzen von Buchdeckeln hinweg.
Ein Vater besucht mit seinen drei Söhnen die Vorstellung eines Illusionisten. Der Vater heißt Arthur (Friedland), die beiden voneinander kaum zu unterscheidenden Zwillinge Iwan und Eric, deren Halbbruder Martin. Im Windschatten von Dostojewskis Karamasow-Brüdern hat sich Kehlmann also auch gleich noch die Aufmerksamkeit der Mediävisten gesichert, die sich nun den Kopf darüber zerbrechen können, was Artus, Iwein und Erec in "F" verloren haben und was Kehlmann mit Hartmann von Aue am Hut haben mag.
In der Artus-Saga heißt der Magier Merlin, hier tritt er als "der große Lindemann" auf und manipuliert gekonnt seine Versuchspersonen. Schließlich bittet er auch den widerwilligen Arthur auf die Bühne, der sich entgegen seinen Beteuerungen keineswegs als hypnoseresistent erweist, sondern sofort gesteht, dass er ein unglückliches, unambitioniertes Leben führt, aus dem er gerne aussteigen würde. Worauf der Zauberkünstler sich in einen Selbstoptimierungscoach verwandelt und Arthur den unorthodoxen Befehl erteilt, sich fortan zu bemühen, "egal was es kostet".
Und Arthur macht Tabula rasa: Er liefert seine drei Söhne ab, räumt das ganze Geld vom Konto und verschwindet. Das ist die Ausgangslage des Romans. Um sie herzustellen, benötigt Kehlmann einen Zauberer und 40 Seiten. Sonderlich ökonomisch ist das – im Unterschied zum Romantitel – nicht. Besonders plausibel auch nicht.
Die Jahre sind ins Land gezogen, die drei Söhne allesamt erwachsen und mehr oder weniger unglücklich – auch Iwan, der es vom talentierten, aber mäßig beachteten Künstler immerhin zum höchst erfolgreichen Kunstfälscher gebracht hat. Im Unterschied zu seinen realen Kollegen – von Elmyr de Hory (der auch in Orson Welles' Filmessay "F for Fake" auftritt, auf den der Romantitel anspielt) bis Wolfgang Beltracchi – malt Iwan aber nicht im Stile bereits berühmter Maler, sondern schafft quasi Künstler samt Werk: Als Kritiker und Kunstwissenschaftler setzt er Heinrich Eulenböck, der davor eher als betulicher Landschaftspinsler gehandelte wurde, als seriösen Künstler durch, um – mittlerweile auch dessen Lebensgefährte – schließlich die Bilder zu malen, die als Eulenböcks Hauptwerk Geltung erlangen.
Wieder ist Kehlmann in der Kunstwelt gelandet, der er schon seinen satirischen Roman "Ich und Kaminski" (2003) gewidmet hat. Von der Handlung her ist die Iwan/Eulenböck-Geschichte der mit Abstand interessanteste Sub-Plot. Im Detail vermag aber auch er nicht zu überzeugen. Die Auffassung, Kunstkritiker könnten einzelne Künstler und ganze Stilrichtungen quasi nach Belieben rauf- und runterschreiben, ist so schlicht, dass sie nicht einmal als satirische Zuspitzung zulässig ist. Und wenn Iwan über die Aufmerksamkeitsökonomie des Kunstmarktes oder das Scheitern der Entauratisierungsanstrengungen à la Duchamp räsoniert, klingt das oft reichlich betulich: "Dinge der Kunst sind Dinge wie alle anderen: Manche sind äußerst gelungen, aber keines stammt aus einer höheren Welt." Musste wohl auch mal gesagt werden.
Überhaupt können einen die Worte und Gedanken, die der Autor in den Mund und die Köpfe seiner Figuren legt, gelegentlich einigermaßen enervieren. Schon gut, "nur in Studentenzeiten führt man solche Gespräche" wie Martin und seine Kommilitonen von der Theologischen Fakultät. Aber müssen sie wirklich bis zum Abwinken altklug sein? ("Augustinus ist Schrumpf-Aristoteliker. Er steckt tief in der Substanzontologie, deshalb ist er auch überholt.")
Ja gewiss, Eric ist paranoid, zwangsneurotisch, medikamentensüchtig und generell ein bissl gaga, und Kehlmann gelingt es überzeugend, dessen Gehetztheit in erlebter und gesprochener Rede zu vermitteln. Das ändert allerdings nichts daran, dass einem die hektischen Telefonate mit der Geliebten und das erratische Geschwätz mit dem Chauffeur auf den Wecker gehen.
Und schließlich sind da auch noch Arthurs Bücher, die große Beachtung erfahren und sogar eine Selbstmordwelle auslösen. Aufgrund der Beschreibungen und der ausführlichen Zitate, die der Roman bereitstellt, ist dieser Ruhm freilich nicht nachvollziehbar, sondern bleibt bloße Behauptung.
Das Leben imitiert die Kunst viel stärker als die Kunst das Leben, meinte Oscar Wilde. Das Leben ähnelt der Kunst insofern, als für Außenstehende oft nur schwer oder gar nicht zu unterscheiden ist, was authentisch und was gefälscht ist, lautet die implizite These von "F". Denn so wie Iwan das Werk Eulenböcks simuliert, so schummeln sich auch sein Zwillings- und Halbbruder durchs Leben.
Eric hat als Investmentbanker das Geld seines wichtigsten Kunden längst verzockt und fingiert – mit Ehefrau, Freundin und zahlreichen Büroaffären – ein normales Familienleben; Martin, die anrührendste Figur des Romans, ist fett und Priester geworden. Den mangelnden eigenen Glauben kompensiert er durch die Anstrengung, denjenigen seiner Schäfchen zu erhalten, wobei er für theologisch knifflige Fragen nur den Stehsatz "Es ist ein Mysterium" parat hat. Aber so wie minus mal minus plus ergibt, so kann sich der multiplizierte Unglaube vielleicht in Gläubigkeit verwandeln, auch wenn das Dogma der Transsubstantiation eine echte Herausforderung darstellt:
"Man kann das nicht glauben, man müsste geistesgestört sein. Aber man kann glauben, dass der Priester es glaubt, der wiederum glaubt, seine Gemeinde glaube es (
)."
"F" ist fraglos ein klug konzipiertes und mit einigem erzähltechnischem Aufwand exekutiertes Buch. Nur leider hat der Autor bei all seiner Ambition, ein komplexes Motivmobile zu installieren, ein bisschen aufs Erzählen vergessen. "F" liest sich selbst wie eine Romansimulation. Vielleicht ist das sogar Kalkül? Konsequent wäre es allemal. "Und was", schlägt Iwan Eulenböck einen Deal vor, "wenn man etwas wagen würde? Man malt ein paar Bilder, von denen man sich ausrechnen kann, dass sie den Leuten, auf die es ankommt, gefallen. Die schreibt man dann dir zu. Und später macht man öffentlich, dass es ein Scherz war."
Nicht auszuschließen also, dass Daniel Kehlmann nach Ablauf des Weihnachtsgeschäfts bekannt gibt, einen Ghostwriter (Thomas Glavinic?!) mit einer Kehlmann-Fälschung beauftragt zu haben. Nicht auszuschließen aber auch, dass ihm sein jüngster Roman einfach missglückt ist.