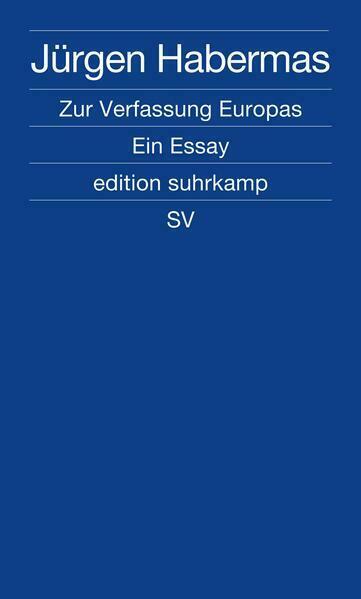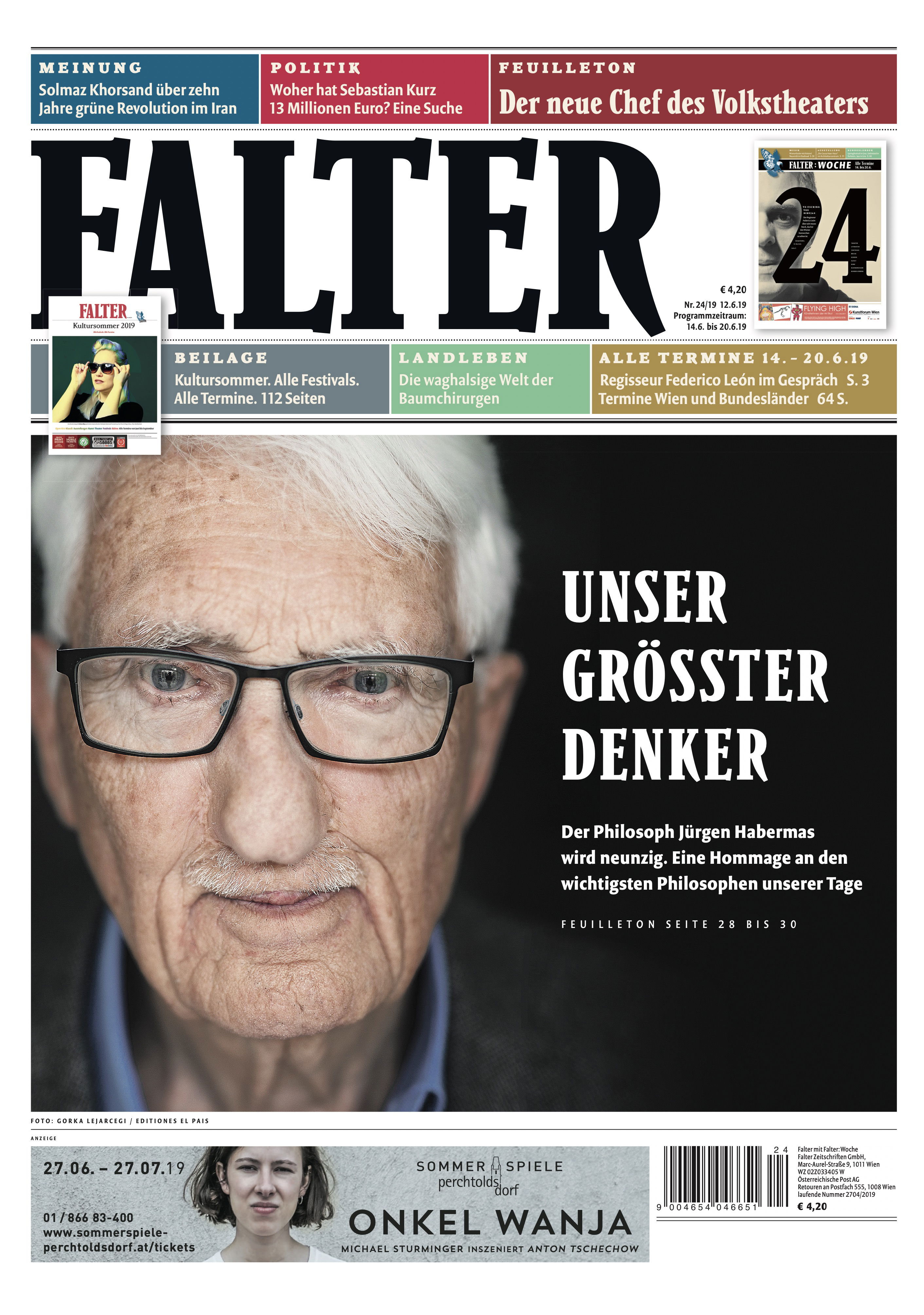
„Sprechen Sie über sich selber!“
Rudolf Walther in FALTER 24/2019 vom 12.06.2019 (S. 28)
Der Philosoph Jürgen Habermas wird 90. Seine rechten und konservativen Gegner sehen ganz alt aus
Der Philosoph und Intellektuelle Jürgen Habermas mag Interviews nicht. Er war „zeitlebens von der Überlegenheit des geschriebenen Wortes überzeugt“. Auftritte in Talk- und Personalityshows sind für Habermas schlicht undenkbar, weil diese Öffentlichkeit zur Inszenierung von Imagepirouetten pervertieren, in denen Öffentliches und Privates ununterscheidbar werden. Der leidenschaftliche Diskutant Habermas schätzt die alltagssprachliche Kommunikation sehr – „ich kenne keinen Menschen, dem das Reden und Argumentieren so viel Spaß macht wie ihm“, sagte der deutsche Sozialphilosoph Oskar Negt über ihn. Doch Habermas hält solche Kommunikation auch für naiv im Vergleich zum professionellen philosophischen Diskurs, der sich im Raum von Argumenten und Gründen bewegt, um Geltungsansprüche überprüfbar zu formulieren, das heißt, um dem „zwanglosen Zwang des besseren Arguments“ den Weg zu bahnen.
Das ist keine professorale Marotte, sondern hat neben theoretischen auch lebensgeschichtliche Wurzeln. Als Habermas 2004 den Kyoto-Preis, eine Art Neben-Nobelpreis, erhielt, forderte ihn Kazuo Inamori, Gründer des Konzerns Kyocera und von dessen Stiftung, auf: „Bitte sprechen Sie über sich selber!“ Habermas ging auf das für einen Philosophen eher befremdliche Ansinnen ein und erläuterte vier lebensgeschichtliche Wurzeln seines Denkens.
Zwei der lebensgeschichtlichen Wurzeln seines Denkens hätten mit seiner Sprachbehinderung zu tun, wie Habermas in seiner Dankesrede erläuterte. Direkt nach seiner Geburt wurde er einer Gaumenoperation unterzogen, mit fünf Jahren erfolgte ein zweiter Eingriff. Unmittelbar als Kommunikationsproblem erfuhr Habermas seine Behinderung als Schüler, weil man ihn wegen seiner nasalen Diktion und seiner Artikulation nicht oder nur schlecht verstand. Das bekam er in Form von Beleidigungen und Kränkungen zu spüren. Natürlich lassen sich zwischen diesen frühen Prägungen und dem wissenschaftlichen Werk keine geraden Verbindungen ziehen, aber die Bedeutung gescheiterter Kommunikation und daraus resultierender Kränkungen sind ohne Rückgriff auf küchenpsychologische Spekulationen verständlich.
Eine Frankfurter Skurrilität in der Zeit um 1968 zeugt davon. Es gab da Auftritte des Clowns Hans Imhoff, der sich als Aktionskünstler verstand und den Universitätsbetrieb durch Störungen verspottete. In Feuilletons werden Imhoffs Aktionen bis heute überschätzt und zu „Szenen eines höheren Lustspiels“ (FAZ, 1998) hochgeschrieben. Imhoff fiel jedoch nicht mehr ein, als Habermas’ Sprachbehinderung nachzuäffen. Die wurstige Zumutung eines Journalisten, die Begegnung mit Imhoff 30 Jahre danach zu kommentieren, beschied Habermas bündig mit einem einzigen Satz: „In jenen Tagen, als die Eier und Knallkörper im Hörsaal herumflogen, habe ich mich nur ein einziges Mal verletzt gefühlt: als Herr Imhoff unter die Gürtellinie schlug.“
Eine weitere lebensgeschichtliche Wurzel für sein Werk ist das Jahr 1945, das der Heranwachsende als „weltgeschichtliche Zäsur“ erlebte, auch wenn sich diese in der Kleinstadt Gummersbach, wo er aufwuchs, zunächst nur in einer KPD-Buchhandlung manifestierte. Vollends klar wurde dem 21-Jährigen die Zäsur, als er im Sommersemester 1950 in Zürich studierte. Hier sah er zum ersten Mal eine intakte Stadt mit einem großen kulturellen Angebot an Filmen, Theatern, Museen und Bibliotheken.
Als vierte Wurzel seines Denkens betrachtet Habermas die potenzielle Zerbrechlichkeit jeder Demokratie. Zwar gab es nach 1945 so etwas wie eine „Revolutionierung der Denkungsart im Ganzen“, aber an den Universitäten, im Justizwesen und in der Politik überlebten alte Eliten mit ihren nationalistisch imprägnierten Mentalitäten. Schon als 24-jähriger Student brach Habermas mit der „unseligen Verbindung von Nationalismus und bürgerlich-hoffähigem Antisemitismus“, wie sie sich in Martin Heideggers „Einführung in die Metaphysik“ aus dem Jahr 1935 zeigte. 1953 publizierte Heidegger diesen Text unverändert, ließ also „die innere Wahrheit und Größe“ des Nationalsozialismus weiterleben, so als ob der „planmäßige Mord an Millionen von Menschen“ (Habermas) nicht stattgefunden hätte. Konservative reagierten auf Habermas’ Kritik so, wie es ihm noch oft widerfahren sollte – mit der Denunziation als Marxist, der „den Geschäften der Herren im Osten Vorschub“ leiste.
Wörtlich erhob diesen Vorwurf gegen Habermas – 1957 Assistent von Theodor W. Adorno am Frankfurter Institut für Sozialforschung – Max Horkheimer, der Direktor des Instituts. Unter dem Titel „Zur philosophischen Diskussion um Marx und den Marxismus“ hatte Habermas eben einen Forschungsbericht veröffentlicht. Der missfiel Horkheimer so entschieden, dass er Adorno „die Aufhebung der bestehenden Lage“ befahl, das heißt die Entlassung von Habermas. Adorno wehrte sich tapfer, konnte sich aber nicht durchsetzen. Habermas stand über Nacht mit Frau und Kind buchstäblich auf der Straße. Wolfgang Abendroth, der „Partisanenprofessor im Lande der Mitläufer“, sprang ein und habilitierte Habermas 1961 mit der Studie zum „Strukturwandel der Öffentlichkeit“.
Horkheimer, der zeitlebens nie allein mit Habermas gesprochen hat, konzedierte diesem zwar „ungeheuren Scharfsinn“, Begabung und „geistige Überlegenheit“, aber traute ihm nur zu, „als Schriftsteller eine gute, ja glänzende Karriere“ zu machen. Mit dieser Prognose lag Horkheimer im Abseits und mit den Entlassungsgründen unter seinem und Habermas’ Niveau. Er unterstellte Habermas’ Arbeit über Marx, er sei mit den Machthabern in der Sowjetunion verbandelt und preise, „wenn auch ohne Absicht, die Diktatur“. Horkheimer buchstabierte schlichte Ressentiments in der Preislage der konservativen Parole im Kalten Krieg durch, wonach „der Sozialismus in einem Land und der Nationalsozialismus (...) ohnehin eine tiefe Verwandtschaft“ aufwiesen würden.
Ungeachtet der weltweiten Anerkennung des Philosophen trafen Habermas in der BRD immer wieder scharfe Attacken von Konservativen und Rechten, obwohl er selbst nicht zu „salopp hingeworfenen Zeitdiagnosen“ neige: „Ich gehöre nicht zu den Intellektuellen, die mal eben aus der Hüfte schießen“, bekannte er vor gut einem Jahr in der spanischen Zeitung El Pais.
Vom Fernsehintellektuellen Peter Sloterdijk wird das niemand behaupten wollen. Im Handstreich erklärte Sloterdijk die Kritische Theorie im Herbst 1999 für tot und Habermas zum „Starnberger Ajatollah“, der „Fatwas“ ausspreche und dienstbare Büttel als intellektuelle Rufmörder durchs Land schicke. In Fahrt geraten, legte Sloterdijk nach: „Das ist das Schicksal der Söhne großer Faschisten. Unter dem Nazismus hat der Vater von Habermas eine wirklich große Rolle gespielt, über die man öffentlich besser nicht redet.“ Das konnte man gar nicht, denn Habermas’ Vater war ein Subalterner – Major der Wehrmacht (in Frankreich eingesetzt, sehr gut erforscht) und im Zivilleben Leiter der Zweigstelle Gummersbach der Industrie- und Handelskammer Köln/Wuppertal. So kommen rechte Gurus mit der „Schlüsselattitüde des großen Denkers, aber ohne empirische Kenntnis“ daher.
Für das FAZ-Hilfspersonal wurde Habermas-Bashing unter Frank Schirrmacher zur Aufstiegschance. Einem der Jungschützen fiel zur Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels (2001) nur das Spielchen „Habermas für Kinder“ ein, in dem der Philosoph der „guten Absichten“ hämisch zum Ordnungshüter im „Kinderzimmer“ nobilitiert wird. Rustikal langte auch der Literaturwissenschaftler Karl Heinz Bohrer zu, der im Zuge der „nationalen“ Wiedergeburt von 1989 auf „deutsche Nationalgeschichte“ umsattelte und Habermas 2001 des „geschichtsfeindlichen Universalismus“ bezichtigte, um sein eigenes Halali für Kriege im Namen von nationalistischen Girlanden – „höheres Ethos, letzte Causa und brinkmanship“ – wenigstes am Stammtisch zu retten.
Spätestens damit war das Niveau nach unten offen. Der Ex-FAZianer Jürgen Busche verkaufte als Rentner 2006 dem rechten Blatt Cicero die vom FAZ-Journalisten Joachim Fest und anderen kolportierte, restlos erfundene Geschichte, Habermas habe als 14-Jähriger ein handschriftlich formuliertes „Bekenntnis zum Führer“ als Erwachsener „verschluckt“, um seine Spuren als Früh-Nazi zu vernichten. So agieren gutbürgerliche Konservative, wenn es gegen links geht. Schamlos.
All das wurde noch unterboten. Einen Salto mortale ins Reich der ewig Peinlichen schlug der Satiriker Eckhard Henscheid. Satire, sagt man, dürfe alles, außer sich über Eigennamen lustig machen, da diese jedem schuldlos zufallen. Das hinderte Henscheid nicht daran, Habermas als „Habi“ und „Habermaus“ zu verspotten. In einem FAZ-Artikel machte sich 1998 ein Nachwuchsmann lustig über Habermas’ Sprachbehinderung. Sein Freund Alexander Kluge richtete dem Blatt im ersten Leserbrief seines Lebens mit einem Wort aus, was derlei ist: „infam“.
Es gab Habermas-Gegner auch von links. Die professoralen und freischaffenden „Adorninis“ und „Adornauten“ aller Kaliber bemerkten nicht, dass sie sich mit ihrer selbstverschuldeten Ignoranz im Trüben einrichteten. Statt Habermas zu lesen, bezichtigten sie ihn lieber des „Verrats“ an Adornos Erbe – zunächst explizit und, als das nur noch lächerlich wirkte, implizit oder mit dem Herbeten von aufgelesenen wohlfeilen Gemeinplätzen, die nur belegen, wie wenig sie von Habermas verstanden. Zum „Verräter“ wurde ihnen Habermas, weil er sein eigenes Denken nicht abdichtete und in die Sackgasse der „Negativen Dialektik“ mit ihrem „rabenschwarzen Totalitätsdenken“ (Habermas) steuerte, sondern offen hielt. Habermas verabschiedete sich auch von Teilen der „Dialektik der Aufklärung“ und der aus dem historischen Kontext der Entstehung in dunkler Zeit (1944/47) verständlichen, aber in ihrer Rigidität haltlosen Vernunftkritik, die der Vernunft den Boden entzieht. Er verzichtete auch auf spekulativ aufgeladene Metaphern – vom „Nichtidentischen“ bis zur „Versöhnung“ –, mit denen Adornos Spätwerk für die Philosophie einen Rest von privilegiertem Status behauptete.
Mit Habermas wurde die Philosophie beziehungsweise die Kritische Theorie von ihrer geschichtsphilosophischen Last sowie ihrem auratischen Sprachgestus befreit und auf den Boden einer Wissenschaft unter anderen zurückgeholt. Die Eleganz und Elastizität von Habermas’ Denken drechselten die Kritikerinnen und Kritiker von rechts zum Vorwurf des Opportunismus und jene von links verbunkerten sich hinter Adornos schillernden Begriffen und Metaphern, indem sie diesen ihren Zeitkern entzogen und sie dadurch zu Dogmen sterilisierten.
Habermas dagegen bestand auf der historischen Situierung der Vernunft und auf deren Fähigkeit zu radikaler Selbstreflexion, mit der sie vermeintlich Verbürgtes und herkömmliche Wahrheitsansprüche diskursiv relativierte, also im Sinne Kants Wissen von bloßem Glauben trennte. Die Selbstreflexion der Vernunft ist auf rationale Beschränkung, nicht auf spekulative Aufblähung gerichtet. Sie grenzt sich so von postmoderner Beliebigkeit ebenso ab wie von den zu dekorativen Girlanden geronnen rhetorischen Beständen der älteren Kritischen Theorie. Habermas’ Vernunftverständnis ist „skeptisch, aber nicht-defaitistisch“ – in Abgrenzung zu post- oder hypermodernen Positionen. Seine sprach- und diskurstheoretische Wende der Kritischen Theorie bewegt sich im Rahmen von pragmatistischen Bedeutungs- und Handlungstheorien, die sich nicht subjektbezogen begründen lassen, sondern nur auf der Basis von intersubjektivem Austausch von Argumenten und Gegenargumenten in Sprach- beziehungsweise Diskursgemeinschaften. Habermas’ Denken beruht in diesem Sinne im Kern auf Öffentlichkeit, Diskurs und Vernunft – eine an Kant orientierte Zentrierung, die Habermas offen als seine „Obsession“ bezeichnet hat.
Gegen die Verschwisterung von Wissenschaft und akademisch drapiertem Nationalismus wandte sich Habermas immer. Von seiner Hegel-Preis-Rede (1974) bis zu seiner Position im Historikerstreit (1986/87) und seinen Schriften zur „postnationalen Konstellation“ (1998) zieht sich ein roter Faden: die Kritik an der „völkischen Auffassung der Nation“ und „nationalen Identitäten“ als quasi-natürlichen Begebenheiten. In egalitär und demokratisch verfassten Staaten gehe es, so Habermas, nicht länger um dynastische Herkunftslegenden, ethnische Abstammungsgeschichten oder Herkunft und „Blut“, sondern um Menschen- und Bürgerrechte, egalitären Zugang zu Nahrung, Gesundheit, Bildung, Arbeit und Wohnung sowie politische Partizipation.
Es gibt keine demokratisch akzeptable Begründung dafür, diese Rechte und den Zugang zu den Basisressourcen in einem multinational, multireligiös und multiethnisch bevölkerten Staat national, religiös oder ethnisch zu organisieren, ohne grundrechtliche Minimalstandards zu unterlaufen. Habermas entfaltete im rechtsphilosophischen Werk „Faktizität und Geltung“ (1992) starke Argumente dafür, warum auf national orchestrierte Ausschließungsparolen, wie „Leitkultur“, oder „nationale Identität“, verzichtet werden muss. Damit will sich das im Halbdunkel gefangene Denken seiner konservativen und rechten Gegner nicht abfinden. Sie denunzierten Habermas’ Kritik schon seit zwei Jahrzehnten als opportunistisches „Dabeisein beim Dagegensein“ (FAZ, 2001 und 2014).
Habermas verabschiedete sich längst vom „vollmundigen Tenor“, wie er es 1998 ausdrückte, mit dem er 1968 in „Erkenntnis und Interesse“ die Emanzipation als der Geschichte eingeschriebenes Telos beschwor. Nach der Tilgung solcher geschichtsphilosophisch inspirierten Denkfiguren wird aber „die diskursive Verflüssigung“ von fortexistierender Macht, Ungerechtigkeit und Gewalt durch Wissenschaft und Kritik nicht obsolet. Die Begründungsstrategie für das Interesse an Emanzipation hat Habermas in „Faktizität und Geltung“ umgestellt auf Teilhabe und damit – gegen den konservativen Zeitgeist – an den „radikalen Gehalten des demokratischen Rechtsstaates“ festgehalten. Erstens: Gleiches ist gleich und Ungleiches ungleich zu behandeln. Und zweitens müssen sich Bürgerinnen und Bürger als virtuelle Autorinnen und Autoren von Recht verstehen, damit dieses zum richtigen Recht wird. Mit diesen Ansprüchen an Recht, Rechtsstaat und Demokratie provoziert Habermas alte rechte Seilschaften wie junge postmoderne.
Habermas findet weltweit hochverdiente Anerkennung. Das intellektuelle Niveau der Angriffe auf ihn ist in Deutschland in den letzten 50 Jahren hingegen ständig gesunken – jüngst durch einen Lateinlehrer und einen SPD-Kultusminister aus Rostock, die Habermas „Ahnungslosigkeit“ vorwarfen. In Südkorea, Japan, China, im Iran und vor allem im angelsächsischen Sprachraum wird über Habermas heute sachkundiger diskutiert als unter deutschen Konservativen und Rechten. Pünktlich zum 90. Geburtstag erschien das von Amy Allen und Eduardo Mendieta herausgegebene, 850-seitige „Cambridge Habermas Lexicon“. Habermas bedankte sich für die Ehre, als erster lebender Philosoph im renommierten Verlag mit einem Lexikon belohnt zu werden. Lächelnd merkte er an, auf der Rückreise zu prüfen, was mit seinen Arbeiten aus fast 70 Jahren durch die Aufspaltung in 230 Lexikonartikel passiert sei.
In dieser Rezension ebenfalls besprochen:
Wo geht's zum ewigen Frieden?
Wolfgang Zwander in FALTER 49/2012 vom 05.12.2012 (S. 10)
Die EU hat den Nobelpreis gewonnen. Wie kann Europa Friedensmacht bleiben? Zehn Antworten
Am 10. Dezember wird in Oslo der Friedensnobelpreis an die EU verliehen. Die Auszeichnung fällt in eine Zeit, in der die Union in der größten Krise seit ihrem Bestehen steckt. Der Falter fragte zehn Denker: Was muss aus Europa werden, damit die EU den Friedensnobelpreis in 50 Jahren erneut erhält?
"Europa fehlt der alte demokratische Grundsatz:
One Man, One Vote"
Es gibt zwei Herausforderungen, die die EU bewältigen muss, will sie in 50 Jahren wieder für den Friedensnobelpreis in Betracht kommen.
Problem eins betrifft die innere Reorganisation. Damit meine ich die Fähigkeit der Union, in Europa Frieden zu halten. So wie Europa zurzeit organisiert ist, gilt hier nicht der alte demokratische Grundsatz: One Man, One Vote – es gibt kein gleiches Gewicht der Stimmen. Die Bewohner kleiner Staaten haben einen unverhältnismäßig hohen Einfluss.
Der Einfluss eines Luxemburgers ist teilweise 15-mal so hoch wie der eines Deutschen. Das ist unbefriedigend, weil damit die starken Akteure, die letzten Endes Europa tragen müssen, marginalisiert werden.
Das klingt jetzt vielleicht merkwürdig, weil augenblicklich alle Welt ruft: Frau Merkel bestimmt den Kurs ganz allein. Das stimmt so aber nicht. Will Europa erfolgreich bleiben, muss das Zentrum gestärkt werden, sei es in Form einer stärkeren Machtkonzentration in Brüssel oder einer wie auch immer gearteten Achse zwischen Berlin und Paris.
Ich meine damit allerdings nicht, dass sich die EU in absehbarer Zeit zu einem Superstaat entwickeln wird. Fast im Gegenteil: Die Nationalstaaten werden in den kommenden Jahrzehnten mächtig bleiben und weiterhin den Takt der Union vorgeben.
Europas großes Problem Nummer zwei bezieht sich auf seine Nachbarn im Süden und im Südosten; also auf die afrikanischen Mittelmeerstaaten und die Regionen, die über die Türkei hinaus bis zum Kaukasus reichen.
Die EU muss es schaffen, diese Regionen politisch und ökonomisch zu stabilisieren, damit es nicht zu einer permanenten Armuts- und Elendsmigration kommt. Das Ergebnis davon wären militärisch scharf gesicherte Grenzen und eine hermetische Abschottung hinter Stacheldrahtzäunen. Das würde Jahr für Jahr tausende Menschenleben kosten und wäre sicher nicht friedensnobelpreisverdächtig. Europa muss hereinbrechende Ränder verhindern.
"Soll es die EU in 50 Jahren noch geben, braucht sie ein zentral gesteuertes Budget"
Ich möchte es kurz halten: Um weitere 50 Jahre zu überleben, was ja die Grundvoraussetzung dafür ist, dass Europa auch weiterhin ein erfolgreiches Friedensprojekt bleiben kann, braucht die EU vor allem eine einheitliche Haushaltsplanung, ein zentral gesteuertes EU-Budget.
Um das zu ermöglichen, bedarf es demokratisch organisierter Institutionen in Brüssel, die das Leben aller EU-Bürger betreffen.
"Europa darf nicht zur Kirchturmpolitik zurückkehren"
Die EU ist das beeindruckendste Friedensprojekt der Welt – nicht nur, weil sie Europa von der Geißel des Krieges erlöst hat. Die Union hat auch in ihrer Nachbarschaft hohe politische Wellen ausgelöst – weil ihre Werte über ihre Grenzen hinaus Kraft zur Veränderung spenden.
Was die politische Machtausübung anbelangt, ist die EU die größte Innovation seit der Entstehung des Nationalstaats vor 500 Jahren.
Die Union hat ihren Bürgern gezeigt, dass sie einerseits in bürgernahen Kleinstaaten leben können und andererseits trotzdem den Schutz und die Größenvorteile eines Binnenmarktes mit 500 Millionen Konsumenten genießen. Diese schiere Größe der EU ermöglicht es auch, fundamentale internationale Probleme anzugehen und zu lösen – von der Organisierten Kriminalität bis zum Klimawandel.
Noch wichtiger: Die EU hat ein neues Kapitel in puncto zwischenstaatlicher Sicherheit aufgeschlagen. Die Union folgt nicht mehr der alten politischen Logik, die besagt, dass es zwischen den Staaten ein Gleichgewicht der Macht geben soll und dass man sich in Angelegenheiten fremder Staaten nicht einzumischen habe. Das EU-Modell von Sicherheit basiert auf ökonomischer, politischer und vor allem rechtlicher gegenseitiger Abhängigkeit. In Europa wird heute nicht mehr auf dem Schlachtfeld gekämpft, sondern in den Gerichtshöfen.
All das hat dazu geführt, dass die EU schon jetzt viele Regionen auf der ganzen Welt zu mehr Integration inspiriert.
Um in 50 Jahren noch einmal den Friedensnobelpreis zu erhalten, muss die Union nun ihre eigenen Errungenschaften retten. Das Projekt Vereintes Europa steht heute vor der größten Bedrohung seit seinem Bestehen: Den EU-Volkswirtschaften blüht ein verlorenes Jahrzehnt, Populismus und Ausländerfeindlichkeit machen sich breit – nicht nur in Griechenland. Um diese drohende Katastrophe in den Griff zu bekommen, braucht es eine neue Form der europäischen Integration, die mehr auf Politik als auf Technokratie setzt.
Die Eurokrise muss zum Beispiel
so gelöst werden, dass sie keine unüberbrückbare Kluft zwischen den Euro- und den Nichteurostaaten schafft.
Bei all diesen Herausforderungen kommt der Nobelpreis gerade recht, um uns alle daran zu erinnern, dass wir in Anbetracht einer unbequemen und bedrohlichen Gegenwart nicht zur alten "Beggar my neighbour"-Politik zurückkehren sollten – was bedeuten würde, dass jede EU-Nation und die EU insgesamt wieder danach trachten würden, auf Kosten ihrer jeweiligen Nachbarn Kirchturmpolitik zu betreiben und mit Exportüberschüssen das volkswirtschaftliche Gleichgewicht zu zerstören.
"Die EU empfängt ihre Gäste mit Mauern und Stacheldraht"
Die EU müsste eine völlig andere Organisation werden, um sich den Friedensnobelpreis noch einmal zu verdienen. So wie sie jetzt besteht, ist die Union aus vielerlei Gründen kein würdiger Preisträger.
Der Vertrag von Lissabon sieht Aufrüstung und eine Erhöhung der militärischen Kapazitäten vor, was die EU auf schleichendem Wege zu einem Militärbündnis macht. Ein weiteres Argument gegen die diesjährige Auszeichnung sind die Sparmaßnahmen, die zwar Banken retten, aber Menschen in die Arbeitslosigkeit und die Obdachlosigkeit treiben.
Hinzu kommen Handelsabkommen mit armen Ländern, als dessen Folge die Volkswirtschaften in Entwicklungsländern mit hochsubventionierten EU-Waren zerstört werden.
Scharf zu kritisieren ist auch das Schengen-System und die Grenzschutzorganisation Frontex, die Europa in eine Festung verwandelt haben – die Union begrüßt ihre Gäste mit Mauern und Stacheldraht. Will sich die EU den Friedensnobelpreis irgendwann einmal wirklich verdienen, müsste sie eine Union werden, die Demokratie und Menschenrechte über Wirtschaftswachstum stellt.
"Die EU muss sich fragen:
Was folgt dem Kapitalismus?"
Früher lag die Frequenz der Kriege in Europa bei rund 30 Jahren. Nun ist es bisher fast 70 Jahre gelungen, einen Krieg innerhalb der EU zu verhindern. Das wollte man mit dem Friedensnobelpreis anerkennen, und das ist gut und richtig.
Wenn jedoch Europa in 50 Jahren wieder Kandidat für den Preis sein will, muss es ihn als Auftrag sehen, den Frieden zu erhalten.
Dazu gehört, dass Europa eine glaubwürdige Antwort auf folgende Frage findet: Was kommt nach dem Kapitalismus? Europa muss ein Wirtschafts- und Sozialmodell entwickeln, dass nachhaltig ist und mit geringem Wachstum auskommt.
Zudem muss die EU ihre Rolle im Rest der Welt stärker spielen lernen; Konflikte lassen sich in einer globalisierten Erde nicht mehr auf ferne Landstriche beschränken. Um mehr internationales Gewicht zu erreichen, brauchen wir, nicht erst in 50 Jahren, eine vergemeinschaftete Außen- und Sicherheitspolitik.
Drittens glaube ich, dass Europa seine kulturelle Identität bewahren muss, wenn es wieder Kandidat für den Friedensnobelpreis werden will. Die Identität Europas kann nicht, wie bisher, vor allem aus Pragmatismus bestehen. Die drei Identitätsfelder Region, Nation und Kontinent müssen gleichermaßen gewichtet werden. Ich bin zugleich Tiroler, Österreicher und Europäer – und nicht, wie früher, zuallererst Österreicher.
"Ein Gespenst geht um
in Europa – Europa"
Im Jahr 2002 standen Deutschland und Brasilien im Finale der Fußball-WM, und die meisten Italiener waren für Brasilien. Ich hingegen habe Deutschland die Daumen gedrückt. Warum, fragten mich meine Freunde? Als ich antwortete "Weil ich Europäer bin!", da waren sie perplex.
Der Sport hat eine politische Dimension, die alle Menschen auf der Welt interessiert. Zu einem Land "halten", bedeutet eine tief empfundene, politische Identifikation.
Das führt mich zur EU und zu den Problemen Europas: Die Union könnte den Friedensnobelpreis dann wieder gewinnen, wenn eine Mehrheit der Europäer Fans einer europäischen Mannschaft wäre, weil sie eine europäische ist.
Heute geschieht das nicht, weil der EU die Seele fehlt. Sie ist lediglich ein ökonomisches Joint Venture. Wir Europäer sprechen so viele verschiedene Sprachen, jedes Land hat sein eigenes Heer und seine eigene Außenpolitik.
Ein US-amerikanischer Soldat, der in Billings geboren ist, setzt in Afghanistan sein Leben für die Vereinigten Staaten aufs Spiel und nicht für den Bundesstaat Montana. Wenn ein Soldat aus Österreich oder Griechenland bereit wäre, für Europa zu sterben, könnten wir sagen: Ja, es gibt Europa.
Heute ist die EU ein Kunstprodukt, ein politisches Fantasma. Mit Karl Marx könnte man sagen: Ein Gespenst geht um in Europa – Europa.
Sicher, es gibt Gemeinsamkeiten zwischen den einzelnen EU-Staaten, aber vor allem in dem Maße, in dem sie alle amerikanisiert sind. Die EU ist eine Mischung aus wirtschaftlichem Kalkül und Amerikanisierung. Natürlich sind die meisten Europäer Christen, aber sie sind, verglichen mit den US-amerikanischen und afrikanischen Glaubensbrüdern, keine strenggläubigen Christen.
Erst wenn sich die Millionen europäischer Muslime eines Tages als Europäer fühlen werden, wird Europa endlich nicht mehr jener Kontinent sein, der jahrhundertelang den Islam bekämpft hat.
Seit mehr als 20 Jahren driften die europäischen Nationen auseinander, etwa Jugoslawien, die Tschechoslowakei, die baltischen Staaten, Belgien, Spanien und auch Italien. Dies geschieht fast immer auf der Grundlage ihrer jeweiligen sprachlichen Eigenheiten.
Wird es Europa noch geben, wenn alle Europäer Englisch sprechen? Ja, die EU wird den Nobelpreis vielleicht noch einmal gewinnen, aber nicht als Union, sondern nur als Europa. Der Zeitraum von 50 Jahren erscheint mir dafür aber etwas knapp bemessen.
"Das Unmögliche ist oft das Unversuchte"
Die EU braucht unsere Aufmerksamkeit und unsere Ideen. Zum ersten. Viele sagen, das alte Drehbuch der Integration entzünde doch keinen mehr. Falsch. Das Original ist großartig und hat kein Ablaufdatum.
Nur: Es dümpelt unerzählt vor sich hin. Oder kennen Sie einen Dokumentarfilm oder einen Bestseller über die Arbeitsweise von Jean Monnet, dem Initiator der Integration? Er war es, der die stolzen französischen Kohle- und Stahlbarone kurz nach Kriegsende dazu überreden konnte, sich mit ihren deutschen "Kollegen" an einen Tisch zu setzen – eine Sternstunde menschlicher Überzeugungskraft.
Die folgende Vergemeinschaftung der Kohle- und Stahlindustrie hat Deutschland politisch und Frankreich ökonomisch gerettet – und damit die Voraussetzungen für unsere Leben. Erstaunliches Detail: Jean Monnet war eine Art Ein-Personen-Unternehmen, ein "public interest entrepreneur".
Ja, er war bestens vernetzt, aber er agierte mit dem mentalen Spielraum eines Erfinders. Er war in seinen Ersthandlungen zur Integration nicht Mitglied einer Regierung, Bürokratie oder Partei. Er hatte ein Ziel (Frieden) und Ideen zum Weg dorthin (die Vergemeinschaftung des gefährlichsten Partikularinteresses: der Kriegsmaschinerie). Und damit zum zweiten Punkt, die EU braucht unsere Ideen.
Heute stellen wir uns in Start-ups oder als Social Entrepreneurs komplexen Aufgaben im Change-Management. Täglich überzeugen wir diverse Schläfer, Ignoranten und Gegner vom Aufbruch in die Zukunft. Doch als Generationen Erasmus, Facebook, X, X/Y und Y tun wir das kilometerweit weg von dem Ort, wo die Rahmenbedingungen unserer Leben verhandelt werden: in Politik und Verwaltung.
Wir, Vertreter des innovativen, des privat- und zivilgesellschaftlichen Europas müssen uns dem politischen Europa zuwenden. Motto: "Das Unmögliche ist oft das Unversuchte" (Jim Goodwin).
"Souveränität der Menschheit
als oberstes Credo"
Die EU muss weiterhin jeden Tag beweisen, dass die von Zäunen, Mauern und Stacheldraht umgebenen Nationalstaaten weniger wichtig sind als die Wege, Flüsse und Meere, die die Menschen verbinden.
Was Deutschland mit dem Fall der Berliner Mauer vorgemacht hat, muss Europa als Ziel seiner täglichen Anstrengungen dienen.
Egal, ob bei der Bekämpfung des Klimawandels oder bei der Neuordnung der Finanzmärkte, wir müssen Schluss machen mit der Souveränität der Nationalstaaten, die schon jetzt viel zu oft nur eine leere Hülse ist. Stattdessen sollten wir uns das zum Credo machen, was Alexis de Tocqueville die "Souveränität der Menschheit" nannte.
"Preis könnte Waffe für Demokratie sein"
Ich finde, die EU hat den Friedensnobelpreis nicht verdient. Wenn man den Preis an Dissidenten in autoritären Regimen verleiht, wird er zur Waffe für die Demokratie und kann Leben retten. In den Händen der EU-Politiker ist er nur ein symbolisches Brimborium.
Außerdem vertritt die Union in Europa und auf der ganzen Welt die exklusiven Interessen der Konzerne. Einst waren in den Entwicklungsländern so viele Hoffnungen auf Europa gerichtet, doch diese wurden von den Europäern bitter enttäuscht.
In Afrika und Teilen Asiens steht die EU heute für Hunger und Elend. Erst wenn in dieser Frage eine entschiedene Wende gelingt, würde die Union den Friedensnobelpreis verdienen.
"Die EU wäre eine
normsetzende Friedensmacht"
Um 2062 wieder zum Zug zu kommen, müsste die EU verstärkt supranational agieren. Ihre Schwächen - Intransparenz, Kompetenzüberschneidung, Unübersichtlichkeit – wären zu beseitigen. Vor allem im Fall von internationalen Krisen müsste sie mit einer Stimme sprechen und in der Außen- und Sicherheitspolitik mit Mehrheitsentscheidungen vorgehen.
Das Europäische Parlament sollte ein Gesetzesinitiativrecht besitzen und die EU als Ganzes mit mehr Finanzkraft ausgestattet werden. Einem europäischen Finanz- und Wirtschaftsregime sollte die politische Union folgen.
Die EU bliebe getragen von einem stabilen Kerneuropa (Deutschland-Frankreich-Benelux) und sie wäre gemeinsam mit der Türkei (die dann ein Mitglied des Europäischen Wirtschaftsraums wäre) ein Brückenland und Mediator im Mittleren und Nahen Osten – und somit in der Lage, den Friedensprozess in dieser Region zu fördern.
Zu Russland müsste die Union als Teil Europas die "strategische Partnerschaft" weiter ausbauen und damit den dortigen Demokratisierungsprozess konditionieren. Die EU wäre ein Mittler zwischen USA und China, der sich global nicht durch Militärintervention auszeichnet, sondern durch Rechts- und Kulturexport als normsetzende Friedensmacht.
In dieser Rezension ebenfalls besprochen:
Christian Felber in FALTER 51-52/2011 vom 21.12.2011 (S. 24)
Jürgen Habermas' Lehre aus der Eurokrise ist die Errichtung eines Weltparlaments. In seinem aktuellen Essay möchte er "ein überzeugendes neues Narrativ" entwickeln: In der gedanklichen Weiterführung von Kants ewigem Frieden fordert Habermas einen "demokratischen Bund von Nationalstaaten", gegründet auf einer "transnationalisierten Volkssouveränität" und einer "globalen Verfassungsordnung". Ziel ist nicht ein Weltstaat, aber die "Verrechtlichung" der Beziehungen souveräner Nationalstaaten – zum Zwecke der "Zivilisierung" ihrer "anarchischen Machtkonkurrenz" und der Zügelung der "transnational entfesselten gesellschaftlichen Naturgewalten" (sic!). Es geht ihm um die Herstellung und "Zurückgewinnung" politischer Handlungsfähigkeit.
Der Weg zu globaler Verfassungsordnung und Weltparlament führt nach Ansicht Habermas' über die konsequente Weiterentwicklung des europäischen Projekts. Konkret beschreibt er zwei "Innovationen": einmal, dass sich – weiterhin souveräne – Nationalstaaten der legislativen Gewalt eines suprastaatlichen Staatenbundes unterwerfen: Modell EU. Die zweite "Innovation", welche die erste legitimiert, ist die Aufteilung der Volkssouveränität in eine nationalstaatliche und eine EU-Bürgerschaft. Letztere soll zur Weltbürgerschaft fortentwickelt werden und institutionelle Demokratie in der Uno legitimieren. Die Zuständigkeit des Weltparlaments sollte jedoch auf die Vermeidung zwischenstaatlicher Gewalt, die Durchsetzung der Menschenrechte und die Lösung globaler Umweltprobleme begrenzt bleiben.
Der liberale Geist Habermas' zieht hier konsequent bis zur letzten – globalen – Stufe, wo es nur noch "Politik im Singular" gibt. Doch passieren dem renommierten Sozialphilosophen auf dieser gedanklichen Reise drei schwerwiegende Holperer.
Erstens: Bei der Sehnsucht nach "Handlungsfähigkeit" fällt auf, dass Habermas unkritisch das landläufige Globalisierungsnarrativ übernimmt, das ein anarchisches Vorauseilen der Wirtschaft wahrnimmt und nach einem Nacheilen der – regulierenden, umverteilenden, ökologischen – Politik ruft.
Dieser Mythos vom Globalisierungsprozess übersieht, dass die ökonomische Entgrenzung Folge und nicht Ursache des politischen Projekts der Globalisierung ist.
Es waren Rechtsakte der Nationalstaaten – freier Kapitalverkehr, globaler Investitionsschutz, Freihandelsabkommen –, die zu globalen Probleme wie Finanzkrisen führten. Die Politik war nicht abwesend, sondern sie hat gehandelt und verbindliches Wirtschaftsvölkerrecht geschaffen.
Umso gravierender, dass Habermas die ideologische Figur der "Unumkehrbarkeit" der selbstgeschaffenen Systemzwänge festigt, anstatt sie als umkehrbare politische Entscheidungen zu entlarven.
Denselben Mythos wendet er auch auf die EU an, weshalb er gar nicht auf die Idee kommt, dass die Rücknahme der Finanzliberalisierung eine Option sein könnte. Vielmehr erklärt er den Weg weiterer Zentralisierung für alternativlos: "Die überfällige Reform ist nur (sic!) auf dem Weg einer weiteren Übertragung von Kompetenzen von den Mitgliedsstaaten auf die Union möglich." Doch "notwendig" und "alternativlos" sind Begründungen eines Herrschafts-, nicht eines rationalen Diskurses.
Zweitens: Das Erforschen der Motive hinter undemokratischen, lobbygetriebenen Politikentscheidungen würde die Hoffnung, dass ein Weltparlament demokratischere Entscheidungen treffen würde als das EU-Parlament oder nationale Parlamente, relativieren.
Habermas diskutiert die Machtfrage gar nicht. Die Option, dass auch ein globaler Parlamentarismus im gegenwärtigen globalisierten Kapitalismus möglicherweise keine Verbesserung, sondern nur weitere globalparlamentarisch legitimierte Entscheidungen gegen die Mehrheitsinteressen mit sich bringen könnte, ist deshalb kein Thema.
Hier hätte sich der Leser eine Bezugnahme auf andere zeitgenössische Diskurse erhofft, seien es die aktuell weiterentwickelte Postdemokratie-These von Colin Crouch, die Bemühungen von Lobbycontrol oder die breit rezipierte These von der "Krise der Repräsentation".
Drittens: Vor diesem Hintergrund ist der größte blinde Fleck der Schrift die Definition von "Volkssouveränität".
Habermas differenziert zunächst zwei Komponenten von Bürgersouveränität: diejenige als Bürger eines Nationalstaates sowie die EU-Bürgerschaft, nach deren Vorbild die Weltbürgerschaft geschaffen werden soll. Bei der definitorischen Ermächtigung der Bürger zitiert er Armin von Bogdandy: "Theoretisch ist es überzeugender, nur die Individuen, die zugleich Staats- und Unionsbürger sind, als die einzigen Legitimationssubjekte zu konzipieren."
Auf Deutsch: Die Mitgliedsstaaten von EU und Uno genießen keine Souveränität, nur ihre Bürger.
Das wäre ja formidabel, wenn es bedeuten würde, dass die konstituierende Gewalt an die souveränen Bürger überginge – indem EU- oder UN-Verträge direkt von den Bevölkerungen ausgearbeitet und verabschiedet würden, zum Beispiel via gewähltem Verfassungskonvent und Referenda.
Doch nicht nur, dass Habermas solche Innovationen mit keiner Silbe erwähnt, er kritisiert nicht einmal, dass beim EU-Verfassungs- und Lissabonvertrag die Regierungen und Parlamente, also die "konstituierte Gewalt", selbst die konstituierende gespielt und den eigentlichen Souveränen die Verträge aufgenötigt haben: ein demokratisch zutiefst unsauberes Vorgehen und zugleich ein Bruch der Gewaltentrennung. Habermas lobt jedoch das Werk der Regierungen. "Wir müssen die Qualität würdigen, die die Europäische Union mit dem Vertrag von Lissabon bereits angenommen hat."
Habermas schreibt, bei der Übertragung von Souveränität auf die EU- und globale Ebene müssten nur die "demokratischen Verfahren intakt bleiben", damit "von einer Einschränkung der Volkssouveränität keine Rede" sein könne. Das ist doppelt prekär: Erstens hinken die demokratischen Verfahren auf EU-Ebene auch mit dem Lissabon-Vertrag dem Niveau der Nationalstaaten hinterher, ohne Aussicht auf baldige Besserung, eher im Gegenteil.
Zweitens sind auch die demokratischen Verfahren in den Nationalstaaten alles andere als "intakt". Deshalb müsste zuerst analysiert werden, warum die Demokratien auf allen Ebenen angeschlagen sind, bevor die Übertragung der gegenwärtigen Demokratiemodelle auf die globale Ebene als Lösung vorgeschlagen wird.
Indem Habermas die Demokratiedefizite nicht anspricht, übergeht er eine essentielle Voraussetzung für seinen, im Prinzip zustimmungswürdigen, Vorschlag. Diese Ungenauigkeit schlägt sich mit der peniblen Wortwahl: Schön gesagt ist jeder Satz bei ihm ein syntaktisch-stilistisches Kleinkunstwerk. Kritisch formuliert führt er einen elitären und exklusiven Diskurs, der zu seinem demokratischen Anspruch im Widerspruch steht. Da aber die Bürger nur in Begriffen, nicht aber in konkreten Prozessen eine Rolle spielen, passen Form und Inhalt wieder gut zusammen. Gemessen am Anspruch einer globaldemokratischen Vision wirkt der Essay karg
Die Spuren der Agenturen
Wolfgang Zwander in FALTER 50/2011 vom 14.12.2011 (S. 10)
Ratingagenturen treiben die Politik vor sich her. Nun drohen sie auch Österreich. Wie arbeiten Moody's, Standard & Poor's und Fitch?
Stellt man sich die Welt dieser Tage als Kolosseum vor, wäre die Weltwirtschaft am ehesten mit einem Gladiatorenkampf zu vergleichen. Den Staaten kommt dabei die Rolle der kämpfenden Sklaven zu; das Publikum, zu dessen Gaudium das blutige Spektakel aufgeführt wird, sind die Investoren; den Part des Kaisers wiederum, der mit seinem gesenkten oder gehobenen Daumen über Sein oder Nichtsein entscheidet, den übernehmen die Ratingagenturen. Und das Volk, das vor den Toren der Arena wartet, muss es nolens volens ausgerechnet mit den Gladiatoren halten.
Zu den Regeln des todernsten Spiels gehört, dass derjenige Gladiator, der ohnehin schon besiegt am Boden liegt, nennen wir ihn zum Beispiel Portugal, Irland oder Griechenland, dass dieser unglückliche Verlierer am allerwenigsten auf die Gunst des Kaisers hoffen darf. Die einen nennen diese Gnadenlosigkeit Brutalität, die anderen sprechen vom Gesetz des Marktes. Der Kaiser aber sagt lapidar, er stehe nicht den Griechen, Iren oder Portugiesen im Wort, sondern nur dem johlenden Publikum vulgo dem Gewinn der Investoren. Der Cäsar wäscht, wenn man es so will, seinen mächtigen Daumen in Unschuld.
Der Vergleich mit der Sklavenhatz mag groß gewählt sein, wer aber zurzeit die öffentliche Debatte über Ratingagenturen verfolgt, kann nur den Eindruck gewinnen, dass ihre Macht an die von antiken Kaisern gemahnt. Die deutsche Wochenzeitung Die Zeit verglich die einflussreichen Unternehmen gar mit Gottheiten, die ihre Ratingblitze rätselhaft und rachsüchtig auf das verschwenderische Europa herabschleudern.
Aus der Beziehung zwischen Eurozone und den drei großen US-amerikansichen Ratingagenturen Moody's, Standard & Poor's (S&P) und Fitch, die zusammen 95 Prozent des globalen Marktes beherrschen, so viel lässt sich sicher sagen, wird keine Freundschaft mehr. Ausgerechnet drei Tage vor dem jüngsten Brüsseler Gipfel am 8. und 9. Dezember, auf dem die europäischen Staatschefs einmal mehr die EU retten mussten, stellte S&P in Aussicht, die Kreditwürdigkeit von 15 Eurostaaten herabzustufen. Darunter auch Österreich, Deutschland, Finnland, Frankreich, Luxemburg und die Niederlande, also die sechs Staaten, die bislang mit dem Adelsprädikat Triple-A, der besten Bonitätsnote, versehen waren. Haben die Ratingagenturen Europa den Krieg erklärt?
Der New York Times-Starkolumnist und mehrfache Pulitzerpreisträger Thomas Friedman schrieb bereits 1996, dass es in der Welt nur noch zwei Supermächte gebe, die USA und Moody's: "Die einen können dich zerstören, indem sie Bomben abwerfen, und Moody's kann dich zerstören, indem es deine Anleihen herabstuft." Und, so lautete Friedmans Nachsatz, es ist keinesfalls ausgemacht, wer von den beiden mächtiger ist.
Spätestens an diesem Punkt stellen sich Fragen wie: Wer sind "die Ratingagenturen"? Wie funktionieren sie? Warum können sie das einst so stolze Europa, immerhin die Wiege des Kapitalismus, ins Wanken bringen? Und – vielleicht am wichtigsten – gibt es Alternativen zu ihnen?
Wer sich an die Fersen der Analysten von Moody's, S&P und Fitch heftet, findet sich plötzlich wieder in einer Welt, in der die Gesetze von Raum und Zeit aufgehoben scheinen, stattdessen gelten die Regeln der flüchtigen Allgegenwart von Information. Hier herrschen nicht Cäsaren, sondern Buchhalter. Sie regieren mit Mobiltelefon und Laptop, ihre stärksten Waffen heißen "Upgrading" und "Downgrading" und die Infrastruktur ihrer Macht besteht aus Datenströmen und Tiefseeverkabelungen, Satelliten und Lichtwellenleitern.
Die Schauplätze, wo man fern des Büros auf einen Analysten treffen könnte, sind der Flughafen und der Bahnhof. Der Falter erreicht Mitarbeiter der Agenturen im Taxi in London, im Schnellzug nach Frankfurt, oder gar nicht, weil sie im Flugzeug nach New York sitzen. Die Hauptquartiere der Unternehmen befinden sich in den Citys der großen Finanzmetropolen in verspiegelten Glaspalästen, deren Baustil sich vielleicht am besten mit neoliberaler Machtarchitektur beschreiben lässt.
Tag und Nacht schießen aus den großen Presseagenturen der Welt die Meldungen, in denen Moody's, S&P und Fitch zum Sparen ermahnen und ihren Kunden damit drohen, ihnen einen Buchstaben, ein A, B, C oder gar ein D wegzunehmen, was einen Verlust von Kreditwürdigkeit bedeuten würde. Sie verteilen Lob für Einsparungen, Schuldenbremsen und Nulldefizite, sie vergeben Tadel für hohe Lohnkosten und Sozialleistungen. Bei den Kunden kann es sich um Versicherungen und Banken handeln, oder um Kommunen und Staaten, wie zum Beispiel Österreich.
Die Republik lässt sich zurzeit sowohl von den drei großen US-amerikanischen Unternehmen bewerten, als auch von drei kleinen namen DBRS, Sustainalytics und Oekom Research. Insgesamt entstehen dem Steuerzahler daraus Kosten von rund 550.000 Euro pro Jahr, der Bewertungsprozess vollzieht sich nämlich auf eigene Rechnung. In der Außenkommunikation verstehen sich Ratingagenturen als Dienstleister, die lediglich einen Service anbieten, der auf den Finanzmärkten stark nachgefragt wird.
Wer versucht nachzuvollziehen, wie dieser Service funktioniert, der erhält wenige Antworten und keine Termine. Oder zumindest keine, über die man schreiben darf. Die Länderchefs der Unternehmen bieten handverlesenen Journalisten Hintergrundgespräche an, lassen aber vorher oft per Vertrag festlegen, dass vom Inhalt der Unterhaltung nichts bekannt werden darf. "Öffentlichkeitsarbeit" nennt sich das in der Welt von Moody's, S&P und Fitch.
Wenn die Analysten der Unternehmen nach Österreich kommen, um die Bonität der Republik zu überprüfen, treffen sie hier auf vier Gruppen von Ansprechpartnern. Die Regierung, die im Finanzministerium das Budget verwaltet; die Nationalbank, die die finanzielle Solidität der nationalen Geldinstitute überwacht; die Bundesfinanzierungsagentur, die die Zahlungen des Landes abwickelt; und die großen Wirtschaftsforschungsinstitute, die die Konjunkturentwicklung überblicken.
Pro großer Ratingagentur kümmern sich um ein Land wie Österreich zwei Mitarbeiter, die gegebenenfalls auch auf einen Expertenstab zurückgreifen können. Das Zweierteam besteht aus einem Senior- und einem Junioranalyst, die beide jeweils im Schnitt sieben bis acht weitere Staaten betreuen. Ihr Job verlangt ein Anforderungsprofil, das einer Mischung aus Detektiv und Buchhalter entspricht. Sie sitzen in der Regel in London, konsumieren Österreichs Qualitätsmedien, lesen den dicken Bericht des Staatsschuldenausschusses und so gut wie alle Veröffentlichungen der Nationalbank und des Finanzministeriums.
Die Analysten treffen gut informierte Personen zu Hintergrundgesprächen, telefonieren regelmäßig mit Wirtschaftswissenschaftlern und haben immer die aktuelle Konjunkturerwartung im Blick. Mindestens einmal im Jahr kommen sie, vollgesaugt mit Informationen, offiziell angemeldet im Doppelpack nach Wien, um ihre österreichischen Ansprechpartner im persönlichen Gespräch zu "grillen", wie es in der Branche genannt wird. Soll heißen, wie man unter der Hand erfährt, dass sie versuchen, sich in verhörartigen Gesprächen davon zu überzeugen, ob die ihnen zugänglich gemachten Datenmassen auch der Wirklichkeit entsprechen.
Über den Inhalt der Gespräche ist Geheimhaltung vereinbart. Wer im Finanzministerium anruft, um mit dem für den Kontakt mit den Ratingagenturen zuständigen Budgetsektionschef Gerhard Steger zu sprechen, wird von seinem Pressesprecher abgewimmelt. Es gebe keine Auskunft zu Ratingagenturen, man sei nicht die "Recherchezentrale der Medien". Als der Sektionschef dann doch zurückruft, sagt er nur, dass er nichts sagen könne und keine Zeit für ein Treffen habe, meint dann aber doch, dass "so lange sich die Märkte nach den Ratingagenturen richten, diese sehr mächtig sind". Die Bundesfinanzierungsagentur schreibt, dass sie zu "strengster Vertraulichkeit verpflichtet" sei, der Pressesprecher der Nationalbank will überhaupt keine Informationen weitergeben, und Bernhard Felderer, Präsident des Staatsschuldenausschusses, Leiter des Instituts für Höhere Studien und regelmäßiger Ansprechpartner für die Analysten der Ratingagenturen, sagt, die drei Ratingagenturen hätten an politischem Einfluss gewonnen, weil sie so groß geworden seien.
Felderer war es auch, der vor drei Wochen für Aufsehen sorgte, weil er öffentlich warnte, dass Österreich seinen Triple-A-Status verlieren könnte. Die Risikoaufschläge für heimische Staatsanleihen wurden im vergangenen November immer größer. Die Analysten sollen laut Informationen aus dem Bundeskanzleramt mehrmals in Wien nachgefragt haben, was die Bundesregierung plane, um den Verfall zu stoppen, woraufhin diese, nervös geworden, die deutsche Idee der Schuldenbremse kopierte.
Beim folgenden EU-Gipfel beschlossen die Chefs der 17 Euroländer, dass sie bis März kommenden Jahres einen Vertrag für nationale Schuldenbremsen und mehr Haushaltsdisziplin unterzeichnen werden. SPÖ-Bundeskanzler Werner Faymann und sein ÖVP-Vize Michael Spindelegger müssen nun hoffen, dass die Opposition doch noch einer Schuldenbremse in Verfassungsrang zustimmt. Was könnte andernfalls passieren?
Die Republik wird im Jahr 2012 rund 30 Milliarden Euro aufnehmen müssen, um all ihre finanziellen Pflichten erfüllen zu können. Wenn das Land sein Triple-A verliert, werden die Kredite teurer, woraufhin noch mehr Schulden gemacht werden müssen, um sie bedienen zu können, was tendenziell zu einer neuerlichen Herabstufung der Kreditwürdigkeit führt.
Ökonomen sagen dazu "negative Feedback-Loop", der Volksmund nennt das Teufelskreis. Dem solide aufgestellten Österreich würde ein "Downgrading" noch keinen Bankrott bringen, für die bereits am Boden liegenden Griechen oder Portugiesen würde ein weiterer Bonitätsverlust aber vermutlich das Gleiche bedeuten, um im Bild zu bleiben, wie für den besiegten römischen Gladiator der gesenkte Daumen des Kaisers. Der Tod durch fremde Hand.
Es gibt noch einen zweiten Teufelskreis, unter dem die Politik aktuell zu leiden hat. Ein guter Teil der Haushaltsdefizite, die nun von den Ratingagenturen als Grund für das "Downgrading" Europas angeführt wird, ist entstanden, weil die EU-Staaten zu Beginn der Finanzkrise die Banken vor dem Kollaps retten mussten. Laut einer Untersuchung des US-Kongresses haben Moody's, S&P und Fitch eine "erhebliche Mitschuld" an der Finanzkrise, weil sie Schrottpapiere von Multis wie AIG und Enron mit einer Topbonität ausgestattet haben. Die Finanzindustrie hat dieses Fiasko Milliarden Euro gekostet, die letztlich meist vom Staat refinanziert worden sind. Aus Sicht der Rating-
agenturen, die im Besitz von Banken und Finanzmogulen sind, war das wahrscheinlich ein "positive Feedback-Loop".
Neben diesem aus Sicht der Steuerzahler unschönen Bild steht noch der in US-Medien erhobene schwere Vorwurf, dass die drei Ratingriesen in der Vergangenheit diejenigen Papiere am besten bewertet hätten, mit denen sie selbst am meisten Umsatz gemacht haben. Hinzu kommt, dass S&P erst im vergangenen November, mitten in der Eurokrise, Frankreich mit einer fahrlässig falschen Herabstufung ins Taumeln gebracht hat, was in Paris und Brüssel auch noch nicht vergessen ist.
Oder doch? Man könnte zumindest diesen Eindruck gewinnen. Bereits 2008, direkt nach dem Ausbruch der Krise, haben Europas führende Politiker lauthals versichert, nun gehe es der Macht von Moody's, S&P und Fitch an den Kragen. Was ist passiert? Außer weiteren Forderungen nach mehr Haftung, Unabhängigkeit, Transparenz und Wettbewerb bislang nur sehr wenig. Noch immer gilt hingegen die auf die Eigenkapitalvorschrift Basel II zurückgehende Regelung, dass Versicherungen, Banken und Fonds gewisse Papiere und Anleihen abstoßen müssen, sobald sie von Moody's, S&P oder Fitch herabgestuft werden. Andernfalls würden sich die Manager der Firmen sogar strafbar machen.
So lange die EU nichts unternimmt, dass solche Regeln verändert werden, kann ein versuchter Spartacus-Aufstand der EU-Politiker gar nicht anders enden, als – um ein letztes unschönes Bild zu bedienen – in einem blutigen Gemetzel.
In dieser Rezension ebenfalls besprochen: